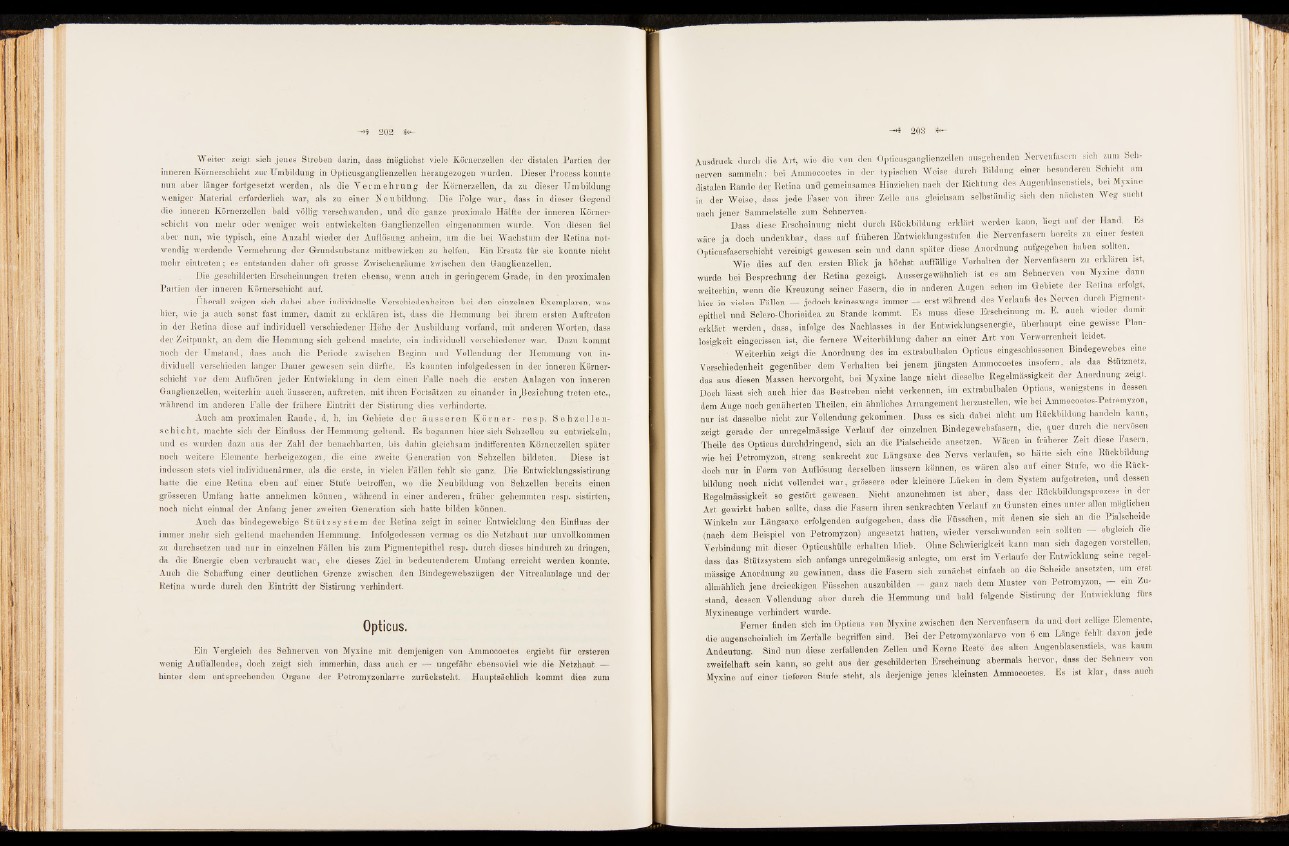
Weiter zeigt sich jenes Streben darin, dass möglichst viele Körnerzellen der distalen Partien der
inneren Körnerschicht zur Umbildung in Opticusganglienzellen herangezogen wurden. Dieser Process konnte
nun aber länger fortgesetzt werden, als die V e rm e h r u n g der Körnerzellen, da zu dieser Umbildung
weniger Material erforderlich war, als zu einer Neubildung. Die Folge war, dass in dieser Gegend
die inneren Körnerzellen bald völlig verschwanden, und die ganze proximale Hälfte der inneren Körnerschicht
von mehr oder weniger weit entwickelten Ganglienzellen eingenommen wurde. Von diesen fiel
aber nun, wie typisch, eine Anzahl wieder der Auflösung anheim, um die bei Wachstum der Retina notwendig
werdende Vermehrung der Grundsubstanz mitbewirken zu helfen. Ein Ersatz für sie konnte nicht
mehr eintreten; es entstanden daher oft grosse Zwischenräume Zwischen den Ganglienzellen.
Die geschilderten Erscheinungen treten ebenso, wenn auch in geringerem Grade, in den proximalen
Partien der inneren Körnersehicht auf.
Überall zeigen sich dabei aber individuelle Verschiedenheiten bei den einzelnen Exemplaren, was
hier, wie ja auch sonst fast immer, damit zu erklären ist, dass die Hemmung bei ihrem ersten Auftreten
in der Retina diese auf individuell verschiedener Höhe .der Ausbildung vorfand, mit anderen Worten, dass
der Zeitpunkt, an dem die Hemmung sich geltend machte, ein individuell verschiedener war. Dazu kommt
noch der Umstand, dass auch die Periode zwischen Beginn und Vollendung der Hemmung von individuell
verschieden langer Dauer gewesen sein dürfte. Es konnten infolgedessen in der inneren Körnerschicht
vor dem Aufhören jeder Entwicklung in dem einen Falle noch die ersten Anlagen von inneren
Ganglienzellen, weiterhin- auch äusseren, auftreten, mit ihren Fortsätzen zu einander in Beziehung treten etc.,
während im anderen Falle der frühere Eintritt der Sistirung dies verhinderte.
Auch am proximalen Rande, d. h. im Gebiete d e r ä u s s e r e n K ö r n e r - r e s p . S e h z e l l e n s
c h i c h t , machte sich der Einfluss der Hemmung geltend. Es begannen hier sich Sehzellen zu entwickeln,
und es wurden dazu aus der Zahl der benachbarten, bis dahin gleichsam indifferenten Körnerzellen später
noch weitere Elemente herbeigezogen, die eine zweite Generation von Sehzellen bildeten. Diese ist
indessen stets viel individuenärmer, als die erste, in vielen Fällen fehlt sie ganz. Die Entwicklungssistirung
hatte die eine Retina eben auf einer Stufe betroffen, wo die Neubildung von Sehzellen bereits einen
grösseren Umfang hatte annehmen können, während in einer anderen, früher gehemmten resp. sistirten,
noch nicht einmal der Anfang jener zweiten Generation sich hatte bilden können.
Auch das bindegewebige S t ü t z s y s t e m der Retina zeigt in seiner Entwicklung den Einfluss der
immer mehr sich geltend machenden Hemmung, infolgedessen vermag es die Netzhaut nur unvollkommen
zu durchsetzen und nur in einzelnen Fällen bis zum Pigmentepithel resp. durch dieses hindurch zu dringen,
da die Energie eben verbraucht war, ehe dieses Ziel in bedeutenderem Umfang erreicht werden konnte.
Auch die Schaffung einer deutlichen Grenze zwischen den Bindegewebszügen der Vitrealanlage und der
Retina wurde durch den Eintritt der Sistirung verhindert.
Opticus.
Ein Vergleich des Sehnerven von Myxine mit demjenigen von Ammocoetes ergiebt für ersteren
wenig Auffallendes, doch zeigt sich immerhin, dass auch er — ungefähr ebensoviel wie die Netzhaut —
hinter dem entsprechenden Organe der Petromyzonlarve zurücksteht. Hauptsächlich kommt dies zum
Ausdruck durch die Art, wie die von den Opticusganglienzellen ausgehenden Nervenfasern sich zum Sehnerven
sammeln: bei Ammocoetes in der typischen Weise durch Bildung einer besonderen Schicht am
distalen Bande der Retina und gemeinsames Hinziehen nach der Richtung des Augenblasenstiels, bei Myxine
in der Weise, d u» jede Faser von ihrer Zelle aus gleichsam selbständig sich den nächsten Weg sucht
nach jener Sammelstelle zum Sehnerven.
Dass diese Erscheinung nicht durch Rückbildung erklärt werden kann, liegt auf der Hand. Es
wäre ja doch undenkbar, dass auf früheren Entwicklungsstufen die Nervenfasern bereits zü einer festen
Opticusfaserschicht vereinigt gewesen sein und dann später diese Anordnung aufgegeben haben sollten.
Wie dies auf den ersten Blick ja höchst auffällige Verhalten der Nervenfasern zu erklären ist,
wurde bei Besprechung der Retina gezeigt. Aussergewöhnlidlfc; ist es am Sehnerven von Myxme dann
weiterhin, wenn die Kreuzung seiner Fasern, die in anderen Augen schon im Gebiete der Retina erfolgt,
hier in vielen Fallen H f l edoch keineswegs immer B erst während j $ | Verlaufs des Nerven durch Pigmentepithel
und 8 olero-Chorioidea.su Stande kommt. Es muss diese Erscheinung m. E. auch wieder damit
erklärt werden, dass, infolge des Nachlasses in der Entwicklungsenergie, überhaupt eine gewisse Planlosigkeit
eingerissen istf die fernere Weiterbildung daher an einer Art von Verworrenheit leidet.
• Weiterhin zeigt die Anordnung des im extrabulbalen Opticus eingeschiossenen Bindegewebes eine
Verschiedenheit gegenüber dem Verhalten bei jenem jüngsten Ammocoetes insofern, als das Stütznetz,
das aus diesen Massen.: hervorgeht, bei- Myxine lange nicht dieselbe Regelmässigkeit der Anordnung zeigt.
Doch lässt sich auch .hier das Bestreben nicht verkennen, im extrabulbalen Opticus, wenigstens inf dessen
dem Auge noch genäherten Theilen, ein ähnliches Arrangement herzustellen, wie bei Ammocoetes-Petromyzon,
nur ist dasselbe nicht zur Vollendung gekommen. Dass es sich dabei n i c h t u m Rückbildung handeln kann,
zeigt gerade der unregelmässige Verlauf der einzelnen Bindegewebsfasern, die, quer durch die nervösen
Theile des Opticüs durchdringend, sich an die Pialseheide ansetzen. Wären in früherer Zeit diese Fasern,
wie- bei Petromyzon, streng senkreebt zür Längsaxe des Nervs verlaufen, so hätte sich eine Rückbildung
doch- nur in Form von Auflösung derselben äussern können, es wären also auf einer Stufe, wo die Ruckbildung
noch nicht vollendet war, grössere oder kleinere Lücken in dem System aufgetreten, und dessen
Regelmässigkeit so gestört gewesen. Nicht anzunehmen ist aber, dass der Rückbildungsprozess in der
Art gewirkt haben sollte, dass die Fasern ihren senkrechten Verlauf zu Gunsten eines unter allen möglichen
Winkeln zur Läugsaxe erfolgenden aufgegeben, dass die Füsschen, mit denen sie sich an die Pialseheide
» n a c h dem Beispiel von Petromyzon) angesetzt hatten, wieder verschwunden sein sollten H E b g le ie h die
Verbindung mit dieser. Opticushülle erhalten blieb. Ohne Schwierigkeit kann man sich dagegen vorsteüen,
dass das Stützsystem sich anfangs unregelmässig anlegte,; um erst im Verlaufe der Entwicklung seine regelmässige
Anordnung, zu gewinnen, dass die Fasern sich zunächst einfach an die Scheide ansetzten, um eist
allmählich jene dreieckigen Füsschen auszubilden Ä- ganz nach dem Muster von Petromyzon, j g ein Zustande
dessen Vollendung aber durch die Hemmung und bald folgende Sistirung der Entwicklung fürs
Myxineauge verhindert wurde.
Ferner finden sich im Opticus von Myxine zwischen den Nervenfasern da und dort zeitige Elemente,
die augenscheinlich im Zerfalle begriffen sind. Bei der Petromyzonlarve- von 6 cm Länge fehlt davon jede
Andeutung. Sind nun diese zerfallenden Zellen und Kerne Reste des alten Augenblasenstiels, was kaum
zweifelhaft sein kann, so geht aus der geschilderten Erscheinung abermals hervor, dass der Sehnerv von
Myxine auf einer tieferen Stufe steht, als derjenige jenes kleinsten Ammocoetes. Es ist klar, dass auch