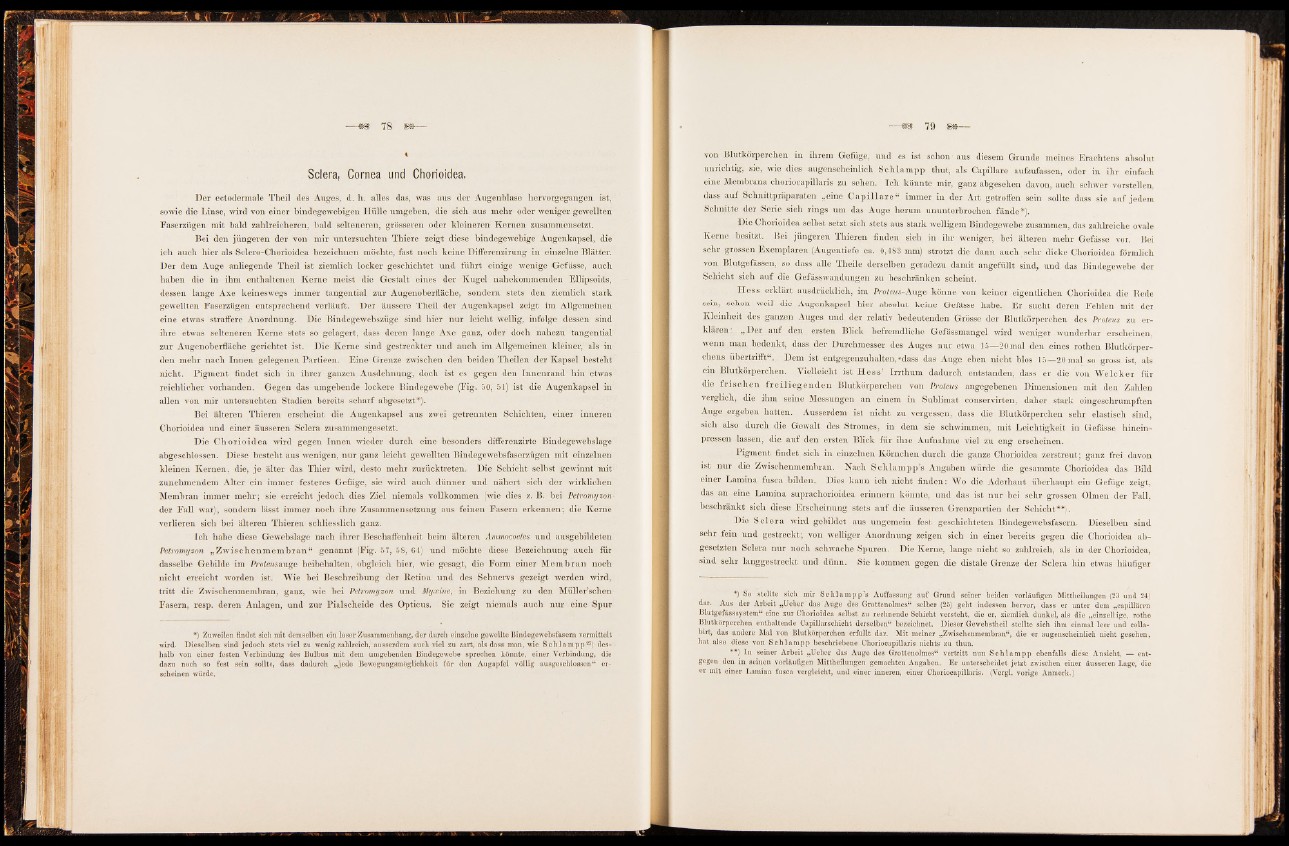
IH M
— « 3 78 Sa-—
Sclera, Cornea und Chorioidea.
Der ectodermale Theil des Auges, d. h. alles das, was aus der Augenblase hervorgegangen. ist,
sowie die Linse, wird von einer bindegewebigen Hülle umgeben, die sich aus mehr oder weniger gewellten
Faserzügen mit bald zahlreicheren, bald selteneren, grösseren oder kleineren Kernen zusammensetzt.
Bei den jüngeren der von mir untersuchten Thiere zeigt diese bindegewebige Augenkapsel, die
ich auch hier als Sclero-Chorioidea bezeichnen möchte, fast noch keine Differenzirung in einzelne Blätter.
Der dem Auge anliegende Theil ist ziemlich locker geschichtet und führt einige wenige Gefässe, auch
haben die in ihm enthaltenen Kerne meist die Gestalt eines der Kugel nahekommenden EllipsoidS,
dessen lange Axe keineswegs immer tangential zur Augenoberfläche, sondern stets den ziemlich stark
gewellten Faserzügen entsprechend verläuft. Der äussere Theil der Augenkapsel zeigt im Allgemeinen
eine etwas straffere Anordnung. Die Bindegewebszüge sind hier n u r leicht wellig, infolge dessen sind
ihre etwas selteneren Kerne stets so gelagert, dass deren lange Axe ganz, oder doch nahezu tangential
zur Augenoberfläche gerichtet ist. Die Kerne sind gestreckter un d auch im Allgemeinen kleiner, als in
den mehr nach Innen gelegenen Partieen. Eine Grenze zwischen den beiden Theilen der Kapsel besteht
nicht. Pigment findet sich in ihrer ganzen Ausdehnung, doch ist es gegen den Innenrand hin etwas
reichlicher vorhanden. Gegen das umgebende lockere Bindegewebe (Fig. 50, 51) ist die Augenkapsel in
allen von mir untersuchten Stadien bereits scharf abgesetzt*).
Bei älteren Thieren erscheint die Augenkapsel aus zwei getrennten Schichten, einer inneren
Chorioidea und einer äusseren Sclera zusammengesetzt.
Die C h o r io id e a wird gegen Innen wieder durch eine besonders differenzirte Bindegewebslage
abgeschlossen. Diese besteht aus wenigen, n u r ganz leicht gewellten Bindegewebsfaserzügen mit einzelnen
kleinen Kernen, die, je älter das Thier wird, desto mehr zurücktreten. Die Schicht selbst gewinnt mit
zunehmendem Alter ein immer festeres Gefüge, sie wird auch dünner und nähert sich der wirklichen
Membran immer mehr; sie erreicht jedoch dies Ziel niemals vollkommen (wie dies z. B. bei Petromyzon
der Fall war), sondern lässt immer noch ihre Zusammensetzung aus feinen Fasern erkennen; die Kerne
verlieren sich bei älteren Thieren schliesslich ganz.
Ich habe diese Gewebslage nach ihrer Beschaffenheit beim älteren Ammocoetes und ausgebildeten
Petromyzon „ Z w is c h e nm em b r a n “ genannt (Fig. 57, 58, 64) und möchte . diese Bezeichnung auch für
dasselbe Gebilde im Proteusauge beibehalten, obgleich hier, wie gesagt, die Form einer M em b r a n noch
n ich t erreicht worden ist. Wie bei Beschreibung der Retina u nd des Sehnervs gezeigt werden wird,
tritt die Zwischenmembran, ganz, wie bei Petromyzon und Myxine, in Beziehung zu den Müller’schen
Fasern, resp. deren Anlagen, und zur Pialscheide des Opticus. Sie zeigt niemals auch nur eine Spur
*) Zuweilen findet sich mit demselben ein loser Zusammenhang, der durch einzelne gewellte Bindegewebsfasern vermittelt
wird. Dieselben sind jedoch stets viel zu wenig zahlreich, ausserdem auch viel zu zart, als dass man, wie S c h l am p p 25) deshalb
von einer festen Verbindung des Bulbus mit dem umgebenden Bindegewebe sprechen könnte, einer Verbindung, die
dazu noch so fest sein sollte, dass dadurch „jede Bewegungsmöglichkeit für den Augapfel völlig ausgeschlossen“ erscheinen
würde.
von Blutkörperchen in ihrem Gefüge,' und es ist schon- aus diesem Grunde meines Erachtens absolut
unrichtig, sie, wie dies augenscheinlich S c h lam p p thut, als Oapillare aufzufassen, oder in ih r einfach
eine Membrana choriocapillaris zu sehen.' Ich könnte mir, ganz abgesehen davon, auch schwer vorstellen,
dass auf Schnittpräparaten „eine C a p i l l a r e “ immer in der Art getroffen sein sollte dass sie auf jedem
Schnitte der Serie sich rings um das Auge herum ununterbrochen fände*).
Die Chorioidea selbst setzt sich stets aus stark welligem Bindegewebe zusammen, das zahlreiche ovale
Kerne besitzt. Bei jüngeren Thieren finden sich in ihr weniger, bei älteren mehr Gefässe vor. Bei
sehr grossen Exemplaren (Augentiefe ca. 0,483 mm) strotzt die dann auch sehr dicke Chorioidea förmlich
von Blutgefässen, so dass alle Theiie derselben geradezu damit angefüllt sind, und das Bindegewebe der
Schicht sich auf die Gefässwandungen zu beschränken scheint.
H e s s erklärt ausdrücklich, im Proteus-Auge könne von keiner eigentlichen Chorioidea die Rede
sein, schon weil die Augenkapsel hier absolut keine Gefässe habe. Er sucht deren Fehlen mit der
Kleinheit des ganzen Auges und der relativ bedeutenden Grösse der Blutkörperchen des Proteus zu erklären:
„D e r auf den ersten Blick befremdliche Gefässmangel wird weniger wunderbar erscheinen,
wenn, man bedenkt, dass der Durchmesser des Auges nur etwa 15—20 mal den eines rothen Blutkörperchens
übertrifft“ . Dem ist entgegenzuhalten,»dass das Auge eben nicht blos 15—20 mal so gross ist, als
ein Blutkörperchen. Vielleicht ist H e s s ’ Irrth um dadurch entstanden, dass er die von W e lc k e r für
die f r i s c h e n f r e i l i e g e n d e n Blutkörperchen von Proteus angegebenen Dimensionen mit den Zahlen
veiglich, die ihm seine Messungen an einem in Sublimat conservirten, daher stark eingeschrumpften
Auge ergeben hatten. Ausserdem ist nicht zu vergessen, dass die Blutkörperchen sehr elastisch sind,
sich also durch die Gewalt des Stromes, in dem sie schwimmen, mit Leichtigkeit in Gefässe hineinpressen
lassen, die au f den ersten Blick für ihie Aufnahme viel zu eng erscheinen.
Pigment findet sich in einzelnen Körnchen durch die ganze Chorioidea z erstreut; ganz frei davon
ist n u r die Zwischenmembran. Nach S c h lam p p ’s Angaben würde die gesammte Chorioidea das Bild
einer Lamina fusca bilden. Dies kann ich nicht finden: Wo die Aderhaut überhaupt ein Gefüge zeigt,
das an eine Lamina suprachorioidea erinnern könnte, und das ist nur bei sehr grossen Olmen der Fall,
beschränkt sich diese Erscheinung stets auf die äusseren Grenzpartien der Schicht**).
Die S c l e r a wird gebildet aus ungemein fest geschichteten Bindegewebsfasern. Dieselben sind
sehr fein und gestreckt; von welliger Anordnung zeigen sich in einer bereits gegen die Chorioidea abgesetzten
Sclera n u r noch schwache Spuren. Die Kerne, lange nicht so zahlreich, als in der Chorioidea,
sind sehr langgestreckt und dünn. Sie kommen gegen die distale Grenze der Sclera hin etwas häufiger
*) So stellte sich mir S c h l am p p ’s Auffassung auf Grund seiner beiden vorläufigen Mittheilungen (23 und 24)
dar. Aus der Arbeit „Ueber das Auge des Grottenolmes“ selber (25) geht indessen hervor, dass er unter dem „capillären
Blutgefässsystem“ eine zur Chorioidea selbst zu rechnende Schicht versteht, die er, ziemlich dunkel, als die „einzell ige, rothe
Blutkörperchen enthaltende Capillarschicht derselben“ bezeichnet. Dieser Gewebstheil stellte sich ihm einmal leer und colla-
birt, das andere Mal von Blutkörperchen erfüllt dar. Mit meiner „Zwischenmembran“ , die er augenscheinlich nicht gesehen,
hat also diese von S c h l am p p beschriebene Choriocapillaris nichts zu thun.
**) In seiner Arbeit „Ueber das Auge des Grottenolmes“ vertritt nun S c h l am p p ebenfalls diese Ansicht, — entgegen
den in seinen vorläufigen Mittheilungen gemachten Angaben. E r unterscheidet jetz t zwischen einer äusseren Lage, die
er mit einer Lamina fusca vergleicht, und einer inneren, einer Choriocapillaris. (Vergl. vorige Anmerk.)