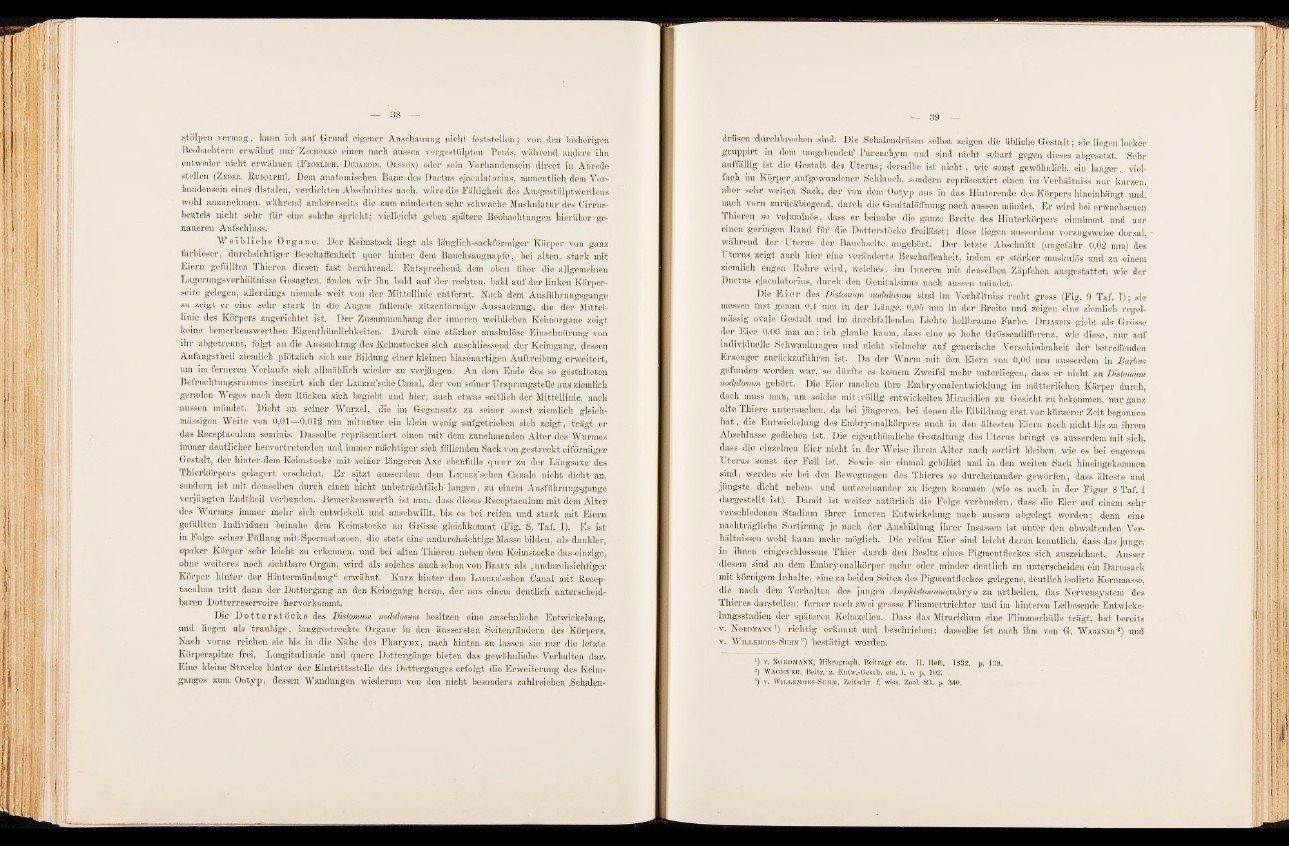
stülpen vermag, kann ich au f Grund eigener Anschauung nich t fe s tste lle n ; von den bisherigen
Beobachtern e rw äh n t n u r Z schokkc einen nach aussen vorgestülpten Penis, während andere ihn
. entweder nicht erwähnen ( F roelich, D ujardin, Olsson) oder sein Vorhandensein dire c t in Abrede
stellen (Z eder, R udolphi). Dem anatomischen Baue des Ductus ejaculatorius, namentlich dem Vorhandensein
eines distalen, verdickten A bschnittes nach, wäre die F äh ig k e it des Ausgestülptwerdens
wohl anzunehmen, während andererseits die zum mindesten sehr schwache Muskulatur des Cirrusbeutels
nich t sehr fü r eine solche sp rich t; vielleicht geben spätere Beobachtungen hierüber genaueren
Aufschluss.
W e i b l i c h e O r g a n e . D e r Keimstock lie g t als länglich-sackförmiger Körper von ganz
farbloser, durchsichtiger Beschaffenheit quer h in te r dem Bauchsaugnapfe, bei alten, s ta rk mit
E iern gefüllten Thieren diesen fa s t berührend. Entsprechend dem oben über die allgemeinen
Lagerungsverhältnisse Gesagten, finden w ir ihn bald au f der rechten, bald a u f d er linken Körpe rseite
gelegen, allerdings niemals w e it von der Mittellinie entfernt. Nach dem Ausführungsgauge
zu zeigt e r eine sehr s ta rk in die Augen fallende zitzenförmige Aussackung, die der Mittellinie
des Körpers zugerichtet ist. D e r Zusammenhang der inneren weiblichen Keimorgane zeigt
keine bemerkenswerthen Eig en tüm lich k e ite n . Durch eine s tä rk e r muskulöse Einschnürung von
ih r abgetrennt, folgt an die Aussackung des Keimstockes sich anschliessend der Keimgang, dessen
Anfangstheil ziemlich plötzlich sich z u r Bildung einer kleinen blasenartigen Auftreibung erweitert,
um im ferneren Verlaufe sich allmählich wieder zu verjüngen. A n dem Ende des so gestalteten
Befruchtungsraumes in s e r irt sich der L aurer’sehe Canal, der von seiner Ursprungstelle aus ziemlich
geraden Weges nach dem Rücken sich begiebt und hier, auch etwas seitlich der Mittellinie, nach
aussen mündet. Dicht an seiner Wurzel, die im Gegensatz zu seiner sonst ziemlich gleich-
mässigen W eite von 0,01—0,012 mm m itu n te r ein klein wenig aufgetrieben sich z e ig t, tr ä g t er
das Receptaculum seminis. Dasselbe re p rä s en tie rt einen mit dem zunehmenden A lte r des Wurmes
immer deutlicher h ervortretenden und immer mächtiger sich füllenden Sack von g e strec k t eiförmiger
Gestalt, der h in te r dem Keimstocke mit seiner längeren Axe ebenfalls q u e r zu der Längsaxe des
Thierkörpers g elagert erscheint. E r s itz t ausserdem dem LAURER’schen Canale nicht dicht an,
sondern is t mit demselben durch einen nich t unbeträchtlich langen, zu einem Ausführungsgange
verjüngten Endtheil verbunden. Bemerkenswerth is t nun, dass dieses Receptaculum mit dem A lte r
des Wurmes immer mehr sich entwickelt und anschwillt, bis es bei reifen und s ta rk mit Eiern
gefüllten Individuen beinahe dem Keimstocke an Grösse gleichkommt (Fig. 8 , Taf. I). E s is t
in Folge seiner Füllung mit Spermatozoen, die s te ts eine undurchsichtige Masse bilden, als dunkler,
opaker Körper s eh r leicht zu erkennen, und bei a lten Thieren neben dem Keimstocke das einzige,
ohne weiteres noch sichtbare Organ, w ird als solches auch schon von B raun als „undurchsichtiger
Körper h in te r der Hintermündung“ erwähnt. K u rz h in te r dem LAURER’schen Canal m it Receptaculum
t r i t t dann der Dotte rg an g an den Keimgang heran, der aus einem deutlich unterscheidbaren
Dotte rre servoire hervorkommt.
Die D o t t e r s t ö c k e des Distomum nodulosum besitzen eine ansehnliche Entwickelung,
und liegen als tra u b ig e , langgestreckte Organe in den äussersten Seitenrändern des Körpers.
Nach vorne reichen sie bis in die Nähe des P h a ry n x , nach hinten zu lassen sie n u r die letzte
Körperspitze frei. Longitudinale und quere Dottergänge bieten das gewöhnliche Verhalten dar.
Eine kleine Strecke h in te r der E in tritts ste lle des Dotterganges erfolgt die E rw eiteru n g des Keimganges
zum O o ty p , dessen Wandungen wiederum von den n ich t besonders zahlreichen Schalendrüsen
durchbrochen sind. Die Schalendrüsen selbst zeigen die übliche G e s ta lt; sie liegen locker
g ru p p irt in dem umgebenden' Parenchym und sind nicht scharf gegen dieses abgesetzt. Sehr
auffällig is t die G e sta lt des U te ru s ; derselbe is t n ic h t, wie sonst gewöhnlich, ein la n g e r, vielfach
im Körpe r aufgewundener Schlauch, sondern re p rä s e n tirt einen im Verhältniss n u r kurzen,
aber sehr weiten Sack, der von dem Ootyp aus in das Hinterende des Körpers hineinhängt und,
nach vorn zurückbiegend, durch die Genitalöffnung nach aussen mündet. E r wird bei erwachsenen
Thieren so voluminös, dass e r beinahe die ganze B re ite des Hinterkörpers einnimmt und nur
einen geringen Rand fü r die Dotterstöcke freilässt; diese liegen ausserdem vorzugsweise dorsal,
während der Uterus der Bauchseite angehört. Der le tz te Abschnitt (ungefähr 0,02 mm) des
Uterus zeigt auch h ie r eine v e ränderte Beschaffenheit, indem e r s tä rk e r muskulös und zu einem
ziemlich engen Rohre w ird , welches, im Inneren mit denselben Zäpfchen a u sge stattet, wie der
Ductus ejaculatorius, durch den Genitalsinus nach aussen mündet.
Die E i e r des Distomum nodulosum sind im Verhältniss re ch t gross (Fig. 9 Taf. I ) ; sie
messen fa s t genau 0,1 mm in der Länge, 0,05 mm in der Bre ite und zeigen eine ziemlich regelmässig
ovale Ge sta lt und im durchfallenden Lichte hellbraune Farbe. D ujardin giebt als Grösse
der E ie r 0,06 mm an ; ich glaube kaum, dass eine so hohe Grössendifferenz, wie diese, n u r auf
individuelle Schwankungen und n ich t vielmehr au f generische Verschiedenheit der betreffenden
Erzeuger zurückzuführen ist. Da der Wurm mit den Eiern von 0,06 mm ausserdem in Darbus
gefunden worden war, so d ü rfte es keinem Zweifel mehr unterliegen, dass er nicht zu Distomum
nodulosum gehört. Die E ie r machen ih re Embryonalentwicklung im mütterlichen Körper durch,
doch muss man, um solche mit ^völlig entwickelten Miracidien zu Gesicht zu bekommen, n u r ganz
a lte Thiere untersuchen, da bei jüngeren, bei denen die Eibildung e rs t vor k ü rz e re r Z e it begonnen,
h a t , die Entwickelung des Embryonalkörpers auch in den ältesten Eiern noch nicht bis zu ihrem
Abschlüsse gediehen ist. Die eigenthümliche Gestaltung des Uterus bringt, es ausserdem mit sich,
dass die einzelnen E ie r n ich t in der Weise ihrem A lte r nach s o r tir t bleiben, wie es bei engerem
U te ru s sonst der F a ll ist. Sowie sie einmal gebildet und in den weiten Sack hineingekommen
sind, werden sie bei den Bewegungen des Thieres so durcheinander geworfen, dass ä lte ste und
jüngste dicht neben- und untereinander zu liegen kommen (wie es- auch in der F ig u r 8 Taf. I
d a rg e ste llt ist). Damit is t weiter n a tü rlich die Folge verbunden, dass die E ier au f einem sehr
verschiedenen Stadium ih re r inneren Entwickelung nach aussen abgelegt werden; denn eine
nachträgliche S o rtiru n g je nach der Ausbildung ih re r Insassen is t u n te r den obwaltenden Verhältnissen
wohl kaum mehr möglich.' Die reifen E ie r sind leicht d a ran kenntlich, dass das junge,
in ihnen eingeschlossene Thier durch den Besitz eines Pigraentfleckes sich auszeichnet. Ausser
diesem sind au dem Embryonalkörper mehr oder minder deutlich zu unterscheiden ein Darmsack
mit körnigem In h a lte , eine zu beiden S eiten des Pigmentfieckes gelegene, deutlich isolirte Kernmasse,
die nach dem Verhalten des jungen AmphistomumembTyo zu urtheilen, das Nervensystem des
Thieres darstellen; fe rn e r noch zwei grosse Flim m ertrich te r und im hinteren Leibesende Entwickelungsstadien
der späteren Keimzellen. Dass das Miracidium eine Flimmerhülle tr ä g t, h a t bereits
v. N ordmann1) rich tig e rk an n t und beschrieben; dasselbe is t nach ihm von G. W agener2) und
v. W illemoes-S uhm3) be stä tig t worden.
*) v. Nordmann, Mikrograph. Beiträge etc. II. Heft. 1832. p. 139.
2) W A G E N E R , Bei tr. z. Entw.-Goscli. etc. 1. c. p. 102,
3) v. W i l l e m o e s - S u h m , Zeitsclir. f. wiss. Zool. 23. p. 340.