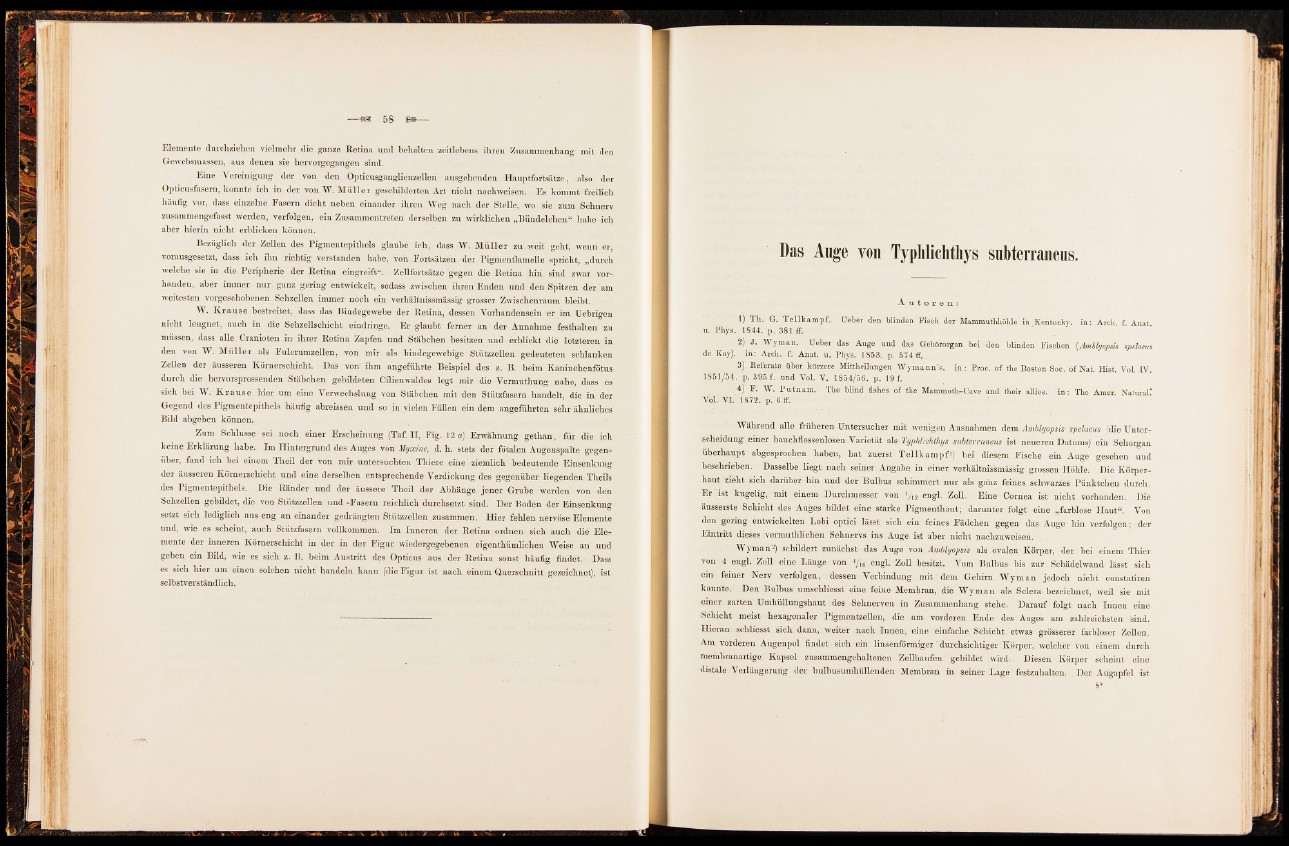
— m 58 m —
Elemente durchziehen vielmehr die ganze Retina und behalten zeitlebens ihren Zusammenhang mit den
Gewebsmassen, aus denen sie hervorgegangen sind.
Eine Vereinigung der von den Opticusganglienzellen ausgehenden Hauptfortsätze, also der
Opticusfasern, konnte ich in der von W. M ü lle r geschilderten Art nicht nachweisen. Es kommt freilich
häufig vor, dass einzelne Fasern dicht neben einander ihren Weg nach, der Stelle, wo sie zum Séhnerv
zusammengefasst werden, verfolgen, ein Zusammentreten derselben zu wirklichen „Bündelchen“ habe ich
aber hierin nicht erblicken können.
Bezüglich der Zellen des Pigmentepithels glaube ich, dass W. M ü lle r zu weit geht, wenn er,
vorausgesetzt, dass ich ihn richtig verstanden habe, von Fortsätzen der Pigmentlamelle spricht, „durch
welche sie in die Peripherie der Retina eingreift“. Zellfortsätze gegen die Retina hin. sind zwar vorhanden,
aber immer nur ganz gering entwickelt, sodass zwischen ihren Enden und den Spitzen der !ain
weitesten vorgeschobenen Sehzellen immer noch ein verhältnissmässig grösser Zwischenraum bleibt.
W. K r a u s e bestreitet, dass das Bindegewebe der Retina, dessen Vorhandensein er im Uebrigén
nicht leugnet, auch in die Sehzellschicht eindringe. Er glaubt ferner an der Annahme festhalten zu
müssen, dass alle Cranioten in ihrer Retina Zapfen und Stäbchen besitzen und érblickt die letzteren in
den von W. M ü lle r als Fulcrumzellen, von mir als bindegewebige Stützzellen gedeuteten schlanken
Zellen der äusseren Körnerschicht. Das von ihm angeführte Beispiel des z. B. beim Kaninchenfötus
durch die hervorsprossenden Stäbchen gebildeten Cilienwaldes legt mir die Vermuthung nahe, dass es
sich bei W. K r a u s e hier um eine Verwechslung von Stäbchen mit den Stützfasern handelt, die in der
Gegend des Pigmentepithels häufig abreissen und so in vielen Fällen ein dem angeführten sehr ähnliches
Bild abgeben können.
Zum Schlüsse sei noch einer Erscheinung (Taf. H, Fig. 12 a) Erwähnung gethan, für die ich
keine Erklärung habe. Im Hintergrund des Auges von Myxine, d. h. stets der fötalen Augenspalte gegenüber,
fand ich bei einem Theil der von mir untersuchten Thiere eine ziemlich bedeutende Einsenkung
der äusseren Körnerschicht und eine derselben entsprechende Verdickung des gegenüber liegenden Theils
des Pigmentepithels. Die Ränder und der äussere Theil der Abhänge jener Grube werden von den
Sehzellen gebildet, die von Stützzellen und -Fasern reichlich durchsetzt sind. Der Boden der Einsenkung
setzt sich lediglich aus eng an einander gedrängten Stützzellen zusammen. H ie r fehlen nervöse Elemente
und, wie es scheint, auch Stützfasem vollkommen. Im Inneren der Retina ordnen sich auch die Eier
mente der inneren Körnerschicht in der in der Figur wiedergegebenen eigenthümlicben Weise an und
geben ein Bild, wie es sich z. B. beim Austritt des Opticus aus der Retina sonst häufig findet. Dass
es sich hier um einen solchen nicht handeln kann (die F igur ist nach einem Querschnitt gezeichnet), ist
selbstverständlich.
Das Auge von Typhlichthys subterraneus.
A u t o r e n :
f) ;Th. G. Tellkampf. Ueber'den'blinden Fisch der Mammuthliöhle in Kentucky, in: Arch. f. Anat
r.. I’hvs. (844. p. 381 ff.
2) I .'W ym a n . Ueber das Auge und das Gehörorgan bei den blinden Fischen (Amblyopsis spelaeua
de Kay):; in: Arch. f. Anat. u. Phys. 1833. p. 574 ff.
%w41iReierate ül)er iarzere Mittheilungen W ym an n ’s. in : l’roc. of the Boston Soc. of Nat. Hist. Vol. IV.
1851/54. p. 395 f. und Vol. V. 1854/56. p. 19 f.
4) F. W. P utnam. The blind ffshes of :the Mammoth-CaVe and their allies. in : The Amer Natural'
Vol.'VI, 1.8r72. p. 6 ff.
Während alle früheren Untersucher mit wenigen Ausnahmen dem Amblyopsis-, spekieus (die Unterscheidung
einer bauchflossenlosen Varietät als Typhlichthys sübterraheiis is t neueren Datums) ein Sehorgan
überhaupt abgesprochen haben, hat zuerst T e llk am p f ') bei diesem Fische ein Auge gesehen und
beschrieben. Dasselbe liegt nach: seiner A b g a b e - e i n e r verhältnissmässig grossen Höhle; Die Körperhaut
zieht sich darüber hin und der Bulbus schimmert n u r als ganz feines schwarzes Pünktchen durch.
E r ist kugelig, mit einem Durchmesser von i/f, engl. Zoll. Eine Cornea ist n ich t' vorhanden. Die
äusserste Schicht des Auges bildet eine starke Pigmenthaut; darunter folgt eine „farblose Haut“ . Von
den gering entwickelten Lobi optici lässt sich ein feines Fädchen gegen das Auge hin verfolgen; der
Eintritt dieses .vermuthlichen Sehnervs ins Auge ist aber nicht nächzuweisen.
W ym a n 2). schildert zunächst das Auge von Amblyopsis als ovalen Körper, der bei einem Thier
von 4 engl. Zoll eine Länge von l/ie engl. Zoll besitzt. Vom Bulbus bis zur Schädelwand lässt sich
ein feiner Nerv verfolgen, .dessen Verbindung mit dem Gehirn W ym a n jedoch nicht constati’ren
konnte. Den Bulbus umschliesst eine feine Membran, die W ym a n als Sclera bezeichnet, weil sie mit
einer zarten Umhüllungshaut. des Sehnerven in Zusammenhang stehe. Da rauf folgt nach Innen eine
Schicht meist hexagonaler Pigmentzellen, die am vorderen Ende des. Auges am zahlreichsten sind.
-Hieran schliesst sich dann, weiter hach Innen, eine einfache Schicht etwas grösserer" farbloser Zellen.
Am vorderen Augenpol findet' sich ein linsenförmiger' durchsichtiger Körper, welcher von einem durch
meinbranartige' Kapsel zusammengehaltenen Zellhaufen gebildet wird. Diesen Körper scheint .eine
distale Verlängerung der bulbusumhüllenden Membran in seiner Lage ‘ festzuhalten. Der Augapfel ist
8*