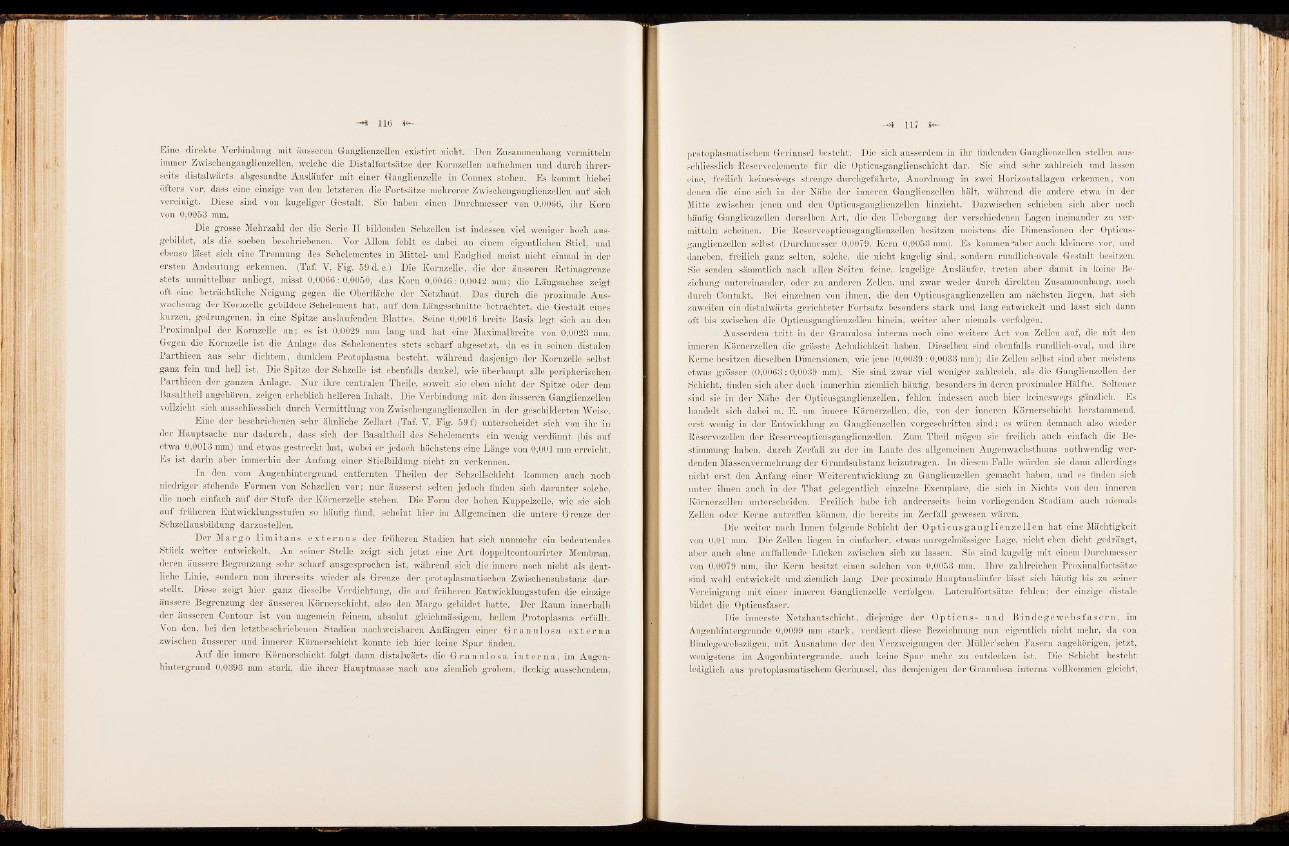
Eine direkte Verbindung mit äusseren Ganglienzellen e x istirt nicht. Den Zusammenhang vermitteln
immer Zwischenganglienzellen, welche die Distalfo rtsä tze der Kornzellen aufnehmen und durch ih re rseits
dis ta lw ärts abgesandte Ausläufer mit einer Ganglienzelle in Connex stehen. Es kommt hiebei
öfters vor, dass eine einzige von den le tz teren die F o rtsä tz e mehrerer Zwischenganglienzellen a u f sich
vereinigt. Diese sind von kugeliger Gestalt. Sie haben einen Durchmesser von 0,0066, ih r Kern
von 0,0053 mm.
Die grosse Mehrzahl der die Serie I I bildenden Sehzellen is t indessen viel weniger hoch ausgebildet,
als die soeben beschriebenen. Vor Allem fe h lt es dabei an einem eigentlichen Stiel, und
ebenso lä s s t sich eine Trennung des Sehelementes in Mittel- und Endglied meist n ich t einmal in der
ers ten Andeutung erkennen. (Taf. V, Fig. 59 d, e.) Die Kornzelle, die der äusseren Betinagrenze
s te ts unmittelbar anliegt, misst 0,0066:0,0050, das Korn 0,0046:0,0042 mm; die Längsachse zeigt
oft eine beträchtliche Neigung gegen die Oberfläche der Netzhaut. Das durch die proximale Aiis-
wachsung der Kornzelle gebildete Sehelement ha t, au f dem Längsschnitte b e tra ch tet, die Ge sta lt eines
kurzen, gedrungenen, in eine Spitze auslaufenden Blattes. Seine 0,0016 breite Basis leg t sich an den
Proximalpol der Kornzelle an ; es is t 0,0029 mm lang und h a t eine Maximalbreite von 0,0023 mm.
Gegen die Kornzelle is t die Anlage des Sehelementes s te ts sch a rf abgesetzt, da es in seinen distalen
P a rth iee n aus seh r dichtem, dunklem Protoplasma besteht, während dasjenige der Kornzelle selbst
ganz fein und hell ist. Die Spitze der Sehzelle is t ebenfalls dunkel, wie überhaupt alle peripherischen
P a rth ie e n der ganzen Anlage. N u r ih re c entra len; Theile, soweit sie eben n ich t der Spitze oder dem
Basaltheil angehören, zeigen erheblich helleren In h a lt. Die Verbindung mit den äusseren Ganglienzellen
vollzieht sich ausschliesslich durch Vermittlung von Zwischenganglienzellen in der geschilderten Weise.
Eine der beschriebenen sehr ähnliche Z e lla rt (Taf. V, Fig. 59 f) unterscheidet sich von ih r in
der Hauptsache n u r dadurch, dass sich der Basaltheil des Sehelements ein wenig ve rdünnt (bis auf
etwa 0,0013 mm) und etwas g e streck t h a t, wobei e r jedoch höchstens eine Länge von 0,001 mm erreicht.
Es is t d a rin aber immerhin der Anfang einer Stielbildung n ich t zu verkennen.
In den vom Augenhintergrund entfernten Theilen der Sehzellschicht kommen auch noch
niedriger stehende Formen von Sehzellen vor ; n u r äusserst selten jedoch finden sich d a ru n te r solche,
die noch einfach au f der Stufe der Körnerzelle stehen. Die Form der hohen Kuppelzelle, wie sie sich
au f früheren Entwicklungsstufen so häufig fand, scheint h ie r im Allgemeinen die un te re Grenze der
Sehzellausbildung darzustellen.
D e r M a r g o l im i t a n s e x t e r n u s der früheren Stadien h a t sich nunmehr ein bedeutendes
Stück w e ite r entwickelt. An seiner Stelle zeigt sich je tz t eine A r t doppeltcontourirter Membran,
deren äussere Begrenzung sehr sch a rf ausgesprochen ist, während sich die innere noch nich t als deutliche
Linie, sondern nun ihre rse its wieder als Grenze der protoplasmatischen Zwischensubstanz d a rstellt.
Diese zeigt h ie r ganz dieselbe Verdichtung, die au f früheren Entwicklungsstufen die einzige
äussere Begrenzung der äusseren Körnerschicht, also den Margo gebildet h a tte . Der Baum innerhalb
der äusseren Contour is t von ungemein feinem, absolut gleichmässigem, hellem Protoplasma erfüllt.
Von den, bei den letztbeschriebenen Stadien nachweisbaren Anfängen einer G r a n u l o s a e x t e r n a
zwischen äusserer und innerer Körnerschicht konnte ich h ie r keine S pur finden.
A u f die innere Körnerschicht folgt dann d ista lw ärts G r a n u l o s a i n t e r n a , im Augenhin
te rg ru n d 0,0393 mm s ta rk , die ih re r Hauptmasse'nach aus ziemlich grobem, fleckig aussehendem,
protoplasmatischem Gerinnsel besteht. Die sich ausser dem in ih r findenden Ganglienzellen stellen ausschliesslich
Beserveelemente fü r die Opticusganglienschicht dar. Sie sind sehr zahlreich und lassen
eine, freilich keineswegs strenge durchgeführte, Anordnung in zwei Horizontallagen erkennen, von
denen die eine sich in der Nähe der inneren Ganglienzellen hält, während die andere etwa in der
Mitte zwischen jenen und den Opticusgänglienzellen hinzieht. Dazwischen schieben sich aber noch
häufig Ganglienzellen derselben A rt, die den Uebergang der verschiedenen Lagen ineinander zu v e rmitteln
scheinen. Die Beserveopticusganglienzellen besitzen meistens die Dimensionen der Opticusganglienzellen
selbst (Durchmesser 0,0079, Kern 0,0053 mm). E s, kommen "aber auch kleinere vor, und
daneben, fre ilic h . ganz selten, solche, die n ich t kugelig sind, sondern rundlich-ovale Ge sta lt besitzen.
Sie senden sämmtlich nach allen Seiten feine, kugelige Ausläufer, tre te n aber damit in keine Beziehung
untereinander, oder zu anderen Zellen, und zwar weder durch direkten Zusammenhang, noch
durch Contakt. Bei einzelnen von ihnen, die den Opticusganglienzellen am nächsten liegen, h a t sich
zuweilen ein d ista lw ärts ge rich te ter F o rts a tz besonders s ta rk und lang entwickelt und lä sst sich dann
oft bis zwischen die Opticusganglienzellen hinein, weiter aber niemals verfolgen.
Ausserdem t r i t t in der Granulosa in te rn a noch eine weitere A r t von Zellen auf, die mit den
inneren Körnerzellen die grösste Aehnlichkeit haben. Dieselben sind ebenfalls rundlich-oval, und ihre
Kerne besitzen dieselben Dimensionen, wie jene (0,0039 : 0,0033 mm); die Zellen selbst sind aber meistens
etwas grösser (0,0063: 0,0039 mm). Sie sind zwar viel weniger zahlreich, als die Ganglienzellen der
Schicht, finden sich aber doch immerhin ziemlich häufig, besonders in deren proximaler Hälfte. Seltener
sind sie in der Nähe der Opticusganglienzellen, fehlen indessen auch h ie r keineswegs gänzlich. Es
handelt sich dabei m. E. um innere Körnerzellen, die, von der inneren Körnerschicht herstammend,
e rs t wenig in der Entwicklung zu Ganglienzellen vorgeschritten s in d : es wären demnach also wieder
Beservezellen der Beserveopticusganglienzellen. Zum Theil mögen sie freilich auch einfach die Bestimmung
haben, durch Zerfall zu der im Laufe des allgemeinen Augenwachsthums nothwendig werdenden
Massen Vermehrung der Grundsubstanz beizutragen. In diesem Fa lle würden sie dann allerdings
n icht e rs t den Anfang einer Weiterentwicklung zu Ganglienzellen gemacht haben, und es finden sich
u n te r ihnen auch in der T h a t gelegentlich einzelne Exemplare, die sich in Nichts von den inneren
Körnerzellen unterscheiden. F reilich habe ich andrerseits beim vorliegenden Stadium auch niemals
Zellen oder Kerne antreffen können, die bereits im Zerfall gewesen wären.
Die weiter nach Innen folgende Schicht der O p t i c u s g a n g l i e n z e l l e n h a t eine Mächtigkeit
von 0,01 mm. Die Zellen liegen in einfacher, etwas unregelmässiger Lage, n ich t eben dicht gedrängt,
aber auch ohne auffallende Lücken zwischen sich zu lassen. Sie sind kugelig mit einem Durchmesser
von 0,0079 mm, ih r K e rn besitzt einen solchen von 0,0053 mm. Ih re zahlreichen Proximalfortsätze
sind wohl entwickelt und ziemlich lang. D e r proximale Hauptausläufer lä ss t sich häufig bis zu seiner
Vereinigung mit einer inneren Ganglienzelle verfolgen. L a te ra lfo rtsä tz e fehlen; der einzige distale
bildet die Opticusfaser.
Die innerste N etzhautschicht, diejenige der O p t i c u s - u n d B i n d e g e w e b s f a s e r n , im
Augenhintergrunde 0,0099 mm s ta r k , verdient diese Bezeichnung nun eigentlich nicht mehr, da von
Bindegewebsziigen, mit Ausnahme der den Verzweigungen der Miiller’schen Fasern angehörigen, jetzt,
wenigstens im Augenhintergrunde, auch keine Spur mehr zu entdecken ist. Die Schicht besteht
lediglich aus protoplasmatischem Gerinnsel, das demjenigen der Granulosa inte rna vollkommen gleicht,