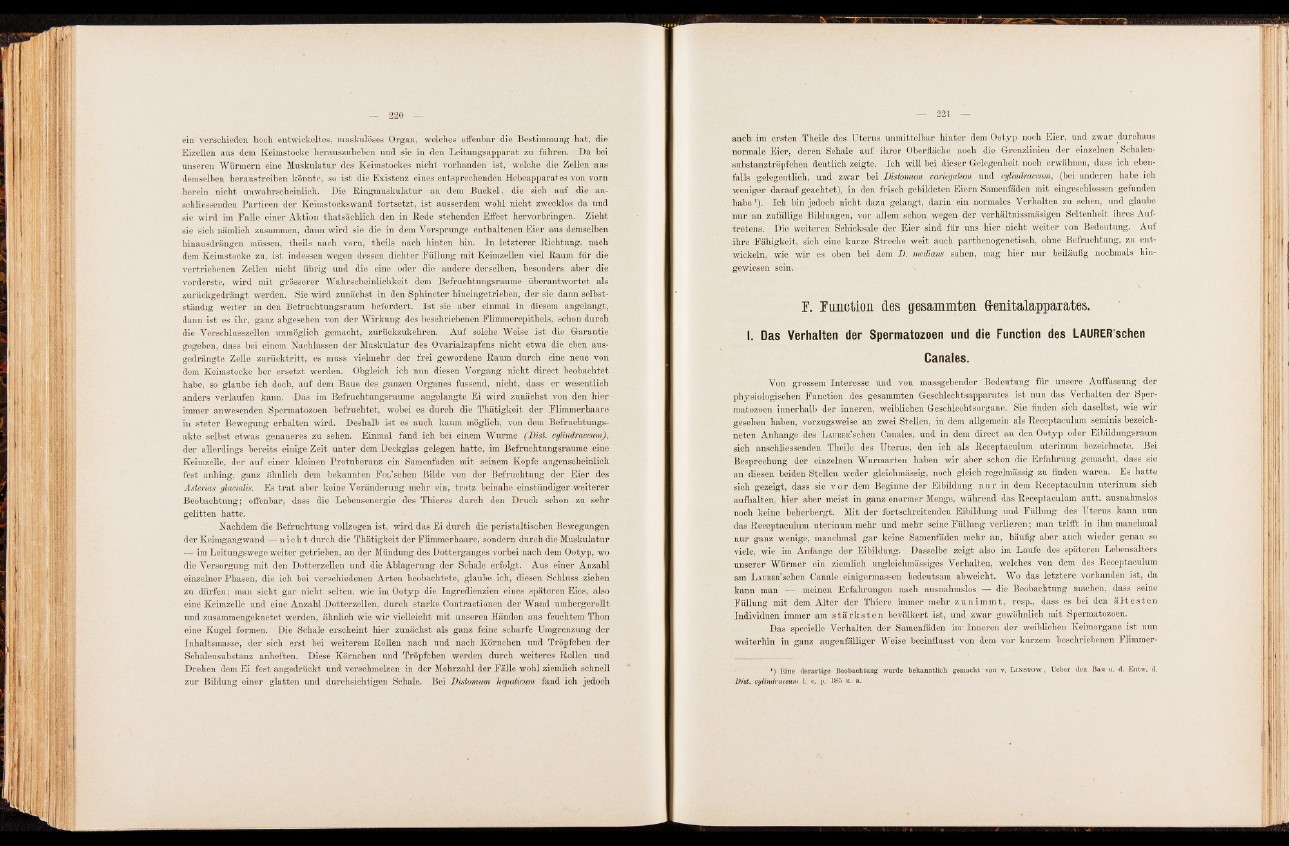
ein verschieden hoch entwickeltes, muskulöses Organ, welches offenbar die Bestimmung h a t, die
Eizellen aus dem Keimstocke herauszuheben und sie in den L e itungsapparat zu führen. Da bei
unseren Würmern eine Muskulatur des Keimstockes nich t vorhanden ist, welche die Zellen aus
demselben heraustreiben könnte, so is t die Existenz eines entsprechenden Hebeapparates von vorn
herein n ich t unwahrscheinlich. Die Kingmuskulatur an dem Buckel, die sich au f die anschliessenden
P artieen der Keimstockswand fo rtse tz t, is t ausserdem wohl nich t zwecklos da und
sie wird im F a lle einer Aktion thatsächlich den in Rede stehenden Effect hervorbringen. Zieht
sie sich nämlich zusammen, dann w ird sie die in dem Vorsprunge enthaltenen E ier aus demselben
hinausdrängen müssen, theils nach vorn, theils nach hinten hin. In le tz te re r Richtung, nach
dem Keimstocke zu, is t indessen wegen dessen dichter Füllung mit Keimzellen viel Raum fü r die
vertriebenen Zellen n ich t übrig und die eine oder die andere derselben, besonders aber die
vorderste, w ird mit grösse re r Wahrscheinlichkeit dem Befruchtungsraume ü b e ra n tw o rte t als
zurückgedrängt werden. Sie wird zunächst in den Sphincter hineingetrieben, der sie dann selbstständig
weiter in den Befruchtungsraum befördert. I s t sie aber einmal in diesem angelangt,
dann is t es ih r, ganz abgesehen von der W irk u n g des beschriebenen Flimmerepithels, schon durch
die Verschlusszellen unmöglich gemacht, zurückzukehren. A u f solche Weise is t die Garantie
gegeben, dass bei einem Nachlassen der Muskulatur des Ovarialzapfens nich t etwa die eben ausgedrängte
Zelle z u rü c k tritt, es muss vielmehr .der frei gewordene Raum durch eine neue von
dem Keimstocke h e r e rse tz t werden. Obgleich ich nun diesen Vorgang nich t dire c t beobachtet
habe, so glaube ich doch, a u f dem Baue des ganzen Organes fussend, nicht, dass e r wesentlich
anders verlaufen kann. Das im Befruchtungsraume angelangte E i w ird zunächst von den h ie r
immer anwesenden Spermatozoen befruchtet, wobei es durch die T h ä tig k e it der Flimmerhaare
in s te te r Bewegung e rhalten wird. Deshalb is t es auch kaum möglich, von dem Befruchtungsa
k te selbst etwas genaueres zu sehen. Einmal fand ich bei einem Wurme (Bist, cylindrciceum),
der allerdings bereits einige Z e it u n te r dem Deckglas gelegen h a tte , im Befruchtungsraume eine
Keimzelle, der a u f einer kleinen P ro tuberanz ein Samenfaden mit seinem Kopfe augenscheinlich
fest anhing, ganz ähnlich dem bekannten F ol’sehen Bilde von der Befruchtung der E ier des
Asterias glaäalis. Es t r a t aber keine Veränderung mehr ein, tro tz beinahe einstündiger w e ite re r
Beobachtung; offenbar, dass die Lebensenergie des Thieres durch den Druck schon zu sehr
g e litten h a tte .
Nachdem die Befruchtung vollzogen ist, w ird das Ei durch die peristaltischen Bewegungen
der K eimgangwand — n i c h t durch die Th ä tig k e it d er Flimmerhaare, sondern durch die M uskulatur
— im Leitungswege weiter getrieben, an der Mündung des D otterganges vorbei nach dem Ootyp, wo
die Versorgung m it den Dotterzellen und die Ablagerung der Schale e rfo lg t/ Aus einer Anzahl
einzelner Phasen, die ich bei verschiedenen A rten beobachtete, glaube ich, diesen Schluss ziehen
zu d ü rfen ; man sieht g a r nicht selten, wie. im Ootyp die Ingredienzien eines späteren Eies, also
eine Keimzelle und eine Anzahl Dotterzellen, durch s ta rk e Contractionen der Wand umhergerollt
und zusammengeknetet werden, ähnlich wie w ir vielleicht mit unseren Händen' aus feuchtem Thon
eine Kugel formen. Die Schale e rsch e in t. h ie r zunächst als ganz feine scharfe Umgrenzung der
Inhaltsmasse, der sich e rs t bei weiterem Rollen nach und nach Körnchen und Tröpfchen der
Schalensubstänz anheften. Diese Körnchen und Tröpfchen werden durch weiteres Rollen und
Drehen dem Ei fe st angedrückt und verschmelzen in der Mehrzahl der F ä lle wohl ziemlich schnell
zu r Bildung einer g la tten und durchsichtigen Schale. Bei Distomum hepaticum fand ich jedoch
auch im ersten Theile des Uterus unmittelbar h in te r dem Ootyp noch Eier, und zwar durchaus
normale Eier, deren Schale au f ih re r Oberfläche noch die Grenzlinien der einzelnen Schalensubstanztröpfchen
deutlich zeigte. Ich will bei dieser Gelegenheit noch erwähnen, dass ich ebenfalls
gelegentlich, und zwar bei Distomum variegatum und cylindraccum, (bei anderen habe ich
weniger d a ra u f g eachtet), in den frisch gebildeten Eiern Samenfäden mit eingeschlossen gefunden
habe *). Ic h bin jedoch nicht dazu gelangt, d a rin ein normales Verhalten zu sehen, und glaube
n u r an zufällige Bildungen, vor allem schon wegen der verhältnissmäsigen Seltenheit ihres Auftre
tens. Die weiteren Schicksale der E ie r sind fü r uns h ie r nich t weiter von Bedeutung. Auf
ih re Fähigkeit, sich eine kurze Strecke weit auch parthenogenetisch, ohne Befruchtung, zu entwickeln,
wie w ir es oben bei dem D. medians sahen, mag h ie r n u r beiläufig nochmals hingewiesen
sein.
F. Function des gesammten G-enitalapparates.
I. Das Verhalten der Spermatozoen und die Function des LAURER’schen
Canales.
Von grossem Interesse und von massgebender Bedeutung fü r unsere Auffassung der
physiologischen Function des gesammten Geschlechtsapparates is t nun das Verhalten der Spermatozoen
innerhalb der inneren, weiblichen Geschlechtsorgane. Sie finden sich daselbst, wie wir
gesehen haben, vorzugsweise an zwei Stellen, in dem allgemein als Receptaculum seminis bezeich-
neten Anhänge des L aurer’sehen Canales, und in dem direct an den Ootyp oder Eibildungsraum
sich anschliessenden Theile des Uterus, den ich als Receptaculum uterinum bezeichnete. Bei
Besprechung der einzelnen W u rm a rten haben w ir aber schon die Erfah ru n g gemacht, dass sie
an diesen beiden Stellen weder gleichmässig, noch gleich regelmässig zu finden waren. Es h a tte
sich gezeigt, dass sie v o r dem Beginne der Eibildung n u r in dem Receptaculum uterinum sich
aufhalten, h ie r aber meist in ganz enormer Menge, während das Receptaculum a u tt. ausnahmslos
noch keine beherbergt. Mit der fortschreitenden Eibildung und Füllung des Uterus kann nun
das Receptaculum uterinum mehr und mehr seine Füllung v e rlie re n ; man trifft in ihm manchmal
n u r ganz wenige, manchmal g a r keine Samenfäden mehr an, häufig aber auch wieder genau so
viele, wie im Anfänge der Eibildung. Dasselbe zeigt also im Laufe des späteren Lebensalters
unserer W ürmer ein ziemlich ungleichmässiges Verhalten, welches von dem des Receptaculum
am LAURER’schen Canale einigermassen bedeutsam abweicht. Wo das le tz tere vorhanden ist, da
kann man meinen Erfahrungen nach ausnahmslos — die Beobachtung machen, dass seine
Füllung mit dem A lte r der Thiere immer mehr z u n im m t , resp., dass es bei den ä l t e s t e n
Individuen immer am s t ä r k s t e n bevölkert ist, und zwar gewöhnlich mit Spermatozoen.
Das specielle Verhalten d e r Samenfäden im* Inneren der weiblichen Keimorgane is t nun
weiterhin in ganz augenfälliger Weise beeinflusst von dem vor kurzem beschriebenen Flimmer’)
Eine derartige Beobachtung wurde bekanntlich gemacht von v. LlNSTOW, lieber den Bau u. d. Entw. d.
Dist. cylindraceum 1. c. p. 185 u. a.