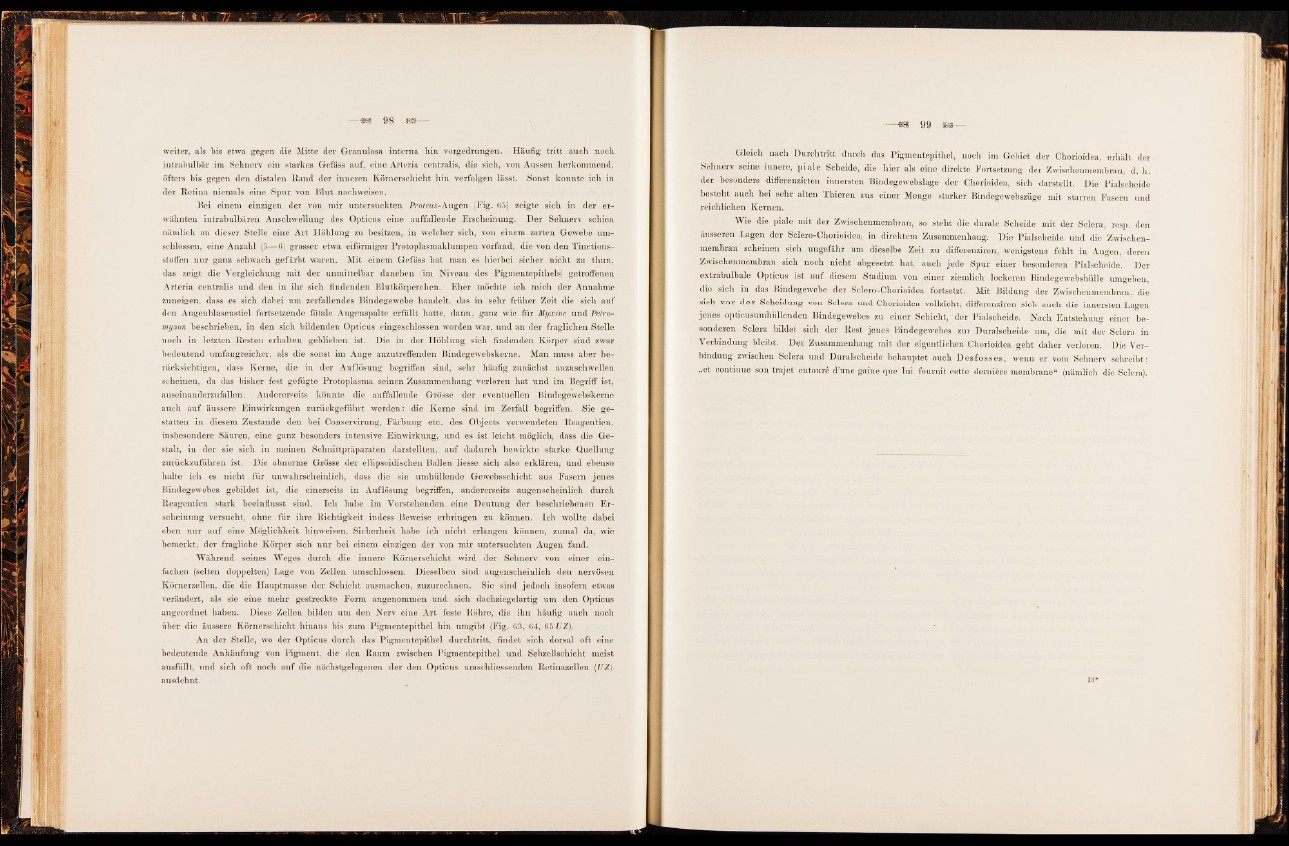
weiter, als bis etwa gegen die Mitte der Granulosa interna hin vorgedrungen. Häufig tritt auch noch
intrabulbär im Sehnerv ein starkes Gefäss auf, eine Arteria centralis, die sich, von Aussen herkommend,
öfters bis gegen den distalen Rand der inneren Körnerschicht hin verfolgen lässt. Sonst konnte ich in
der Retina niemals eine Spur von Blut nachweisen.
Bei einem einzigen der von mir untersuchten Proteus-Augen (Fig. 65) zeigte sich in der erj
wähnten intrabulbären Anschwellung des Opticus eine auffallende Erscheinung. Der Sehnerv schien
nämlich an dieser Stelle eine Art Höhlung zu besitzen, in welcher sich, von einem zarten Gewebe umschlossen,
eine Anzahl (5—6) grösser etwa eiförmiger Protoplasmaklumpen vorfand, die von den Tinctions-
stoffen nur ganz schwach gefärbt waren. Mit einem Gefäss hat man es hierbei sicher nicht zu thun,
das zeigt die Vergleichung mit der unmittelbar daneben (im Niveau des Pigmentepithels) getroffenen
Arteria centralis und den in ihr sich findenden Blutkörperchen. Eher möchte ich mich der Annahme
zuneigen, dass es sich dabei um zerfallendes Bindegewebe handelt, das in sehr früher Zeit die sich auf
den Augenblasenstiel fortsetzende fötale Augenspalte erfüllt hatte, dann, ganz wie für Myocine und Petro*-
myzon beschrieben, in den sich bildenden Opticus eingeschlossen worden war, und an der fraglichen Stelle
noch in letzten Resten erhalten geblieben ist. Die in der Höhlung sich findenden Körper sind zwar
bedeutend umfangreicher, als die sonst im Auge anzutreffenden Bindegewebskerne. Man muss aber berücksichtigen,
dass Kerne, die in der Auflösung begriffen sind, sehr häufig zunächst anzuschwellen
scheinen, da das bisher fest gefügte Protoplasma seinen Zusammenhang verloren h a t und im Begriff ist,
auseinanderzufallen. Andererseits könnte die auffallende Grösse der eventuellen Bindegewebskerne
auch auf äussere Einwirkungen zurückgeführt werden: die Kerne sind im Zerfall begriffen. Sie gestatten
in diesem Zustande den bei Conservirung, Färbung etc. des Objects verwendeten Reageritien,
insbesondere Säuren, eine ganz besonders intensive Einwirkung, und es ist leicht /möglich, dass die Gestalt,
in der sie sich in meinen Schnittpräparaten darstellten, auf dadurch bewirkte starke Quellung
zurückzuführen ist. Die abnorme Grösse der ellipsoidischen Ballen liesse sich also erklären, und ebenso
halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass die sie umhüllende Gewebsschicht aus Fasern jenes
Bindegewebes gebildet ist, die einerseits in Auflösung begriffen, andererseits augenscheinlich durch
Reagentien stark, beeinflusst sind. Ich habe im Vorstehenden eine Deutung der beschriebenen E rscheinung
versucht, ohne für ihre Richtigkeit indess Beweise erbringen zu können. Ich wollte dabei
eben n u r auf eine Möglichkeit hinweisen, Sicherheit habe ich nicht erlangen können, zumal da, wie
bemerkt, der fragliche Körper sich n u r bei einem einzigen der von mir untersuchten Augen fand;
Während seines Weges durch die innere Körnerschicht wird der Sehnerv von einer einfachen
(selten doppelten) Lage von Zellen umschlossen. Dieselben sind augenscheinlich den nervösen
Körnerzellen, die die Hauptmasse der Schicht ausmachen, zuzurechnen. Sie sind jedoch insofern etwas
verändert, als sie eine mehr gestreckte Form angenommen und sich dachziegelartig um den Opticus
angeordnet haben. Diese Zellen bilden um den Nerv eine Art feste Röhre, die ihn häufig auch noch
über die äussere Körnerschicht hinaus bis zum Pigmentepithel hin umgibt (Fig. 63, 64, 65 Z7Z).
An der Stelle, wo der Opticus durch das Pigmentepithel durchtritt, findet sich dorsal oft eine
bedeutende Anhäufung von Pigment, die den Raum zwischen Pigmentepithel und Sehzellschicht meist
ausfüllt, und sich oft noch auf die nächstgelegenen der den Opticus umschliessenden Retinazellen (UZ)
ausdehnt.
Gleich nach Durchtritt durch das Pigmentepithel, noch im Gebiet der Chorioidea, erhält der
Sehnerv seine innere, p ia le Scheide, die hier als eine direkte Fortsetzung der Zwischenmembran, d. h.
der besonders differenzirten innersten Bindegewebslage der Chorioidea, sich darstellt. Die Pialscheide
besteht auch bei sehr alten Thieren aus einer Menge starker Bindegewebszüge mit starren Fasern und
reichlichen Kernen.
Wie die piale mit der Zwischenmembran, so steht die durale Scheide mit der Sciera, resp. den
äusseren Lagen der Sclero-Chorioidea, in direktem Zusammenhang. Die Pialscheide und die Zwischenmembran
scheinen sich ungefähr um dieselbe Zeit zu differenziren, wenigstens fehlt in Augen, deren
Zwischenmembran sich noch nicht abgesetzt hat, auch jede Spur einer besonderen Pialscheide. Der
extrabulbale Opticus ist au f diesem Stadium von einer ziemlich lockeren Bindegewebshülle umgeben,
die sich in das Bindegewebe der Sclero-Chorioidea fortsetzt. Mit Bildung der Zwischenmembran, die
sich v o r d e r Scheidung von Sciera und Chorioidea vollzieht, differenziren sich auch die innersten Lagen
jenes opticusumhüllenden Bindegewebes zu einer Schicht, der Pialscheide. Nach Entstehung einer besonderen
Sciera bildet sich der Rest jenes Bindegewebes zur Duralscheide um, die mit der Sciera in
Verbindung bleibt. Der Zusammenhang mit der eigentlichen Chorioidea geht daher verloren. Die Verbindung
zwischen Sciera und Duralscheide behauptet auch D e s fo s s e s , wenn er vom Sehnerv schreibt:
„et continue son trajet entouré d’une gaine que lui fournit cette dernière membrane“ (nämlich die Sciera).