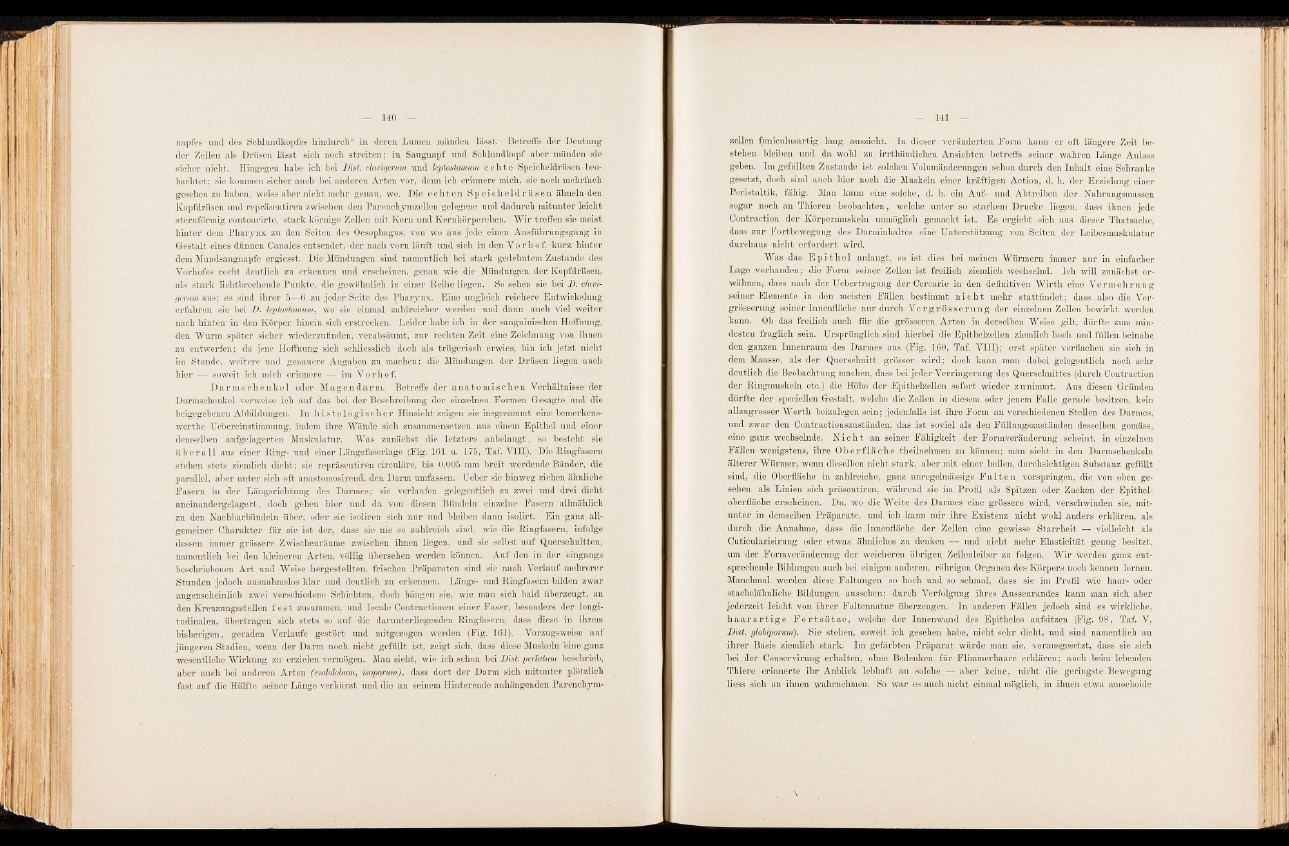
napfes und des Schlundkopfes hindurch“ in deren Lumen münden lässt. Betreffs der Deutung
d er Zellen als Drüsen lä ss t sich noch s tre ite n ; in Saugnapf und Schlundkopf aber münden sie
sicher nicht. Hingegen habe ich bei Bist, clavigemm und leptostomum e c h t e Speicheldrüsen beobachtet;
sie kommen sicher auch bei anderen A rte n vor, denn ich erinnere mich, sie noch mehrfach
gesehen zu haben, weiss aber nicht mehr genau, wo. Die e c h t e n S p e i c h e l d r ü s e n äh n eln d en
Kopfdrüsen und reprä sentiren zwischen den Parenchymzellen gelegene und dadurch m itu n te r leicht
sternförmig contourirte, s ta rk körnige Zellen mit Kern und Kernkörperchen. W ir treffen sie meist
h in te r dem P h a ry n x zu den Seiten des Oesophagus, von wo aus jede einen Ausführungsgang in
G e sta lt eines dünnen Canales entsendet, der nach vorn lä u ft und sich in den V o r h o f , k u rz h in te r
dem Mundsaugnapfe ergiesst. Die Mündungen sind namentlich bei s ta rk gedehntem Zustande des
Vorhofes re c h t deutlich zu erkennen und erscheinen, genau wie die Mündungen der Kopfdrüsen,
als s ta rk lichtbrechende Punkte, die gewöhnlich, in einer Reihe liegen. So sehen sie bei B . clavi-
gerum aus; es sind ih re r 5—6 zu je d e r Seite des P h a ry n x . Eine ungleich reichere Entwickelung
erfahren sie bei B . leptostomum, wo sie einmal zahlreicher werden und dann auch viel weiter
nach hin ten in den Körper hinein sich erstrecken. Leider habe ich in der sanguinischen Hoffnung,
den Wurm sp äte r sicher wiederzufinden, verabsäumt, zu r rechten Z e it eine Zeichnung von ihnen
zu entwerfen; da jene Hoffnung sich schliesslich doch als trügerisch erwies, bin ich je tz t nicht
im Stande, weitere und genauere Angaben zu machen; die Mündungen der Drüsen liegen auch
Mer — -soweit ich mich erinnere « i m Vo r h o f .
D a r m s c h e n k e l oder M a g e n d a rm . Betreffs der a n a t o m i s c h e n Verhältnisse der
Darmschenkel verweise ich auf das bei der Beschreibung der einzelnen Formen Gesagte und die
beigegebenen Abbildungen. In h i s t o l o g i s c h e r Hinsicht zeigen sie insgesammt eine bemerkens-
w erthe Uebereinstimmung, indem ih re Wände sich zusammensetzen aus einem E p ithel und einer
demselben aufgelagerten Muskulatur. W as zunächst die le tz tere an belangt, so be steht sie
ü b e r a l l aus einer Ring- und einer Längsfaserlage (Fig. 161 u. 175, Taf. VIII). Die Ringfasern
stehen s te ts ziemlich dicht; sie rep rä sen tiren circuläre, bis 0,005 mm b re it werdende Bänder, die
parallel, aber u n te r sich oft anastomosirend, den Darm umfassen. Ueber sie hinweg ziehen ähnliche
F a se rn in der Längsrichtung des Darmes; sie verlaufen gelegentlich zu zwei und drei dicht
aneinandergelagert, doch gehen h ie r und da von diesen Bündeln einzelne F a s ern allmählich
zu den Nachbarbündeln über, oder sie isoliren sich n u r und bleiben dann isolirt. Ein ganz a llgemeiner
C h arak ter fü r sie is t der, dass sie nie so zahlreich sind, wie die Ringfasern, infolge
dessen immer grössere Zwischenräume zwischen ihnen liegen, und sie selbst au f Querschnitten,
namentlich bei den kleineren A rte n , völlig übersehen werden können. A u f den in der eingangs
beschriebenen A r t und Weise hergestellten, frischen P räp a ra te n sind sie nach V e rlau f mehrerer
Stunden jedoch ausnahmslos k la r und deutlich zu erkennen. Längs- und Ringfasern bilden zwar
augenscheinlich zwei verscMedene Schichten, doch hängen sie, wie man sich bald überzeugt, an
den Kreuzungsstellen f e s t zusammen, und locale Contractionen einer Faser, besonders der longitudinalen,
ü b e rtrag en sich s te ts so au f die darunterliegenden Ringfasern, dass diese in ihrem
bisherigen, geraden Verlaufe g e stö rt und mitgezogen werden (Fig. 161). Vorzugsweise auf
jüngeren Stadien, wenn der Darm noch nich t gefüllt ist, zeigt sich, dass diese Muskeln eine ganz
wesentliche W irk u n g zu erzielen vermögen. Man sieht, wie ich schon bei Bist, perlatum beschrieb,
aber auch bei anderen A rte n ( endolobum, isoporum), dass d o rt der Darm sieh m itu n te r plötzlich
fa s t au f die Hälfte seiner Länge v e rk ü rz t und die an seinem H in te r ende anhängenden Parenchymzellen
funiculusartig lang auszieht. -In dieser ve ränderten Form kann e r oft längere Zeit bestehen
bleiben und da wohl zu irrthümlichen Ansichten betreffs seiner wahren Länge Anlass
geben. Im gefüllten Zustande is t solchen Volumänderungen schon durch den In h a lt eine Schranke
gesetzt, doch sind auch h ie r noch die Muskeln einer k rä ftig en Action, d. h. der Erzielung einer
P e ris ta ltik , fähig. Man kann eine solche, d. h. ein Auf- und Ab treiben der Nahrungsmassen
sogar noch an Thieren ' beobachten, welche u n te r so s tarkem Drucke liegen, dass ihnen jede
Contraction der Körpermuskeln unmöglich gemacht ist. Es e rgiebt sich aus dieser Thatsache,
dass zu r Fortbewegung des Darminhaltes eine Un te rstü tzu n g von Seiten der Leibesmuskulatur
durchaus nich t e rfo rd e rt wird.
Was das E p i t h e l anlangt, so is t dies bei meinen Würmern immer n u r in einfacher
Lage vorhanden; die Form seiner Zellen is t freilich ziemlich wechselnd. Ich will zunächst e rwähnen,
dass nach der Uebertragung der Cercarie in den definitiven W ir th eine V e rm e h r u n g
seiner Elemente in. den meisten Fällen bestimmt n i c h t mehr stattfin d e t; dass also die Ver-
grösserung seiner Innenfläche n u r durch V e r g r ö s s e r u n g der einzelnen Zellen bewirkt werden
kann. Ob das freilich auch fü r die grösseren A rte n in derselben Weise gilt, dürfte zum mindesten
fraglich sein. Ursprünglich sind hierbei die Epithelzellen ziemlich hoch und füllen beinahe
den ganzen Innenraum des Darmes aus (Fig. 160, Taf. V I I I ) ; e rs t sp äte r verflachen sie sich in
dem Maasse, als der Querschnitt grösser w ird ; doch kann man dabei gelegentlich noch sehr
deutlich die Beobachtung machen, dass bei jed e r Verringerung des Querschnittes (durch Contraction
der Ringmuskeln etc.) die Höhe der Epithelzellen sofort wieder z u nimmt. Aus diesen Gründen
d ü rfte der speciellen Gestalt, welche die Zellen in diesem oder jenem F a lle gerade besitzen, kein
allzugrosser W e r th beizulegen sein; jedenfalls is t ih re Form an verschiedenen Stellen des Darmes,
und zw a r den Contractionszuständen, das is t soviel als den Füllungszuständen desselben gemäss,
eine ganz wechselnde. N i c h t an seiner F ähigke it der Formveränderung scheint, in einzelnen
Fä llen wenigstens, ih re O b e r f l ä c h e theilnehmen zu können; man sieht in den Darmschenkeln
ä lte re r Würmer, wenn dieselben nicht s ta rk , aber mit einer hellen, durchsichtigen Substanz gefüllt
sind, die Oberfläche in zaMreiche, ganz unregelmässige F a l t e n vorspringen, die von oben gesehen
als Linien sich präsentiren, während sie im Profil als Spitzen oder Zacken der E p itheloberfläche
erscheinen. Da, wo die W eite des Darmes -eine grössere wird, verschwinden sie, mit-,
u n te r in demselben P rä p a ra te , und ich kann mir ih re Existenz n ich t jvohl anders erklären, als
durch die Annahme, dass die Innenfläche der Zellen eine gewisse S ta rrh e it — vielleicht als
Cuticularisirung oder etwas ähnliches zu denken — und nicht mehr E la s tic itä t genug besitzt,
um der Formveränderung der weicheren übrigen Zellenleiber zu folgen. W ir werden ganz en tsprechende
Bildungen auch bei einigen anderen, röhrigen Organen des Körpers noch kennen lernen.
Manchmal werden diese Faltungen so hoch und so schmal, dass sie im Profil wie haar- oder
stachelähnliche Bildungen aussehen; durch Verfolgung ihres Aussenrandes kann man sich aber
jederzeit leicht von ih re r F a lte n n ä tu r überzeugen. In anderen Fä llen jedoch sind es wirkliche,
h a a r a r t i g e F o r t s ä t z e , welche der Innenwand des Epitheles aufsitzen (Fig. 98, Taf. V,
Bist, globiporum). Sie stehen, soweit ich gesehen habe, n ich t sehr dicht, un d sind namentlich an
ih re r Basis ziemlich stark . Im gefärbten P r ä p a r a t würde man sie, vorausgesetzt, dass sie sich
bei der Conservirung erhalten, ohne Bedenken fü r Flimmer h a are e rk lä ren ; auch beim lebenden
Thiere erinnerte ih r Anblick lebhaft an solche ab er keine, nicht die geringste Bewegung
liess sich an ihnen wahrnehmen. So wa r es auch nicht einmal möglich, in ihnen etwa amoeboide