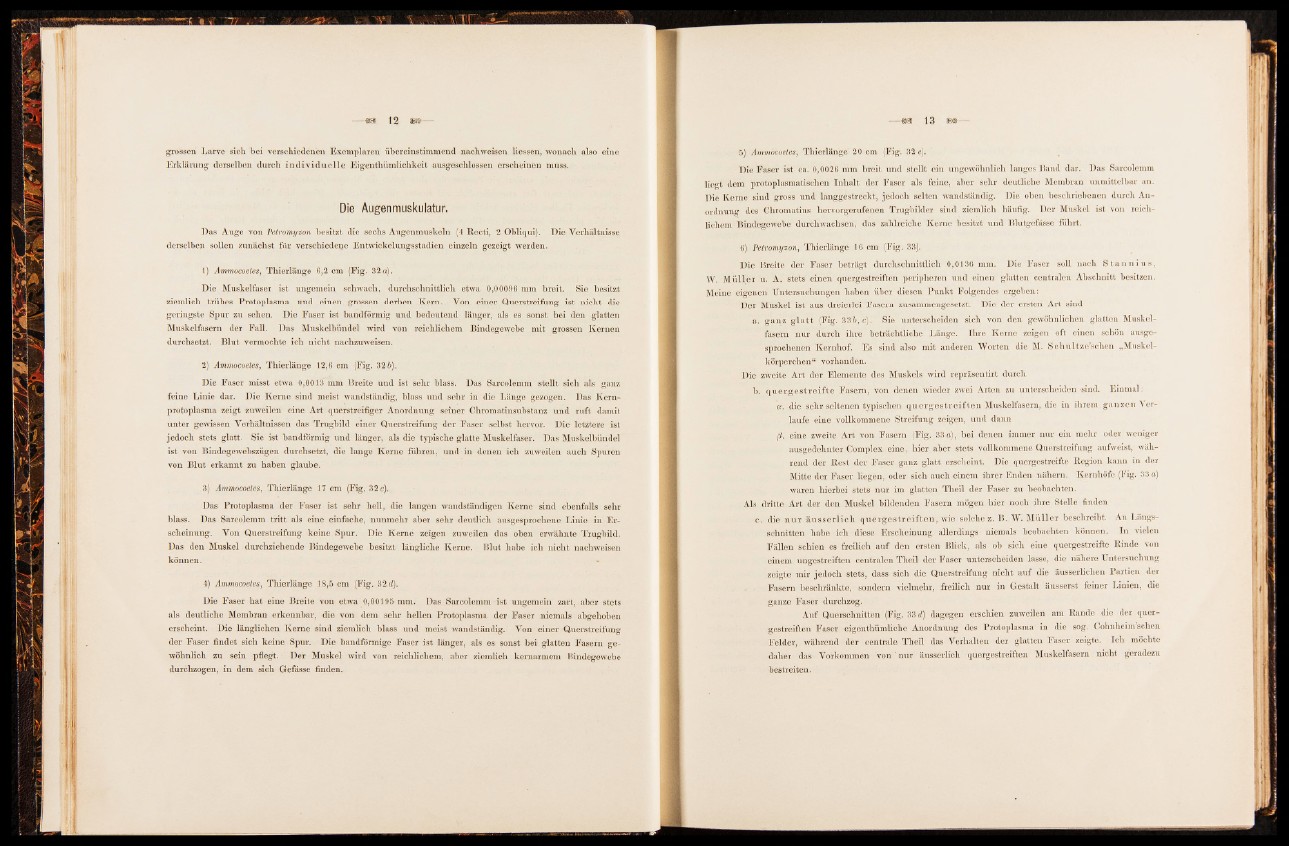
grossen Larve sich bei verschiedenen Exemplaren übereinstimmend nachweisen liessen, wonach also eine
Erklärung derselben durch i n d iv id u e l l e Eigenthümlichkeit ausgeschlossen erscheinen muss.
Die Augenmuskulatur.
Das Auge von Petromyzon besitzt die sechs Augenmuskeln (4 Recti, 2 Obliqui). Die Verhältnisse
derselben sollen zunächst für verschiedene Entwickelungsstadien einzeln gezeigt werden.
1) Ammocoetes, Thierlänge 6,2 cm (Fig. 32a).
Die Muskelfaser ist ungemein schwach, durchschnittlich etwa 0,00096 mm breit. Sie besitzt
ziemlich trübes Protoplasma und einen grossen derben Kern. Von einer Querstreifung ist nicht die
geringste Spur zu sehen. Die Faser ist bandförmig und bedeutend länger, als es sonst bei den glatten
Muskelfasern der Fall. Das Muskelbündel wird von reichlichem Bindegewebe mit grossen Kernen
durchsetzt. Blut vermochte ich nicht .nachzuweisen.
2) Ammocoetes, Thierlänge 12,6 cm (Fig. 32 6).
Die Faser misst etwa 0,0013 mm Breite und ist sehr blass. Das Sarcolemm stellt sich als ganz
feine Linie dar. Die Kerne sind meist wandständig, blass und sehr in die Länge gezogen. Das Kernprotoplasma
zeigt zuweilen eine Art querstreifiger Anordnung seiner Chromatinsubstanz und ruft damit
unter gewissen Verhältnissen das Trugbild einer Querstreifung der Faser selbst hervor. Die letztere ist
jedoch stets glatt. Sie ist bandförmig und länger, als die typische glatte Muskelfaser. Das Muskelbündel
ist von Bindegewebsziigen durchsetzt, die lange Kerne führen, und in denen ich zuweilen auch Spuren
von Blut erkannt zu haben glaube.
3) Ammocoetes, Thierlänge 17 cm (Fig. 32 c), .
Das Protoplasma der Faser ist sehr hell, die langen wandständigen Kerne sind ebenfalls sehr
blass. Das Sarcolemm tritt als eine einfache, nunmehr aber sehr deutlich ausgesprochene Linie in Erscheinung.
Von Querstreifung keine Spur. Die Kerne zeigen zuweilen das oben erwähnte Trugbild.
Das den Muskel durchziehende Bindegewebe besitzt längliche Kerne. Blut habe ich nicht nachweisen
können.
■ 4) Ammocoetes, Thierlänge 18,5 cm (Fig. 32 d).
Die Faser h a t eine Breite von etwa 0,00195 mm. Das Sarcolemm is t ungemein zart, aber stets
als deutliche Membran erkennbar, die von dem sehr hellen Protoplasma der Faser niemals abgehoben
erscheint. Die länglichen Kerne sind ziemlich blass und meist wandständig. Von einer Querstreifung
der Faser findet sich keine Spur. Die bandförmige Faser ist länger, als es sonst bei glatten Fasern gewöhnlich
zu sein pflegt. Der Muskel wird von reichlichem, aber ziemlich kernarmem Bindegewebe
durchzogen, in dem sich Gefässe finden.
5) Ammocoetes, Thierlänge 20 cm (Fig. 32 e).
Die Faser ist ca. 0,0026 mm breit und stellt ein ungewöhnlich langes Band dar. Das Sarcolemm
liegt dem protoplasmatischen In h a lt der Faser als feine, aber sehr deutliche Membran unmittelbar an.
Die Kerne sind gross und langgestreckt, jedoch selten wandständig. Die oben beschriebenen durch Anordnung
des Chromatins hervorgerufenen Trugbilder sind ziemlich häufig. Der Muskel ist von reichlichem
Bindegewebe durchwachsen, das zahlreiche Kerne besitzt und Blutgefässe führt.
6) Petromyzon, Thierlänge 16 cm (Fig. 33).
Die Breite der Faser beträgt durchschnittlich 0,0136 mm. Die Faser soll nach S t a n n i u s ,
W. M ü lle r u. A. stets einen quergestreiften peripheren und einen glatten centralen Abschnitt besitzen.
Meine eigenen Untersuchungen haben über diesen P u n k t Folgendes ergeben:
Der Muskel ist aus dreierlei Fasern zusammengesetzt. Die der ersten Art sind
a. g a n z g l a t t (Fig. 33 6, c). Sie unterscheiden sich von den gewöhnlichen glatten Muskelfasern
nur durch ihre beträchtliche Länge. Ihre Kerne zeigen oft einen schön ausgesprochenen
Kernhof. Es sind also mit anderen Worten die M. S c liu ltz e ’schen „Muskelkörperchen“
vorhanden.
Die. zweite Art der Elemente des Muskels wird repräsentirt durch
b. q u e r g e s t r e i f t e Fasern, von denen wieder zwei Arten zu unterscheiden -sind. Einmal:
ct. die sehr seltenen typischen q u e r g e s t r e i f t e n Muskelfasern, die in ihrem g a n z e n Verlaufe
eine vollkommene Streifung zeigen, und dann
ß. eine zweite Art von Fasern (Fig. 33 a), bei denen immer n u r ein mehr oder weniger
ausgedehnter Complex eine, hier aber stets vollkommene Querstreifung aufweist, während
der Rest der Faser ganz glatt erscheint. Die quergestreifte Region kann in der
Mitte der Faser liegen, oder sich auch einem ihrer Enden nähern. Kernliöfe (Fig. 33 a)
waren hierbei stets n u r im glatten Theil der Faser zu beobachten.
Als dritte Art der den Muskel bildenden Fasern mögen hier noch ihre Stelle finden
c. die n u r ä u s s e r i i c h q u e r g e s t r e i f t e n , wie solche z. B. W. M ü lle r beschreibt. An Längsschnitten
habe ich diese Erscheinung allerdings niemals beobachten können. In vielen
Fällen schien es freilich auf den ersten Blick, als ob sich eine quergestreifte Rinde von
einem ungestreiften centralen Theil der Faser unterscheiden lasse, die nähere Untersuchung
zeigte mir jedoch stets, dass sich die Querstreifung nicht auf die äusserlichen Partien der
Fasern beschränkte, sondern vielmehr, freilich n u r in Gestalt äusserst feiner Linien, die
ganze Faser durchzog.
Auf Querschnitten (Fig. 33 d) dagegen erschien zuweilen am Rande die der quergestreiften
Faser eigenthümliche Anordnung des Protoplasma in die sog. Cohnheim’schen
Felder, während der centrale Theil das Verhalten der glatten Faser zeigte. Ich möchte
daher das Vorkommen von nur äusseriich quergestreiften Muskelfasern nicht geradezu
bestreiten.