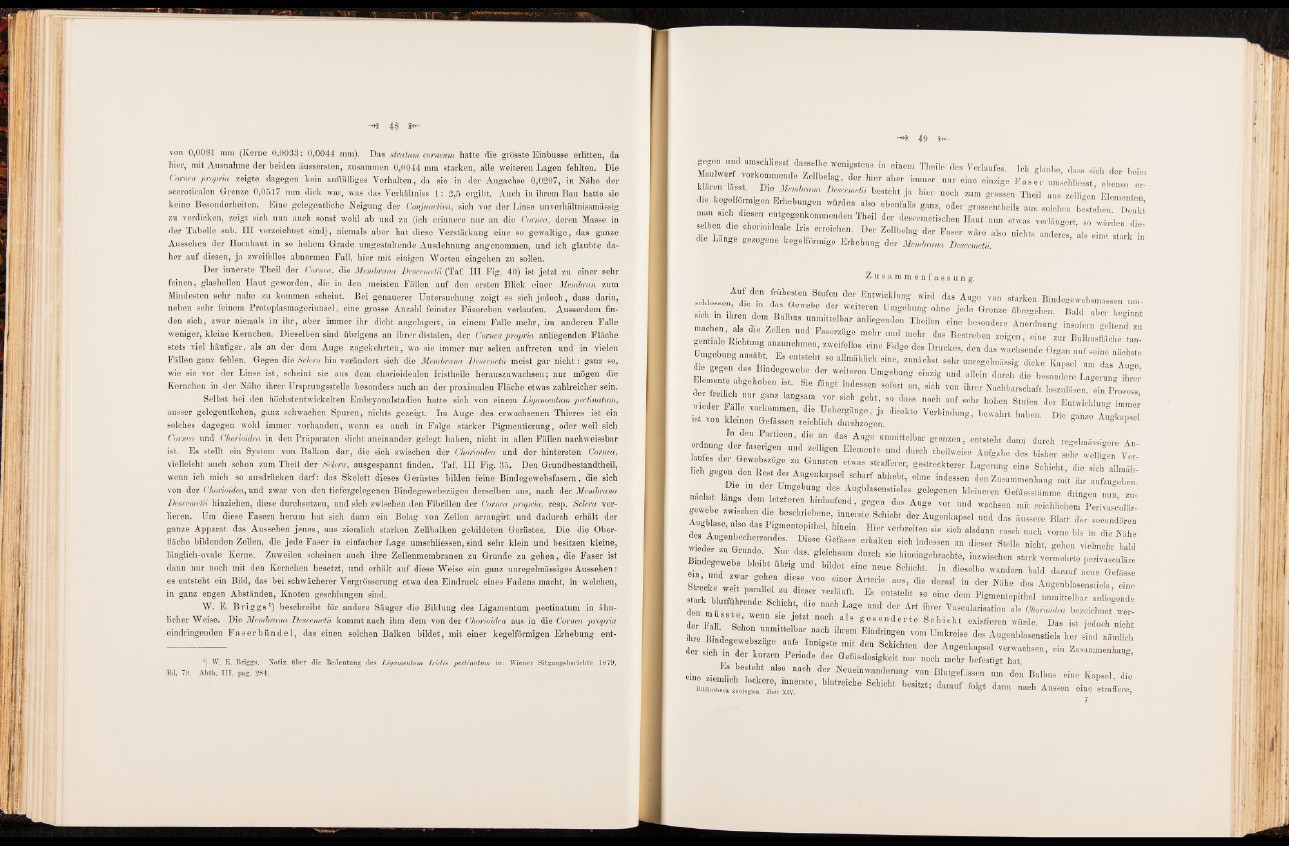
von 0,0081 mm (Kerne 0,0033 .* 0,0044 mm). Das stratum corneum hatte die grösste Einbusse erlitten, da
hier, mit Ausnahme der beiden äussersten, zusammen 0,0044 mm starken, alle weiteren Lagen fehlten. Die
Cornea proima zeigte dagegen kein auffälliges "Verhalten, da sie in der Augachse 0,0207, in Nähe der
sceroticalcn Grenze 0,0517 mm dick war, was das Vcrhältniss 1: 2,5 ergibt. Auch in ihrem Bau hatte sie
keine Besonderheiten. Eine gelegentliche Neigung der Conjuncbiva, sich vor der Linse unverhältnissmässig
zu verdicken, zeigt sich nun auch sonst wohl ab und zu (ich erinnere nur an die Cornea, deren Masse in
der Tabelle sub. I I I verzeichnet sind), niemals aber hat diese Verstärkung eine so gewaltige, das ganze
Aussehen der Hornhaut in so hohem Grade umgestaltende Ausdehnung angenommen, und ich glaubte daher
auf diesen, ja zweifellos abnormen Pall, hier mit einigen Worten eingehen zu sollen.
Der innerste Theil der Cornea, die Membrana Descemetii (Taf. I I I Fig. 40) ist jetzt zu einer sehr
feinen, glashellen Haut geworden, die in den meisten Fällen auf den ersten Blick einer Membran zum
Mindesten sehr nahe zu kommen scheint. Bei genauerer Untersuchung zeigt es sich jed o ch , dass darin,
neben sehr feinem Protoplasmagerinnsel, eine grosse Anzahl feinster Fäserchen verlaufen. Ausserdem finden
sich, zwar niemals in ih r, aber immer ihr dicht angclagert, in einem Falle mehr, im anderen Falle
weniger, kleine Kernchen. Dieselben sind übrigens an ihrer distalen, der Cornea propria anliegenden Fläche
stets viel häufiger, als an der dem Auge zugekehrten, wo sie immer nur selten auftreten und in vielen
Fällen ganz fehlen. Gegen die Sclera hin verändert sich die Membrana Descenebii meist gar n ic h t: ganz so,
wie sie vor der Linse ist, scheint sie aus dem chorioidealon Iristheile herauszuwachsen; nur mögen die
Kernchen in der Nähe ihrer Ursprungsstelle besonders auch an der proximalen Fläche etwas zahlreicher sein.
Selbst bei den höchstentwickelten Embryonalstadien hatte sich von einem Ligamentum pecÜnatum,
ausser gelegentlichen, ganz schwachen Spuren, nichts gezeigt. Im Auge des erwachsenen Thieres ist ein
solches dagegen wohl immer vorhanden, wenn es auch in Folge starker Pigmentierung, oder weil sich
Cornea und Chorioidea in den Präparaten dicht aneinander gelegt haben, nicht in allen Fällen nachweissbar
ist. Es stellt ein System von Balken dar, die sich zwischen der Chorioidea und der hintersten Cornea,
vielleicht auch schon zum Theil der Sclera, ausgespannt finden. Taf. I I I Fig. 35. Den Grundbestandtheil,
wenn ich mich so ausdriieken darf: das Skelett dieses Gerüstes bilden feine Bindegewebsfasern, die sich
von der Chorioidea, und zwar von den tiefergelegenen Bindegewebszügen derselben aus, nach der Membrana
Descemetii hinziehen, diese durchsetzen, und sich zwischen den Fibrillen der Cornea propria, resp. Sclera verlieren.
Um diese Fasern herum hat sich dann ein Belag von Zellen arrangirt und dadurch erhält der
ganze Apparat das Aussehen jen e s , aus ziemlich starken Zellbalken gebildeten Gerüstes. Die die Oberfläche
bildenden Zellen, die jede Faser in einfacher Lage umschliessen, sind sehr klein und besitzen kleine,
länglich-ovale Kerne. Zuweilen scheinen auch ihre Zellenmembranen zu Grunde zu gehen, die Faser ist
dann nur noch mit den Kernchen besetzt, und erhält auf diese Weise ein ganz unregelmässiges A ussehen:
es entsteht ein Bild, das bei schwächerer Vergrösserung etwa den Eindruck eines Fadens macht, in welchen,
in ganz engen Abständen, Knoten geschlungen sind.
W. E. B r i g g s 1) beschreibt für andere Säuger die Bildung des Ligamentum pectinatum in ähnlicher
Weise. Die Membrana Descemetii kommt nach ihm dem von der Chorioidea aus in die Cornea propria
eindringenden F a s e r b ü n d e l , das einen solchen Balken bildet, mit einer kegelförmigen Erhebung ent-
J) W. E. Briggs. Notiz über clie Bedeutnng des Ligamentum Iridis pectinatum in: Wiener Sitzungsberichte 1879.
Bd. 79. Abtb. III, pag. 284.
_ m einem Theile des Verlaufes. Ick glaube, dass sich der beim 3E9 HB HB ■ hIM k 1; , ] r . „ , “ ^oemda besteht ja hier noch zum grossen Theil aus zelligen Elementen
kegelfonmgen Erhebungen würden also ebenfalls ganz, oder grossehtheils aus solchen bestehen Denkt
man sich diesen entgegenkommenden Theil der descemetischen Haut nun etwas verlängert so würden d t
selben die chorioideale In s erreichen. Der Zellbelag der Faser wäre also, nichts anderes, als eine stark in
die Lange gezogene kegelförmige Erhebung der Membrana Descemetii.
' Auf de* frühesten Stufen der Entwicklung wird das Auge von starken Bindegewebsmassen um
s ü s s e n , die m das Gewebe der weiteren Umgebung ohne jede Grenze übergehen. B a l d Z r g l ! BI■■ HI HB HB ■ »• HB ^B w— sw — BIBI ZelleD “nd Paae™ge mehr “ ehr das Bestreben zeigen, eine zur BulbusBäche tangentiale
Richtung anzunchmen, zweifellos eine Folge des Druckes, den das wachsende Organ auf seine nächste
Umgebung ausubt. Es entsteht so allmählich eine, zunächst sehr unrecelmässig dicke k L I T , 7 T
.e gegen das Bindegewebe der weiteren Umgebung einzig und allein durch die besondere Lagerang ihrar
H B W M ■ ind688en 8°f0rt “ > l I Nachbarschaft ■ ■ B M M
wieder P iS le ^R i T B H S° 3893 n°Ch I Sehr h°hen Stufen der Wicklung R
ist von kl ™ k0,mmen’ dle Ü b e rg än g e , ja direkte Verbindung, bewahrt haben. Die ganze Augkapsel
ist von kleinen Gefassen reichlich durchzogen. -«-ugKapsei BHI P a Ä e D ' d ie a n das Auge unmittelbar grenzen, entsteht dann durch regelmässigere An-
■ — HIWI W B M ■ 3 Und d™ h I M Aufgabe des bisher sehr wellig8! : Verlieh
! - a p ? *” etwaa strafforer> gestreckterer Lagerung eine Schicht, die sich allmäh
gegen den Rest der AugenkapseL scharf abhebt, ohne indessen den Zusammenhang mit ihr anfzugeben
nächst länc I ! ü “ get>Ung dea Augblasenstieles gelegenen kleineren Gefässstämme dringen nun zu-
ce h f dein letzteren hinlaufend, gegen das Auge vor und wachsen mit reichlichem Perivasculär ^H^B BflBHii derAugenkaPael “ d daa ähssere Blatt der secundären
des Anco h h omentepithel, hinein. Hier verbreiten sie sich alsdann rasch nach vorne bis in die Nähe
wieder S B — -DleSe. ^ h a lte n sich indessen an dieser Stelle nicht, gehen vielmehr bald
Binde h B H aS’ g aam durch SIe hmemgebrachte, inzwischen stark vermehrte perivasculäre
mdegewebe bleibt übrig und bildet eine neue Schicht. In dieselbe wandern bald darauf neue Gelasse
em und zwar gehen diese von einer Arterie ans, die dorsal in der-Nähe des AugenMasLstlel! t
— ¡ B f i K B H B I R so eine dem Pigmentepithel unmittelbar anliegende
terk b utf hrende Schicht, die nach Lage und der Art ihrer Vascularisation als B f l bezeichnet wer
dei Pal S i r 6“ I M B aU B B B H B B B I würde. Das ist jedoch
ü>re Eindringen S B E i m b b w w i * § „ämiioh ■ B M B B IM f l B H D 1 8 “ u der Augenkapsel verwachsen, ein Zusammenhang,
sich in der kurzen Periode der Gefässlosigkeit nur noch mehr befestigt hat
eine M B — H B B Neueinwandera”S von Blutgefässen um den Bulbus eine Kapsel die UBBH he B B B f°]gt da”n n“h Auaaen eine straffere,