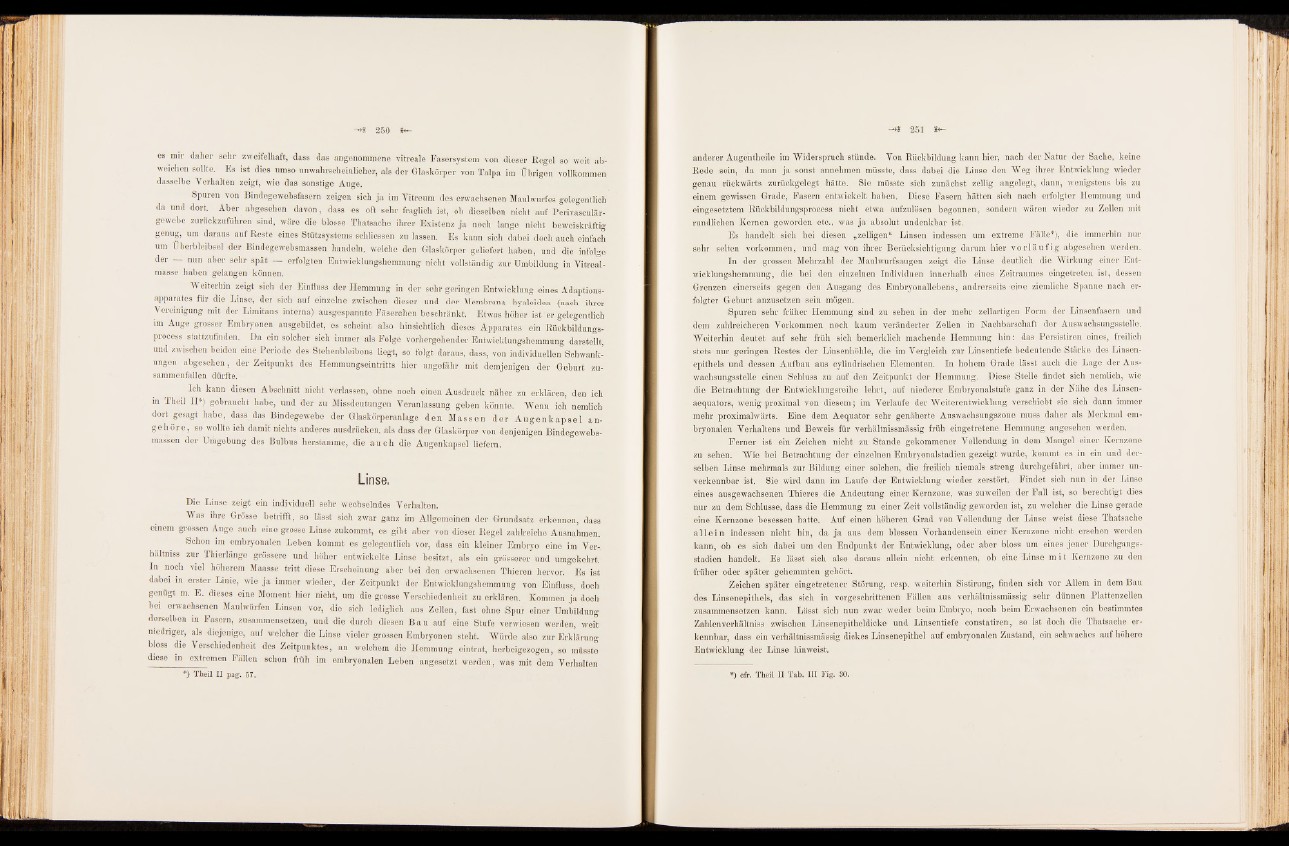
es mir daher sehr zweifelhaft, dass das angenommene vitreale Fasersystem von dieser Regel # weit abweichen
sollte. Es ist dies umso unwahrscheinlicher, als der Glaskörper von Talpa im Übrigen vollkommen
dasselbe Verhalten zeigt, wie das sonstige Auge.
Spuren von Bindegewebsfasern zeigen sich ja im Yitreum des erwachsenen Maulwurfes gelegentlich
da und dort. Aber abgesehen davon, dass es oft sehr fraglich ist, ob dieselben nicht auf Perivaaoulär-
gewebe zurückzuführen sind, wäre die blosse Thatsache ihrer Existenz ja noch lange nioht beweiskräftig
genug, um daraus auf R este eines Stützsystems schliessen zu lassen. Es kann sioh dabei doch auch einfach
um Überbleibsel der Bindegewebsmassen handeln, welche den Glaskörper geliefert haben, und die infolge
der - nun aber sehr spät erfolgten Entwicklungshemmung nicht vollständig zur Umbildung in Vitreal-
masse haben gelangen können.
Weiterhin zeigt sich der Einfluss der Hemmung in der sehr geringen Entwicklung eines Adaptionsapparates
für die Linse, der sich auf einzelne zwischen dieser und der Membrana hyaloidea (nach ihrer
Vereinigung mit der Limitans interna) ausgespannto. Fäserchen beschränkt. Etwas höher is t'e r gelegentlich
im Auge grösser Embryonen ausgebildet, es scheint also hinsichtlich dieses Apparates ein Rückbildungs-
process stattzufinden. Da ein solcher sich immer^als Folge vorhergehender Entwicklungshemmung darstelltj
und zwischen beiden eine Periode des Stehenbleibens liegt, so folgt daraus, dass, von individuellen Schwank«
ungen abgesehen, der Zeitpunkt des Hemmungseintritts hier ungefähr mit demjenigen der Geburt zu-
sammenfallen dürfte.
Ich kann diesen Abschnitt nicht verlassen, ohne noch einen Ausdruck näher zu erklären, den ich
in Theil II*) gebraucht habe, und der zu Missdeutungen Veranlassung geben könnte, Wenn ich nemlich
dort gesagt habe, dass das Bindegewebe der Glaskörperanlage d e n M a s s e n d e r A u g e n k a p s e l a n g
e h ö r e , so wollte ich damit nichts anderes ausdrücken, als dass der Glaskörper von denjenigen Bindegewebs-
massen der Umgebung des Bulbus herstamme, die a u c h die Augenkapsel liefern.
Linse.
Die Linse zeigt ein individuell sehr wechselndes Verhalten.
Was ihre Grösse betrifft, so lässt sich zwar ganz im Allgemeinen der Grundsafeterkennen, dass
einem grossen Auge auch eine grosse Linse zukommt, es gibt aber von dieser Regel zahlreiche Ausnahmen.
Schon im embryonalen Leben kommt es gelegentlich vor, dass ein kleiner Embryo eine im Vor-,
haltmss zur Thierlänge grössere und höher entwickelte Linse besitzt, als ein grösserer und umgekehrt.
In noch viel höherem Maasse tritt diese Erscheinung aber bei den erwachsenen Thjeren hervor. Es ist
dabei in erster Linie, wie ja immer wieder, der Zeitpunkt der Entwicklungshemmung von Einfluss, doch
genügt m. E. dieses eine Moment hier nicht, um die grosse Verschiedenheit zu erklären. Kommen ja doch
bei erwachsenen Maulwürfen Linsen vor, die sich lediglich aus Zellen, fast ohne Spur einer Umbildung
derselben in Fasern, zusammensetzen, und die durch diesen B a u auf eine Stufe verwiesen werden, weit
niedriger, als diejenige, auf welcher die Linse vieler grossen Embryonen steht. Würde also zur Erklärung
bloss die Verschiedenheit des Zeitpunktes, an welchem die Hemmung eintrat, herbeigezogen, so müsste
diese in -extremen Fällen schon früh im embryonalen Leben angesetzt werden, was mit dem Verhalten
*) Th eü II pag. 57.
anderer Augentheile im Widerspruch stünde. Von Rückbildung kann hier, nach der Natur der Sache, keine
Rede sein, da man ja sonst annehmen müsste, dass dabei die Linse den Weg ihrer Entwicklung wieder
genau rückwärts zurückgelegt hätte. Sie müsste sich zunächst zellig angelegt, dann, wenigstens bis zu
einem gewissen Grade, Fasern entwickelt haben. Diese Fasern hätten sich nach erfolgter Hemmung und
eingesetztem Rückbildungsprocess nicht etwa aufzulösen begonnen, sondern wären wieder zu Zellen mit
rundlichen Kernen geworden etc., was ja absolut undenkbar ist.
Es handelt sich bei diesen „zelligen“ Linsen indessen um extreme Fälle*), die immerhin nur
sehr selten Vorkommen, und mag von ihrer Berücksichtigung darum hier v o r l ä u f i g abgesehen werden.
In der grossen Mehrzahl der Maulwurfsaugen zeigt die Linse deutlich die Wirkung einer Entwicklungshemmung,
die bei den einzelnen Individuen innerhalb eines Zeitraumes eingetreten ist, dessen
Grenzen einerseits gegen den Ausgang des Embryonallebens, andrerseits eine ziemliche Spanne nach erfolgter
Geburt anzusetzen sein mögen.
Spuren sehr früher Hemmung sind zu sehen in der mehr zellartigen Form der Linsenfasern und
dem zahlreicheren Vorkommen noch kaum veränderter Zellen in Nachbarschaft der Auswachsungsstelle.
Weiterhin deutet auf sehr früh sich bemerklich machende Hemmung hin: das Persistiren eines, freilich
stets nur geringen Restes der Linsenhöhle, die im Vergleich zur Linsentiefe bedeutende Stärke des Linsenepithels
und dessen Aufbau aus cylindrischen Elementen. In hohem Grade lässt auch die Lage der Auswachsungsstelle
einen Schluss zu auf den Zeitpunkt der Hemmung. Diese Stelle findet sich nemlich, wie
die Betrachtung der Entwicklungsreihe iehrt, auf niederer Embryonalstufe ganz in der Nähe des Linsen-
aequators, wenig proximal von diesem; im Verlaufe der Weiterentwicklung verschiebt sie sich dann immer
mehr proximalwärts. Eine dem Aequator sehr genäherte Auswachsungszone muss daher als Merkmal embryonalen
Verhaltens und Beweis für verhältnissmässig früh eingetretene Hemmung angesehen werden.
Ferner ist ein Zeichen nicht zu Stande gekommener Vollendung in dem Mangel einer Kernzone
zu sehen. Wie bei Betrachtung der einzelnen Embryonalstadien gezeigt wurde, kommt es in ein und derselben
Linse mehrmals zur Bildung einer solchen, die freilich niemals streng durchgeführt, aber immer unverkennbar
ist. Sie wird dann im Laufe der Entwicklung wieder zerstört. Findet sich nun in der Linse
eines ausgewachsenen Thieres die Andeutung einer Kernzone, was zuweilen der Fall ist, so berechtigt dies
nur zu dem Schlüsse, dass die Hemmung zu einer Zeit vollständig geworden ist, zu welcher die Linse gerade
eine Kernzone besessen hatte. Auf einen höheren Grad von Vollendung der Linse weist diese Thatsache
a ll- e in indessen nicht hin, da ja aus dem blossen Vorhandensein einer Kernzone nicht ersehen werden
kann, ob es sich dabei um den Endpunkt der Entwicklung, oder aber bloss um eines jener Durchgangsstadien
handelt. Es lässt sich also daraus allein nicht erkennen, ob eine Linse m i t Kernzone zu den
früher oder später gehemmten gehört.
Zeichen später eingetretener Störung, resp. weiterhin Sistirung, finden sich vor Allem in dem Bau
des Linsenepithels, das sich in vorgeschrittenen Fällen aus verhältnissmässig sehr dünnen Plattenzellen
zusammensetzen kann. Lässt sich nun zwar weder beim Embryo, noch beim Erwachsenen ein bestimmtes
Zahlenverhältniss zwischen Linsen epitheldicke und Linsentiefe constatiren, so ist doch die Thatsache erkennbar,
dass ein verhältnissmässig dickes Linsenepithel auf embryonalen Zustand,. ein schwaches auf höhere
Entwicklung der Linse hinweist.