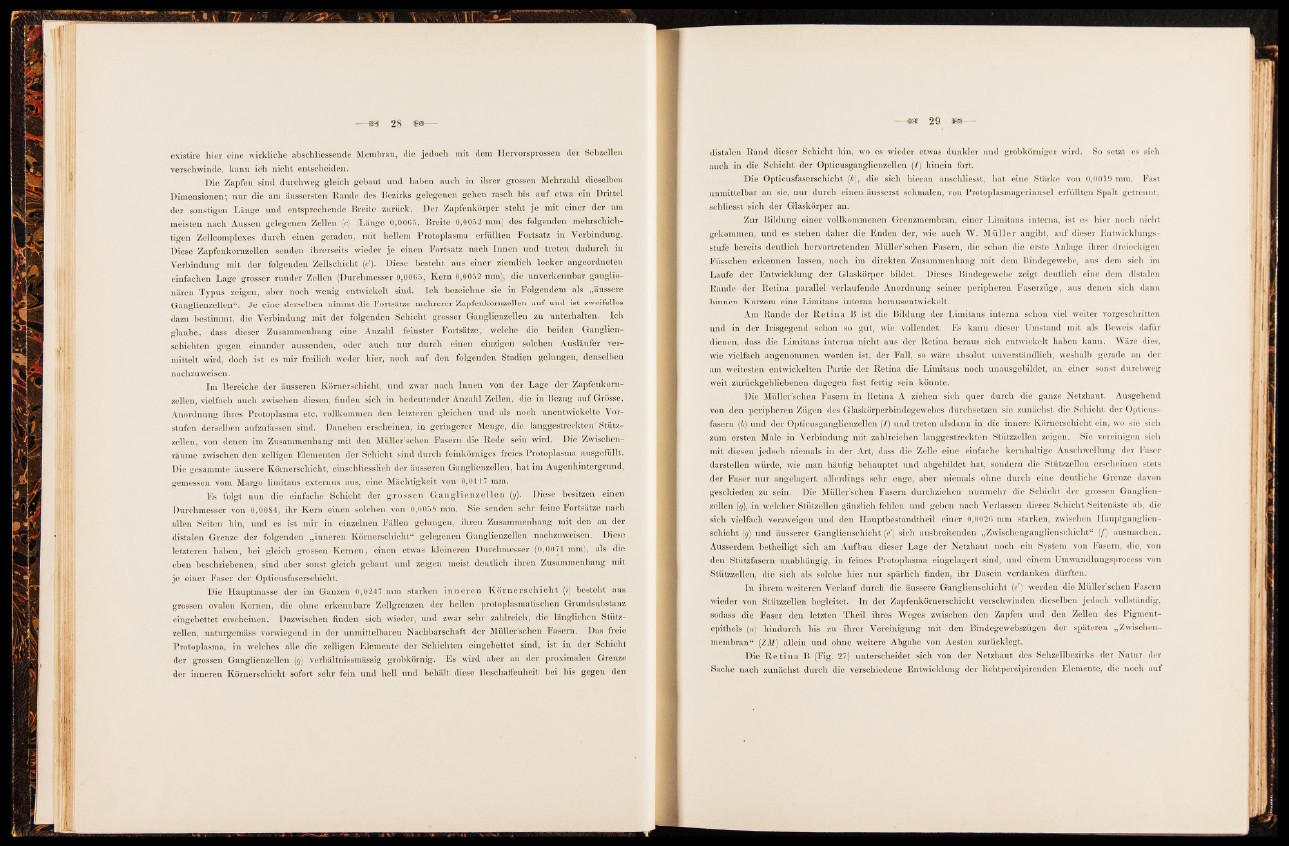
existire liier eine wirkliche abschliessende Membran, die jedoch mit dem Hervorsprossen der Sehzellen
verschwinde, kann ich nicht entscheiden.
Die Zapfen sind durchweg gleich gebaut und haben auch in ihrer grossen Mehrzahl dieselben
Dimensionen; n u r die am äussersten Rande des Bezirks gelegenen gehen rasch bis auf etwa ein Drittel
der sonstigen Länge und entsprechende Breite zurück. Der Zapfenkörper steht je mit einer der am
meisten nach Aussen gelegenen Zellen (cj (Länge 0,0065, Breite 0,0052 mm) des folgenden mehrschichtigen
Zellcomplexes durch einen geraden, mit hellem Protoplasma erfüllten Fortsatz in Verbindung.
Diese Zapfenkornzellen senden ihrerseits wieder je einen Fortsatz nach Innen und treten dadurch in
Verbindung mit der folgenden Zellschicht (e'). Diese besteht aus einer ziemlich locker angeordneten
einfachen Lage grösser runder Zellen (Durchmesser 0,0065, Kern 0,0052 mm), die unverkennbar ganglio-
nären Typus zeigen, aber noch wenig entwickelt sind. Ich bezeichne sie in Folgendem als „äussere
Ganglienzellen“. J e eine derselben nimmt die Fortsätze mehrerer Zapfenkornzellen auf und ist zweifellos
dazu bestimmt, die Verbindung mit der folgenden Schicht grösser Ganglienzellen zu unterhalten. Ich
glaube, dass dieser Zusammenhang eine Anzahl feinster Fortsätze, welche die beiden Ganglienschichten
gegen einander aussenden, oder auch n u r durch einen einzigen solchen Ausläufer vermittelt
wird, doch is t es mir freilich weder hier, noch auf den folgenden Stadien gelungen, denselben
nachzuweisen.
Im Bereiche der äusseren Körnerschicht, und zwar nach Innen von der Lage der Zapfenkornzellen,
vielfach auch zwischen diesen, finden sich in bedeutender Anzahl Zellen, die in Bezug auf Grösse,
Anordnung ihres Protoplasma etc. vollkommen den letzteren gleichen und als noch unentwickelte Vorstufen
derselben aufzufassen sind. Daneben erscheinen, in geringerer Menge, die langgestreckten Stützzellen,
von denen im Zusammenhang mit den Müller’schen Fasern die Rede sein wird. Die Zwischenräume
zwischen den zelligen Elementen der Schicht sind durch feinkörniges freies Protoplasma ausgefüllt.
Die gesammte äussere Kömerschicht, einschliesslich der äusseren Ganglienzellen, h a t im Augenhintergrund,
gemessen vom Margo limitans externus aus, eine Mächtigkeit von 0,0117 mm.
Es folgt nun die einfache Schicht der g ro s s e n G a n g l i e n z e l l e n (g). Diese besitzen einen
Durchmesser von 0,0084, ih r Kern einen solchen von 0,0058 mm. Sie senden sehr feine Fortsätze nach
allen Seiten hin, und es ist mir in einzelnen Fällen gelungen, ihren Zusammenhang mit den an der
distalen Grenze der folgenden „inneren Körnerschicht“ gelegenen Ganglienzellen nachzuweisen. Diese
letzteren haben, bei gleich grossen Kernen, einen etwas kleineren Durchmesser (0,0071 mm), als die
eben beschriebenen, sind aber sonst gleich gebaut un d zeigen meist deutlich ihren Zusammenhang mit
je einer Faser der Opticusfaserschicht.
Die Hauptmasse der im Ganzen 0,0247 mm starken in n e r e n K ö r n e r s c h i c h t (*) besteht aus
grossen ovalen Kernen, die ohne erkennbare Zellgrenzen der hellen protoplasmatischen Grundsubstanz
eingebettet erscheinen. Dazwischen finden sich wieder, und zwar sehr zahlreich, die länglichen Stützzellen,
naturgemäss vorwiegend in der unmittelbaren Nachbarschaft der Müller’schen Fasern. Das freie
Protoplasma, in welches alle die zelligen Elemente der Schichten eingebettet sind, ist in der Schicht
der grossen Ganglienzellen (g) verhältnissmässig grobkörnig. Es wird aber an der proximalen Grenze
der inneren Körnerschicht sofort sehr fein und h e ll und behält diese Beschaffenheit bei bis gegen den
--m 29 SSdistalen
Rand dieser Schicht hin, wo es wieder etwas dunkler und grobkörniger wird. So setzt es sich
auch in die Schicht der Opticusganglienzellen (1) hinein fort.
Die Opticusfaserschicht (1c), die sich hieran anschliesst, hat eine Stärke von 0,0039 mm. Fast
unmittelbar an sie, nur durch einen äusserst schmalen, von Protoplasmagerinnsel erfüllten Spalt getrennt,
schliesst sich der Glaskörper an.
Zur Bildung einer vollkommenen Grenzmembran, einer Limitans interna, ist es hier noch nicht
gekommen, und es stehen daher die Enden der, wie auch W. M ü lle r angibt, auf dieser Entwicklungsstufe
bereits deutlich hervortretenden Müller’schen Fasern, die schon die erste Anlage ihrer dreieckigen
Füsschen erkennen lassen, noch im direkten Zusammenhang mit dem Bindegewebe, aus dem sich im
Laufe der Entwicklung der Glaskörper bildet. Dieses Bindegewebe zeigt deutlich eine dem distalen
Rande der Retina parallel verlaufende Anordnung seiner peripheren Faserzüge, aus denen sich dann
binnen Kurzem eine Limitans interna herausentwickelt.
Am Rande der R e t in a B ist die Bildung der Limitans interna schon viel weiter vorgeschritten
und in der Irisgegend schon so gut, wie vollendet. Es kann dieser Umstand mit als Beweis dafür
dienen, dass die Limitans interna nicht aus der Retina heraus sich entwickelt haben kann. Wäre dies,
wie vielfach angenommen worden ist, der Fall, so wäre absolut unverständlich, weshalb gerade an der
am weitesten entwickelten Partie der Retina die Limitans noch unausgebildet, an einer sonst durchweg
weit zurückgebliebenen dagegen fast fertig sein könnte.
Die Müller’schen Fasern in Retina A ziehen sich quer durch die ganze Netzhaut. Ausgehend
von den peripheren Zügen des Glaskörperbindegewebes durchsetzen sie zunächst die Schicht der Opticusfasern
{k) und der Opticusganglienzellen [1) und treten alsdann in die innere Körnerschicht ein, wo sie sich
zum ersten Male in Verbindung mit zahlreichen langgestreckten Stützzellen zeigen. Sie vereinigen sich
mit diesen jedoch niemals in der Art, dass die Zelle eine einfache kernhaltige Anschwellung der Faser
darstellen würde, wie man häufig behauptet und abgebildet hat, sondern die Stützzellen erscheinen stets
der Faser nur angelagert, allerdings sehr enge, aber niemals ohne durch eine deutliche Grenze davon
geschieden zu sein. Die Müller’schen Fasern durchziehen nunmehr die Schicht der grossen Ganglienzellen
(g), in welcher Stützellen gänzlich fehlen und geben nach Verlassen dieser Schicht Seitenäste ab, die
sich vielfach verzweigen und den Hauptbestandtheil einer 0,0026 mm starken, zwischen Hauptganglienschicht
(g) und äusserer Ganglienschicht (ß’) sich ausbreitenden „Zwischenganglienschicht“ (f) ausmachen.
Ausserdem betheiligt sich am Aufbau dieser Lage der Netzhaut noch ein System von Fasern, die, von
den Stützfasern unabhängig, in feines Protoplasma eingelagert sind, und einem Umwandlungsprocess von
Stützzellen, die sich als solche hier nur spärlich finden, ih r Dasein verdanken dürften.
In ihrem weiteren Verlauf durch die äussere Ganglienschicht (er) werden die Müller’schen Fasern
wieder von Stützzellen begleitet. In der Zapfenkörnerschicht verschwinden dieselben jedoch vollständig,
sodass die Faser den letzten Theil ihres Weges zwischen den Zapfen und den Zellen des Pigmentepithels
(a) hindurch bis zu ihrer Vereinigung mit den Bindegewebszügen der späteren „Zwischenmembran“
(ZM) allein und ohne weitere Abgabe von Aesten zurücklegt.
Die R e t i n a B (Fig. 27) unterscheidet sich von der Netzhaut des Sehzellbezirks der Natur der
Sache nach zunächst durch die verschiedene Entwicklung der lichtpercipirenden Elemente, die noch auf