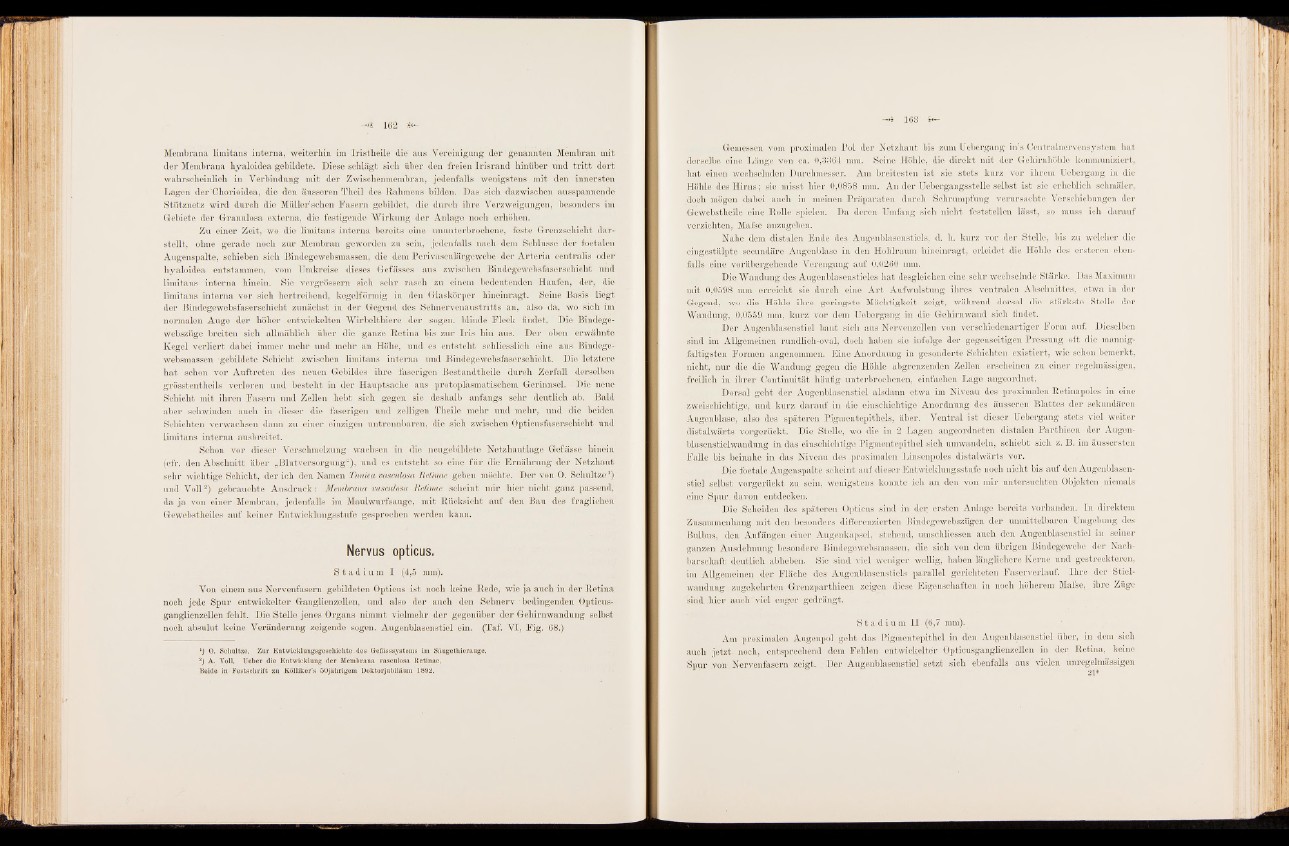
Membrana limitans inte rna , weiterhin im Iristh e ile die aus Vereinigung der genannten Membran mit
der Membrana hyaloidea gebildete. Diese schlägt sich über den freien Iris ra n d hinüber und t r i t t d o rt
wahrscheinlich in Verbindung m it der Zwischenmembran, jedenfalls wenigstens mit den innersten
Lagen der'Chorioidea, die den äusseren Theil des Rahmens bilden. Das sich dazwischen ausspannende
Stützne tz w ird durch die Müller’schen F a s ern gebildet, die durch ih re Verzweigungen, besonders im
Gebiete der Granulosa externa, die festigende W irk u n g der Anlage noch erhöhen.
Zu einer Zeit, wo die limitans in te rn a bereits eine ununterbrochene, feste Grenzschicht d a rstellt,
ohne gerade noch zur Membran geworden zu sein, jedenfalls nach dem Schlüsse der foetalen
Augenspalte, schieben sich Bindegewebsmassen, die dem Perivasculärgewebe der A rte ria centralis oder
hyaloidea entstammen, vom Umkreise dieses Gefässes aus zwischen Bindegewebsfaserschicht und
limitans in te rn a hinein. Sie vergrössern sich sehr rasch zu einem bedeutenden Haufen, der, die
limitans in te rn a vor sich hertreibend, kegelförmig in den Glaskörper hineinragt. Seine Basis liegt
der Bindegewebsfaserschicht zunächst in der Gegend des S eh n e rv en au stritts an, also da, wo sich im
normalen Auge der höher entwickelten W irb e lth ie re der sogen, blinde Fleck findet. Die Bindege-
websziige b reiten sich allmählich über die ganze R etin a bis z u r I r is hin aus. D e r oben erwähnte
Kegel v e rlie rt dabei immer mehr und mehr an Höhe, und es e n tsteh t schliesslich eine aus Bindegewebsmassen
gebildete Schicht zwischen limitans in te rn a und Bindegewebsfaserschicht. Die letztere
h a t schon v o r A u ftreten des neuen Gebildes ih re faserigen Bestandtheile durch Zerfall derselben
grösstentheils verloren und besteht in der Hauptsache aus protoplasmatischem Gerinnsel. Die neue
Schicht mit ihren F a se rn und Zellen hebt sich gegen sie deshalb anfangs sehr deutlich ab. Bald
aber schwinden auch in dieser die faserigen und zelligen Theile mehr und mehr, und die beiden
Schichten verwachsen dann zu einer einzigen untrennbaren, die sich zwischen Opticusfaserschicht Und
limitans in te rn a ausbreitet.
Schon vor dieser Verschmelzung wachsen in die neugebildete Netzhautlage Gefässe hinein
(cfr. den Abschnitt über „BlutVersorgung“), und es en tsteh t so eine fü r die E rn äh ru n g der N e tzhaut
s eh r wichtige Schicht, der ich den Namen Tunicci vciscülosa Retinae geben möchte. D e r von 0 . Sch u ltz e1)
und V o ll2) geb rauchte A u sd ru c k : Membrana vasculosa Retinae scheint mir h ie r nich t ganz passend,
da ja von einer Membran, jedenfalls im Maulwurfsauge, mit Rücksicht au f den Bau des fraglichen
Gewebstheiles auf keiner Entwicklungsstufe gesprochen werden kann.
Nervus opticus.
S t a d i u m I (4,5 mm).
Von einem aus Nervenfasern gebildeten Opticus is t noch keine Rede, wie ja auch in der R etin a
noch jede S p u r entwickelter Ganglienzellen, und also der auch den Sehnerv bedingenden Opticusganglienzellen
fehlt. Die Stelle jenes Organs nimmt vielmehr der gegenüber der Gehirnwandung selbst
noch absulut keine Veränderung zeigende sogen. Augenblasenstiel ein. (Taf. VI, Fig. 68.)
*) 0. Schnitze. Zur Entwicklungsgeschichte. des Gefässsystems im Säugethierauge.
2) A. Yoll. ’ Ueber die Entwicklung der Membrana vasculosa Retinae.
Beide in Festschrift zu Kölliker’s ÖOjährigem Doktorjubiläum 1892.
Gemessen vom proximalen Pol der Netzhaut bis zum TJelaergang in’s ( Zentralnervensystem h a t
derselbe eine Länge von ca. 0,3364 mm. Seine Höhle,, die d ire k t mit der Gehirnhöhle kommuniziert,
h a t einen wechselnden Durchmesser. Am breitesten is t sie s tets kurz vor ihrem Uebergang in die
Höhle des H irn s ; sie misst h ie r 0,0858 mm. An der Uebergangsstelle selbst is t sie erheblich schmäler,
doch mögen dabei auch in meinen P räp a ra te n durch Schrumpfung verursachte Verschiebungen der
Gewebstheile eine Rolle spielen. Da deren Umfang sich nicht feststellen lässt, so muss ich d arauf
verzichten, Mafse anzugeben.
Nahe dem distalen Ende des Augenblasenstiels, d. li. k u rz vor der Stelle, bis zu welcher die
eingestülpte secundäre Augcnblase in den Hohlraum hineinragt, erleidet die Höhle des ersteren ebenfalls
eine vorübergehende Verengung auf 0,0260 mm,.
Die W andung des Augenblasenstieles h a t desgleichen eine.sehr wechselnde Stärke. Das Maximum
mit 0,0598 mm e rre ich t sie durch eine A r t Aufwulstung ihres ventralen Abschnittes, etwa in der
Gegend, wo die Höhle ih re geringste Mächtigkeit zeigt, während dorsal die s tä rk s te Stelle der
Wandung, 0,0559 mm, k u rz vor dem Uebergang in die Gehirnwand sich findet.
D e r Augenblasenstiel b a u t sich aus Nervenzellen von verschiedenartiger Form auf. Dieselben
sind im Allgemeinen rundlich-oval, doch haben sie infolge der gegenseitigen Pressung oft die mannigfa
ltigsten Formen angenommen. Eine Anordnung in gesonderte Schichten existiert, wie schon bemerkt,
nicht, n u r die die Wandung gegen die Höhle abgrenzenden Zellen erscheinen zu einer regelmässigen,
freilich in ih re r Continuität häufig unterbrochenen, einfachen Lage angeordnet.
Dorsal g eh t der Augenblasenstiel alsdann e twa im Niveau des proximalen Retinapoles in eine
zweischichtige, und kurz d a rau f in die einschichtige Anordnung des äusseren B lattes der sekundären
Augenblase, also des späteren Pigmentepithels, über. V en tra l is t dieser Uebergang s tets viel weiter
dista lw ärts vorgerückt. Die Stelle, wo die in 2 Lagen angeordneten distalen P a rth ieen der Augenblasenstielwandung
in das einschichtige Pigmentepithel sich umwandeln, schiebt sich z. B. im äussersten
Fa lle bis beinahe in das Niveau des proximalen Linsenpoles dista lw ärts vor.
Die foetale Augenspalte scheint auf dieser E ntwicklungsstufe noch n ich t bis auf den Augenblasenstiel
selbst vorgerückt zu sein, wenigstens konnte ich an den von. mir untersuchten Objekten niemals
eine Spur, davon entdecken.
Die. Scheiden des späteren Opticus sind in d e r ersten Anlage bereits vorhanden. In direktem
Zusammenhang mit den besonders differenzierten Bindegewebsziigen der unmittelbaren Umgebung des
Bulbus, den Anfängen einer Augenkapsel, stehend, umschliessen auch den Augenblasenstiel in seiner
ganzen Ausdehnung besondere Bindegewebsmassen, die sich von dem übrigen Bindegewebe der Nachbarschaft
deutlich abheben. Sie sind viel weniger wellig, haben länglichere Kerne und gestreckteren,
im Allgemeinen der Fläche des Augenblasenstiels parallel gerichteten Faserverlauf. Ih r e der Stielwandung
zugekehrten Grenzparthieen zeigen diese Eigenschaften in noch höherem Mafse, ihre Züge
sind h ie r auch viel enger gedrängt.
S t a d i u m I I (6,7 mm).
Am proximalen Augenpol g eh t das Pigmentepithel in den Augenblasenstiel über, in dem sich
auch je tz t- noch, entsprechend dem Fehlen entwickelter Opticusganglienzellen in der Retina, keine
Spur von Nervenfasern zeigt. D e r Augenblasenstiel setz t sich ebenfalls aus vielen unregelmässigen
21*