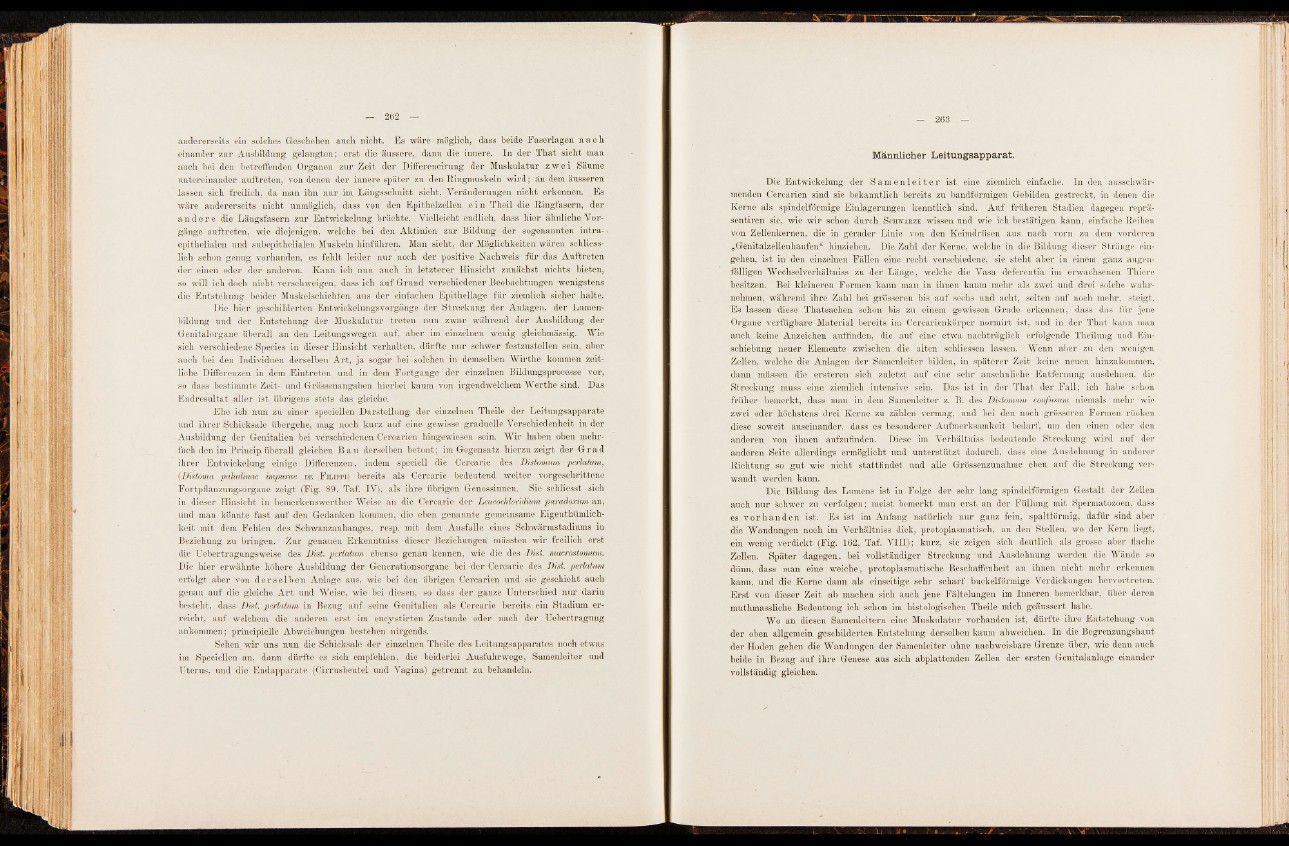
andererseits ein solches Geschehen auch nicht. E s wäre möglich, dass beide Faserlagen n a c h
einander zu r Ausbildung gelangten; e rs t die äussere, dann die innere. In der T h a t sieht man
auch bei den betreffenden Organen zu r Zeit der Differencirung der Muskulatur z w e i Säume
untereinander auftreten, von denen der innere sp äte r zu den Ringmuskeln w ird ; an dem äusseren
lassen sich freilich, da man ihn n u r im Längsschnitt sieht, Veränderungen nich t erkennen. Es
wäre andererseits n ich t unmöglich, dass von den Epithelzellen e i n Theil die Ringfasern, der
a n d e r e die Längsfasern zur Entwickelung brächte. Vielleicht endlich, dass h ie r ähnliche Vorgänge
auftre ten, wie diejenigen, welche bei den Aktinien zur Bildung der sogenannten in tr a epithelialen
und subepithelialen Muskeln hinführen. Man sieht, der Möglichkeiten wären schliesslich
schon genug vorhanden, es feh lt leider n u r noch der positive Nachweis fü r das A u ftreten
der einen oder der anderen. Kann ich nun auch in le tz te re r Hinsicht zunächst nichts bieten,
so will ich doch nicht verschweigen, dass ich auf Grund verschiedener Beobachtungen wenigstens
die Entsteh u n g beider Muskelschichten aus der einfachen Epithellage fü r ziemlich sicher halte.
Die h ie r geschilderten Entwickelungsvorgänge der Streckung der Anlagen, der Lumenbildung
und der En tsteh u n g der Muskulatur tre te n nun zw ar während der Ausbildung der
Genitalorgane übe ra ll an den Leitungswegen auf, aber im einzelnen wenig gleichmässig. Wie
sich verschiedene Species in dieser Hinsicht verhalten, d ü rfte n u r schwer festzustellen sein, aber
auch bei den Individuen derselben A rt, ja sogar bei solchen in demselben W irth e kommen zeitliche
Differenzen in dem E in tre ten und in dem F o rtg an g e der einzelnen Bildungsprocesse vor,
so dass bestimmte Zeit- und Grössenangaben hierbei kaum von irgendwelchem W e rth e sind. Das
E n d re su lta t aller is t übrigens s te ts das gleiche.
Eh e ich nun zu einer speciellen D a rstellu n g der einzelnen Theile der Leitungsapparate
und ih re r Schicksale übergehe, mag noch k u rz au f eine gewisse graduelle Verschiedenheit in der
Ausbildung der Genitalien bei verschiedenen Cercarien hingewiesen sein. W ir haben oben mehrfach
den im Princip überall gleichen B a u derselben b e to n t; im Gegensatz hierzu zeigt der G r a d
ih re r Entwickelung einige Differenzen, indem speciell die Cercarie des Distomuni perlatum,
(Distoma paludinae impurae de F ilippi) bereits als Cercarie bedeutend weiter vorgeschrittene
Fortpflanzungsorgane zeigt (Fig. 89, Taf. IV), als ih re übrigen Genossinnen. Sie schliesst sich
in dieser Hinsicht in bemerkenswertherWeise an die Cercarie der Leucochloridium paradoxum an,
und man könnte fa s t au f den Gedanken kommen, die eben genannte gemeinsame Eigenthlimlich-
k e it mit dem Fehlen des Schwanzanhanges, resp. mit dem Ausfälle eines Schwärmstadiums in
Beziehung zu bringen. Z u r genauen Erkenntniss dieser Beziehungen müssten wir freilich e rs t
die lieb e r tragungsweise des Di st. perlatum ebenso genau kennen, wie die des Dist. macrostonmm.
Die h ie r erwähnte höhere Ausbildung der Generationsorgane bei der Cercarie des Dist. perlatum
erfolgt aber von d e r s e l b e n Anlage aus, wie bei den übrigen Cercarien und sie geschieht auch
genau au f die gleiche A r t und Weise, wie bei diesen, so dass der ganze Unterschied n u r darin
besteht, dass Dist. perlatum in Bezug a u f seine Genitalien als Cercarie bereits ein Stadium e rreicht,
au f welchem die anderen e rs t im en cy s tirten Zustande oder nach der Uebertragung
ankommen; principielle Abweichungen bestehen nirgends.
Sehen w ir uns nun die Schicksale der einzelnen Theile des Le itungsapparates noch etwas
im Speciellen an, dann dürfte es sich empfehlen, die beiderlei Ausfuhrwege, Samenleiter und
Uterus, und die E ndapparate (Cirrusbeutel und Vagina) g e tre n n t zu behandeln.
Männlicher Leitungsapparat.
Die Entwickelung der S a m e n l e i t e r is t eine ziemlich einfache. In den ausschwärmenden
Cercarien sind sie bekanntlich bereits zu bandförmigen Gebilden gestreckt, in denen die
Kerne als spindelförmige Einlagerungen kenntlich sind. A u f früheren Stadien dagegen reprä-
sentiren sie, wie wir schon durch S chwarze wissen und wie ich bestätigen kann, einfache Reihen
von Zellenkernen, die in gérader Linie von den Keimdrüsen aus nach vorn zu dem vorderen
„Genitalzellenhaufen“ hinziehen. Die Zahl der Kerne, welche in die Bildung dieser Stränge ein-
gehen, is t in den einzelnen Fällen eine re ch t verschiedene, sie s teh t aber in einem ganz augenfälligen
Wechselverhältniss zu der L änge, welche die Vasa deferentia im erwachsenen Thiere
besitzen. Bei kleineren Formen k ann man in ihnen kaum mehr als zwei und drei solche wahrnehmen,
während ih re Zahl bei grösseren bis au f sechs und acht, selten auf noch mehr, steigt.
Es lassen diese Thatsachen schon bis zu einem gewissen Grade erkennen, dass das fü r jene
Organe verfügbare Material bereits im Cercarienkörper n o rm irt ist, und in der T h a t kann man
auch keine Anzeichen aufflnden, die au f eine etwa nachträglich erfolgende Theilung und Einschiebung
neuer Elemente zwischen die a lten schliessen lassen. Wenn aber zu den wenigen
Zellen, welche die Anlagen der Samenleiter bilden, in sp äte re r Zeit keine neuen hinzukommen,
dann müssen die e rsteren sich zuletzt au f eine sehr ansehnliche Entfernung ausdehnen, die
Streckung muss eine ziemlich intensive sein. Das is t in der T h a t der F a ll; ich habe schon
frü h e r bemerkt, dass man in dem Samenleiter z. B. des Distornimi confusimi niemals mehr wie
zwei oder höchstens drei Kerne zu zählen vermag, und bei den noch grösseren Formen rücken
diese soweit auseinander, dass es besonderer Aufmerksamkeit bedarf, um den einen oder den
anderen von ihnen aufzufinden. Diese im Verhältniss bedeutende Streckung wird au f der
anderen Seite allerdings ermöglicht und u n te rs tü tz t dadurch, dass eine Ausdehnung in anderer
Richtung so g u t wie nich t stattfin d e t und alle Grössenzunahme eben au f die Streckung verw
andt werden kann.
Die Bildung des Lumens is t i n . Folge der sehr lang spindelförmigen Gestalt der Zellen
auch n u r schwer zu verfolgen; meist bemerkt man e rs t an der Füllung mit Spermatozoeii, dass
es v o r h a n d e n ist. Es is t im Anfang n a tü rlich n u r ganz fein, spaltförmig, d a fü r sind aber
die Wandungen noch im Verhältniss dick, protoplasmatisch, an den Stellen, wo der Kern liegt,
ein wenig verdickt (Fig. 162, Taf. V III ); kurz, sie zeigen sich deutlich als grosse aber flache
Zellen. Sp ä te r dagegen, bei vollständiger Streckung 'u n d Ausdehnung werden die Wände so
dünn, dass man eine weiche, protoplasmatische Beschaffenheit an ihnen nicht mehr erkennen
kann, und die Kerne dann als einseitigè sehr scharf buckelförmige Verdickungen he rvortreten.
E r s t von dieser Zeit ab machen sich auch jene Fältelungen im Inneren bemerkbar, über, deren
muthmassliche Bedeutung ich schon im histologischen Theile mich geäussert habe.
Wo an diesen Samenleitern eine Muskulatur vorhanden ist, dürfte ih re Entstehung von
der oben allgemein geschilderten Entsteh u n g derselben kaum abweichen. In die Begrenzungshaut
der Hoden gehen die Wandungen der Samenleiter ohne nachweisbare Grenze über, wie denn auch
beide in Bezug au f ih re Genese aus sich abplattenden Zellen der ersten Genitalanlage einander
vollständig gleichen.