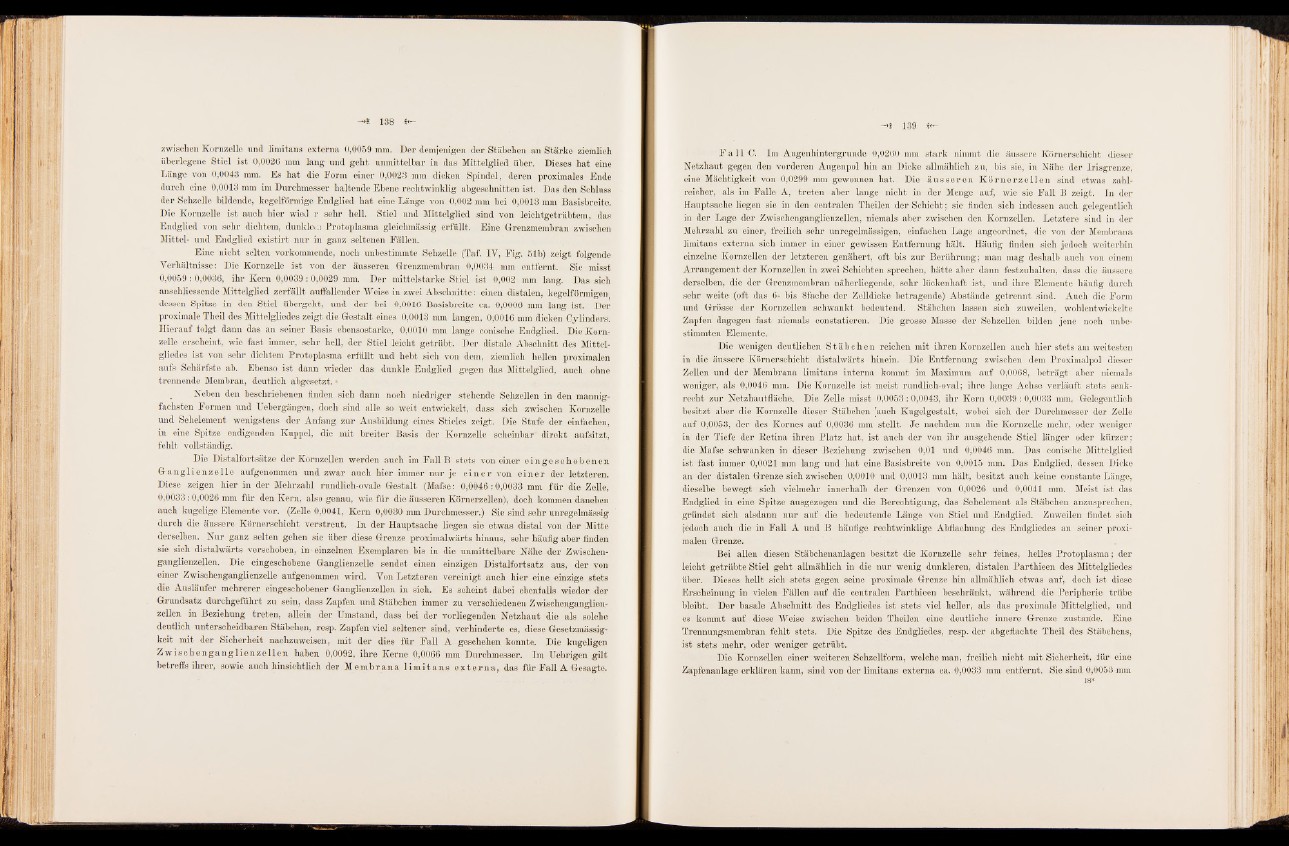
zwischen Kornzelle und limitans exte rna 0,0059 mm. D e r demjenigen der Stäbchen an S tä rk e ziemlich
überlegene S tiel is t 0,0026 mm lang und g eh t unmittelbar in das Mittelglied über. Dieses h a t eine
Länge von 0,0043 mm. Es h a t die Form einer 0,0023 mm dicken Spindel, deren proximales Ende
durch eine 0,0013 mm im Durchmesser haltende Ebene rechtwinklig abgeschnitten ist. Das den Schluss
d e r Sehzelle bildende, kegelförmige Endglied h a t eine Länge von 0,002 mm hei 0,0013 mm Basisbreite.
Die Kornzelle is t auch h ie r wieü r sehr hell. S tiel und Mittelglied sind von leichtgetrübtem, das
Endglied von sehr dichtem, dunkle*.i Protoplasma gleichmässig erfüllt. Eine Grenzmembran zwischen
Mittel- und Endglied e x is tirt n u r in ganz seltenen Fällen.
Eine nicht selten vorkommende, noch unbestimmte Sehzelle (Taf. IV, Fig. 51b) zeigt folgende
V erhältnisse: Die Kornzelle is t von der äusseren Grenzmembran 0,0034 mm entfernt. Sie misst
0,0059: 0,0036, ih r K e rn 0,0039:0,0029 mm. D e r m itte ls ta rk e S tiel is t 0,002 mm lang. Das sich
anschliessende Mittelglied z e rfä llt auffallender Weise in zwei Abschnitte: einen distalen, kegelförmigen
dessen Spitze in den S tie l übergeht, und der bei 0,0016 Basisbreite ca. 0,0006 mm lang ist. Der
proximale T heil des Mittelgliedes zeigt die G e sta lt eines 0,0013 mm langen, 0,0016 mm dicken Cylinders.
H ie rau f folgt dann das an seiner Basis ebensostarke, 0,0010 mm lange conische Endglied. Die K o rn zelle
erscheint, wie fa s t immer, sehr hell, der S tiel leicht g e trü b t. D e r distale Abschnitt des Mittelgliedes
is t von sehr dichtem Protoplasma e rfü llt und hebt sich von dem, ziemlich hellen proximalen
aufs Schärfste ab. Ebenso is t dann wieder das dunkle Endglied gegen das Mittelglied, auch ohne
trennende Membran, deutlich abgesetzt. *
Neben den beschriebenen finden sich dann noch niedriger stehende Sehzellen in den mannigfachsten
Formen und Uebergängen, doch sind alle so weit entwickelt, dass sich zwischen Kornzelle
und Sehelement wenigstens der Anfang z u r Ausbildung eines Stieles zeigt. Die Stufe der einfachen,
in eine Spitze endigenden Kuppel, die mit b re ite r Basis der Kornzelle scheinbar' d ire k t aufsitzt,
fehlt vollständig.
Die Distalfortsätze der Kornzellen werden auch im F a l lB s te ts von einer e i n g e s c h o b e n e n
G a n g l i e n z e l l e aufgenommen und zw ar auch h ie r immer n u r je e i n e r von e i n e r der letzteren.
Diese zeigen h ie r in der Mehrzahl rundlich-ovale G e sta lt (Mafse: 0,0046:0,0033 mm f ü r die Zelle,
0,0033 :0,0026 mm fü r den Kern, also genau, wie fü r die äusseren Körnerzellen), doch kommen daneben
auch kugelige Elemente vor. (Zelle 0,0041, K e rn 0,0030 mm Durchmesser.) Sie sind sehr unregelmässig
durch die äussere Körnerschicht v e rs tre u t. In d e r Hauptsache liegen sie etwas d is ta l von der Mitte
derselben. N u r ganz selten gehen sie über diese Grenze proximalwärts hinaus, seh r häufig aber finden
sie sich dis ta lw ärts verschoben, in einzelnen Exemplaren bis in die u nmittelbare Nähe der Zwischenganglienzellen.
Die eingeschobene Ganglienzelle sendet einen einzigen D is talfo rtsa tz aus, der von
einer Zwischenganglienzelle aufgenommen wird. Von Le tz te re n vereinigt auch h ie r eine einzige s tets
die Ausläufer mehrerer eingeschobener Ganglienzellen in sich. Es scheint dabei ebenfalls wieder der
Grundsatz durchgeführt zu sein, dass Zapfen und Stäbchen immer zu verschiedenen Zwischenganglienzellen
in Beziehung tre ten , allein der Umstand, dass bei der vorliegenden N e tzh au t die als solche
deutlich unterscheidbaren Stäbchen, resp. Zapfen viel seltener sind, ve rh in d e rte es, diese Gesetzmässigke
it mit der Sicherheit nachzuweisen, mit der dies fü r F a ll A. geschehen konnte. Die kugeligen
Z w i s c h e n g a n g l i e n z e l l e n haben 0,0092, ih re Kerne p,0066 mm Durchmesser. Im Uebrigen g ilt
betreffs ih re r, sowie auch hinsichtlich der M em b r a n a l im i t a n s e x t e r n a , das fü r F a ll A Gesagte.
F a l l C . Im Augenhintergrunde 0,0260 mra s ta rk nimmt die äussere Körnerschicht dieser
Netzhaut gegen den vorderen Augenpol hin an Dicke allmählich zu , bis sie, in Nähe der Irisgrenze,
eine Mächtigkeit von 0,0299 mm gewonnen ha t. Die ä u s s e r e n K ö r n e r z e l l e n sind etwas zahlreicher,
als im Fa lle A, tre te n aber lange nicht in der Menge auf, wie sie F a ll B zeigt. In der
Hauptsache liegen sie in den centralen Theilen der S ch ich t; sie finden sich indessen auch gelegentlich
in der Lage der Zwischenganglienzellen, niemals aber zwischen den Kornzellen. L e tz te re sind in der
Mehrzahl zu einer, freilich sehr unregelmässigen, einfachen Lage angeordnet, die von der Membrana
limitans externa sieb immer in einer gewissen Entfernung h ä lt. Häufig finden sich jedoch weiterhin
einzelne Kornzellen der le tz teren genähert, oft bis zu r Berührung; man mag deshalb auch von einem
A rrangement der Kornzellen in zwei Schichten sprechen, h ä tte aber dann festzuhalten, dass die äussere
derselben, die der Grenzmembran näberliegende, sehr lückenhaft ist, und ih re Elemente häufig durch
sehr weite (oft das 6- bis 8fache der Zelldicke betragende) Abstände g e tren n t sind. Auch die Form
und Grösse der Kornzellen schwankt bedeutend. Stäbchen lassen sich zuweilen, wohlentwickelte
Zapfen dagegen fa s t niemals constatieren. Die grosse Masse der Sehzellen bilden jene noch unbestimmten
Elemente.
Die wenigen deutlichen S t ä b c h e n reichen mit ih ren Kornzellen auch h ie r s tets am weitesten
in die äussere Körnerschicht d ista lw ärts hinein. Die Entfernung zwischen dem Proximalpol dieser
Zellen und der Membrana limitans in te rn a kommt im Maximum au f 0,0068, b e trä g t aber niemals
weniger, als 0,0046 mm. Die Kornzelle is t meist rundlicb-oval; ih re lange Achse v e rläu ft s tets senkre
c h t zu r Netzhautfläche. Die Zelle misst 0,0053 : 0,0043, ih r Kern 0,0039 : 0,0033 mm. Gelegentlich
besitzt aber die Kornzelle dieser Stäbchen [auch Kugelgestalt, wobei sich der Durchmesser der Zelle
auf 0,0053, der des Kornes au f 0,0036 mm stellt. J e nachdem nun die Kornzelle mehr, oder weniger
in der Tiefe der R etin a ih ren P la tz ha t, is t auch der von ih r ausgehende S tiel länger oder k ü rz e r;
die Mafse schwanken in dieser Beziehung zwischen 0,01 und 0,0046 mm. Das conische Mittelglied
is t fa s t immer 0,0021 mm lang und h a t eine Basisbreite von 0,0015 mm. Das Endglied, dessen Dicke
an der distalen Grenze sich zwischen 0,0010 und 0,0013 mm h ä lt, besitzt auch keine constante Länge,
dieselbe bewegt sich vielmehr innerhalb der Grenzen von 0,0026 und 0,0041 mm. Meist is t das
Endglied in eine Spitze ausgezogen und die Berechtigung, das Sehelement als Stäbchen anzusprechen,
grü n d e t sich alsdann n u r au f die bedeutende Länge von S tiel und Endglied. Zuweilen findet sich
jedoch auch die in F a ll A und B häufige rechtwinklige Abflachung des Endgliedes an seiner proximalen
Grenze.
Bei allen diesen Stäbchenanlagen besitzt die Kornzelle sehr feines, helles Protoplasma; der
leicht g e trü b te S tiel g eh t allmählich in die n u r wenig dunkleren, distalen P a rth ieen des Mittelgliedes
über. Dieses he llt sich: s tets gegen seine proximale Grenze hin allmählich etwas auf,, doch is t diese
Erscheinung in vielen Fällen au f die centralen P a rth ie en beschränkt, während die Peripherie trü b e
bleibt. D e r basale Abschnitt des Endgliedes is t stets viel heller, als das proximale Mittelglied, und
es kommt au f diese Weise zwischen beiden Theilen eine deutliche innere Grenze zustande. Eine
Trennungsmembran fehlt stets. Die Spitze des Endgliedes, resp. der abgeflachte Theil des Stäbchens,
is t s te ts mehr, oder weniger getrübt.
Die Kornzellen einer weiteren Sehzellform, welche man, freilich nich t mit Sicherheit, fü r eine
Zapfenanlage erklä ren kann, sind von der limitans exte rna ca. 0,0033 mm entfernt. Sie sind 0,0053 mm
18*