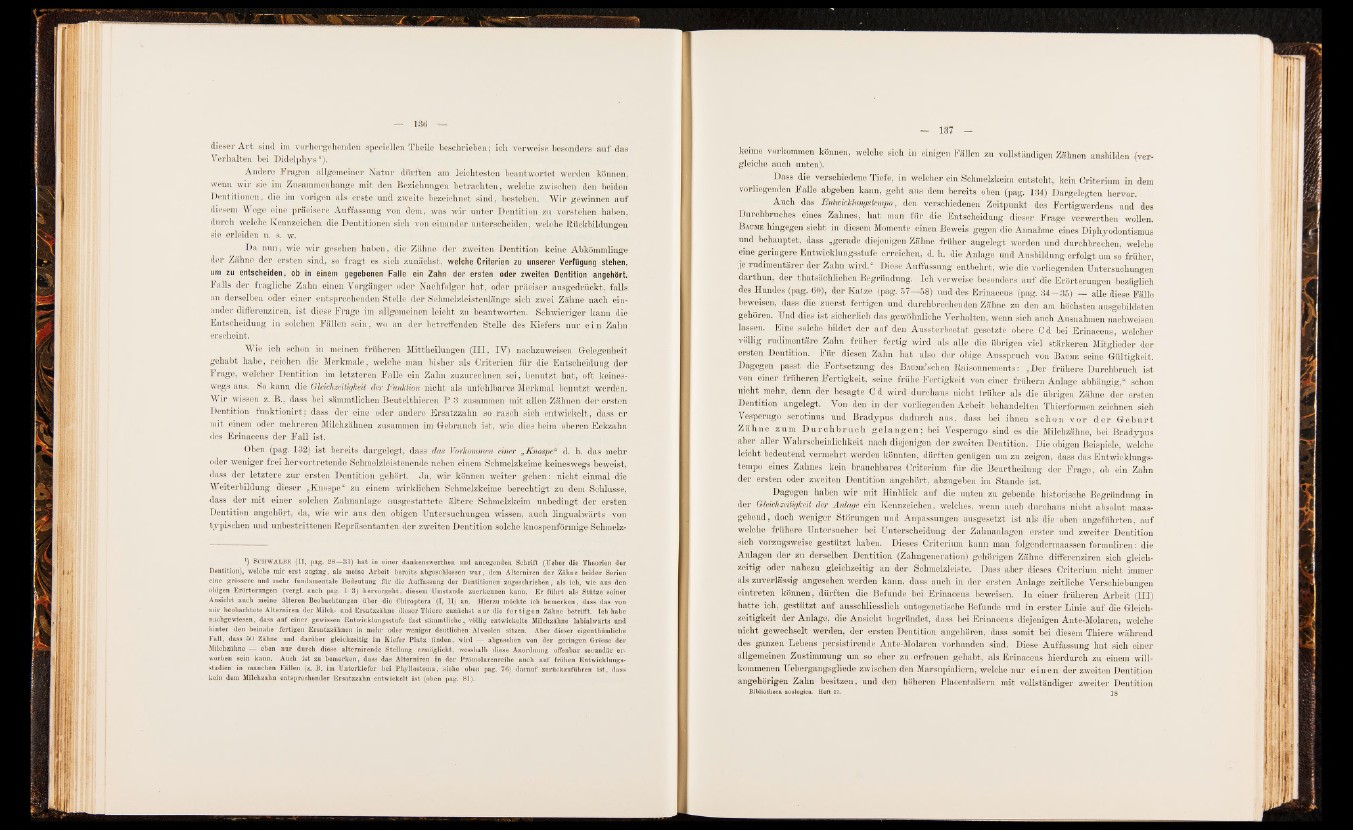
dieser Art sind im vorhergehenden speciellen Theile beschrieben; ich verweise besonders auf das
Verhalten bei Didelphys ’).
Andere Fragen allgemeiner Natur dürften am leichtesten beantwortet werden können,
wenn wir sie im Zusammenhänge mit den Beziehungen betrachten, welche zwischen den beiden
Dentitionen, die im vorigen als erste und zweite bezeichnet sind, bestehen. Wir gewinnen auf
diesem Wege eine präcisere Auffassung von dem, was wir unter Dentition zu verstehen haben,
durch welche Kennzeichen die Dentitionen sich von einander unterscheiden, welche Rückbildungen
sie erleiden u. s. w.
Da nun, wie wir gesehen haben, die Zähne der zweiten Dentition keine Abkömmlinge
der Zähne der ersten sind, so fragt es sich zunächst, welche Criterien zu unserer Verfügung stehen,
um zu entscheiden, ob in einem gegebenen Falle ein Zahn der ersten oder zweiten Dentition angehört.
Falls der fragliche Zahn einen Vorgänger oder Nachfolger hat, oder präciser ausgedrückt, falls
an derselben oder einer entsprechenden Stelle der Schmelzleistenlänge sich zwei Zähne nach einander
differenziren, ist diese Frage im allgemeinen leicht zu beantworten. Schwieriger kann die
Entscheidung in solchen Fällen sein, wo an der betreffenden Stelle des Kiefers nur e in Zahn
erscheint.
Wie ich schon in meinen früheren Mittheilungen (III, IV) nachzuweisen Gelegenheit
gehabt habe, reichen die Merkmale, welche man bisher als Criterien für die Entscheidung der
Frage, welcher Dentition im letzteren Falle ein Zahn zuzurechnen sei, benutzt hat, oft keineswegs
aus. So kann die Gleichzeitigkeit der Funktion nicht als unfehlbares Merkmal benutzt werden.
Wir wissen z. B., dass bei sämmtlichen Beutelthieren P 3 zusammen mit allen Zähnen der ersten
Dentition funktionirt; dass der eine oder andere Ersatzzahn so rasch sich entwickelt, dass er
mit einem oder mehreren Milchzähnen zusammen im Gebrauch ist, wie dies beim oberen Eckzahn
des Erinaceus der Fall ist.
Oben (pag. 132) ist bereits dargelegt, dass das Vorkommen einer „Knospe“ d. h. das mehr
oder weniger frei hervortretende Schmelzleistenende neben einem Schmelzkeime keineswegs beweist,
dass der letztere zur ersten Dentition gehört. Ja, wir können weiter gehen: nicht einmal die
Weiterbildung dieser „Knospe“ zu einem wirklichen Schmelzkeime berechtigt zu dem Schlüsse,
dass der mit einer solchen Zahnanlage ausgestattete ältere Schmelzkeim unbedingt der ersten
Dentition angehört, da, wie wir aus den obigen Untersuchungen wissen, auch lingualwärts von
typischen und unbestrittenen Repräsentanten der zweiten Dentition solche knospenförmige Schmelz?
’) Schwalbe (II, pag. 28—31) hat in einer dankenswerthen nnd anregenden Schrift (Ueber die Theorien der
Dentition), welche mir erst zuging, als meine Arbeit bereits abgeschlossen war, dem Alterniren der Zähne beider Serien
eine grössere und mehr fundamentale Bedeutung für die Auffassung der Dentitionen zugeschrieben, als ich, wie aus den
obigen Erörterungen (vergl. auch pag. 1 3 ) hervorgeht, diesem Umstande zuerkennen kann. Er führt als Stütze seiner
Ansicht auch meine älteren Beobachtungen über die Chiroptera (I, II) an. Hierzu möchte ich bemerken, dass das von
mir beobachtete Alterniren der Milch- und Ersatzzähne dieser Thiere zunächst nur die f e r t ig e n Zähne betrifft. Ich habe
nachgewiesen, dass auf einer gewissen Entwicklungsstufe fast sämmtliche, völlig entwickelte Milchzähne labialwärts und
hinter den beinahe fertigen Ersatzzähnen in mehr oder weniger deutlichen Alveolen sitzen. Aber dieser eigenthümliche
Fall, dass 50 Zähne und darüber gleichzeitig im Kiefer Platz finden, wird — abgesehen von der geringen Grösse der
Milchzähne ||||eb en nur durch diese alternirende Stellung ermöglicht, wesshalb diese Anordnung offenbar secundär erworben
sein kann. Auch ist zu bemerken, dass das Alterniren in der Prämolarenreihe auch auf frühen Entwicklungsstadien
in manchen Fällen (z. B. im Unterkiefer bei Phyllostöma, siehe oben pag. 76) darauf zurückzuführen ist, dass
kein dem Milchzahn entsprechender Ersatzzahn entwickelt ist (oben pag. 81).
keime Vorkommen können, welche sieh in einigen Fällen zu vollständigen Zähnen ausbilden (ver-
gleiche auch unten).
Dass die verschiedene Tiefe, in welcher ein Sehmelzkeim entsteht, kein Criterium in dem
vorliegenden Falle abgeben kann, geht ans dem bereits oben (pag. 134) Dargelegten hervor.
Anch das finkvichlungstempo, den verschiedenen Zeitpunkt des Fertigwerdens und des
Durchbruches eines Zahnes, hat man für die Entscheidung dieser Frage verwerthen wollen.
B aume hingegen sieht in diesem Momente einen Beweis gegen die Annahme eines Diphyodontismus
und behauptet, dass „gerade diejenigen Zähne früher angelegt werden und durehbrechen, welche
eine geringere Entwicklungsstufe erreichen, d. h. die Anlage und Ausbildung erfolgt um so früher,
je rudimentärer der Zahn wird.“ Diese Auffassung entbehrt, wie die vorliegenden Untersuchungen
darthun, der thatsächlichen Begründung. Ich verweise besonders auf die Erörterungen bezüglich
des Hundes (pag. 60), der Katze (pag. .57—58) und des Erinaceus (pag. 31 35) — alle diese Fälle
beweisen, daiss die'zuerst fertigen und durchbrechenden Zähne zu den am höchsten ausgebildeten
gehören. Und dies ist sicherlich das gewöhnliche Verhalten, wenn sich auch Ausnahmen nachweisen
lassen. Eine solche bildet der auf den Aussterbeetat gesetzte obere Cd bei Erinaceus, welcher
völlig rudimentäre Zahn früher fertig wird als alle die übrigen viel stärkeren Mitglieder der
ersten Dentition. Für diesen Zahn hat also der obige Ausspruoh von B aums seine Gültigkeit.
Dagegen passt die Fortsetzung des BAUME’schen Baisonnementsg^Der frühere Durchbruch ist
von einer früheren Fertigkeit, seine frühe Fertigkeit von einer frühem Anlage abhängig,“ schon
nicht mehr, denn der besagte Cd wird durchaus nicht früher als die übrigen Zähne der ersten
Dentition angelegt. Von den in der vorliegenden Arbeit behandelten Thierförmen zeichnen Sich
Vesperugo serotinus und Bradypus dadurch aus, dass- bei ihnen schon v o r d e r Gebu r t
Zähne zum Du r c h b ru c h gel angen; bei Vesperugo sind es die Milchzähne, bei Bradypus
aber aller Wahrscheinlichkeit nach diejenigen der zweiten Dentition. .Die obigen Beispiele, welche
leicht bedeutend vermehrt werden könnten, dürften genügen um zu zeigen, dass das Entwicklungstempo
eines Zahnes kein brauchbares Criterium für die Beurtheilnng der Frage, ob ein Zahn
d-er ersten oder zweiten Dentition angehört, abzugeben im Stande ist.
Dagegen haben wir mit Hinblick auf die unten zu gebende historische Begründung in
der Gleichzeitigkeit der Anlage ein Kennzeichen, welches, wenn auch durchaus nicht absolut maasgebend,
doch weniger Störungen und Anpassungen-ausgesetzt ist als die-oben-angeführten, auf
welche frühere Untersuoher bei Unterscheidung der Zahnanlägen. erster und zweiter Dentition
sidh vorzugsweise gestützt haben. Dieses- Criterium kann man fölgendermaassen formuliren: die
Anlagen der zu derselben Dentition (Zahngeneration) gehörigen Zähne differenziren sich gleichzeitig
oder nahezu gleichzeitig an der Schmelzleiste. Dass aber dieses Criterium nicht immer
als zuverlässig angesehen werden kann, dass auch in der ersten Anlage zeitliche Verschiebungen
eintreten können, dürften die Befunde bei Erinaceus beweisen. In einer früheren Arbeit (EU)
hatte ich, gestützt auf ausschliesslich ontogenetische Befunde und in erster Linie auf die .Gleichzeitigkeit
der Anlage, die Ansicht begründet, dass bei Erinaceus diejenigen Ante-Molaren, welche
nieht gewechselt werden, der ersten Dentition, angehören, dass somit bei diesem Thiere während
des ganzen Lebens persistirende Ante-Molaren vorhanden sind. Diese Auffassung hat sich einer
allgemeinen Zustimmung um so eher zu-erfreuen gehabt, als Erinaceus hierdurch zu einem willkommenen
Uebergangsgliede zwischen den Marsupialiero, welche nur ei nen der zweiten Dentition
angehörigen Zahn besitzen, und den höheren Plaoentaliern mit vollständiger zweiter Dentition
B ib lio th e c a zoologica. Heft 17. j g