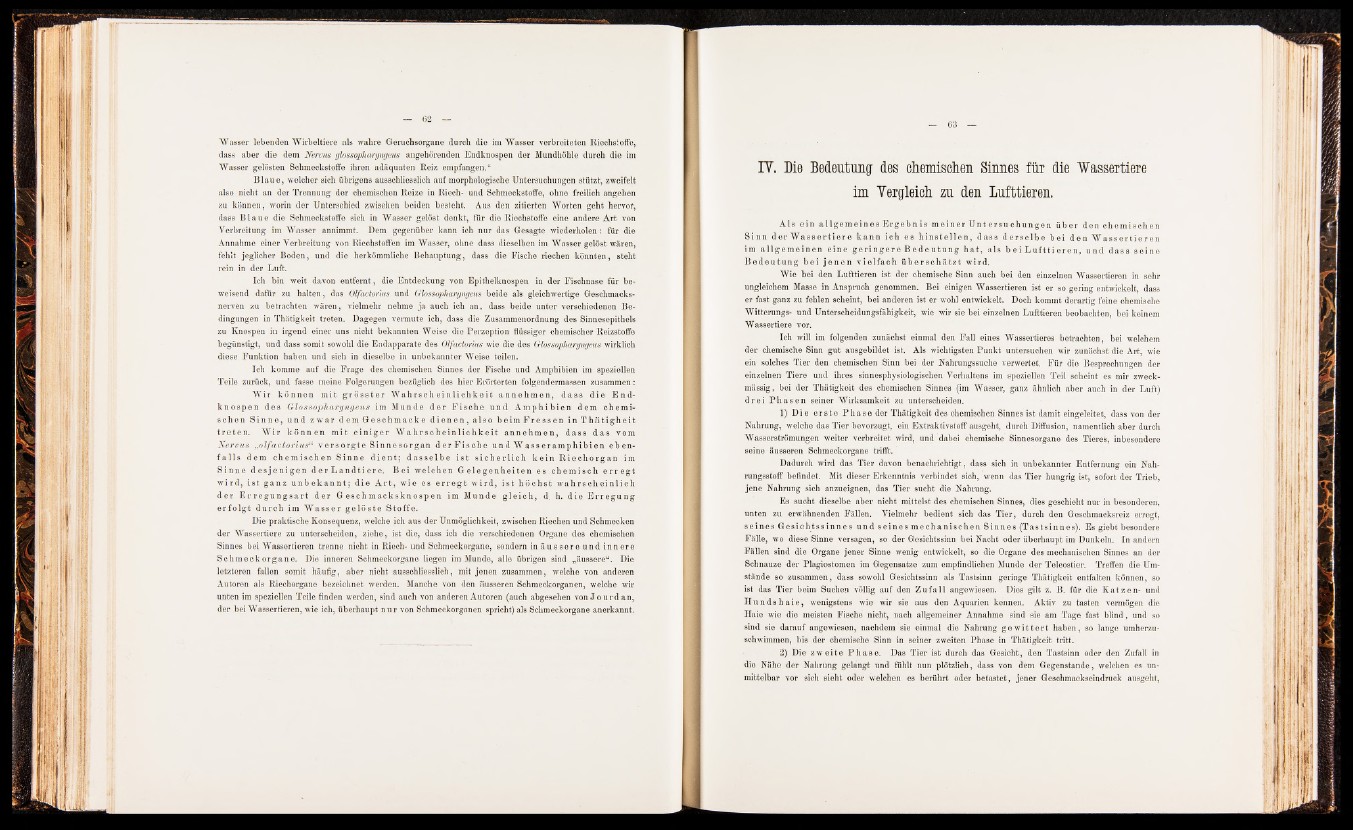
Wasser lebenden Wirbeltiere als wahre Geruchsorgane durch die im Wasser verbreiteten Riechstoffe,
dass aber die dem Nervus glossopharyngeus angehörenden Endknospen der Mundhöhle durch die im
Wasser gelösten Schmeckstoffe ihren adäquaten Reiz empfangen.“
Blaue, welcher sich übrigens ausschliesslich auf morphologische Untersuchungen stützt, zweifelt
also nicht an der Trennung der chemischen Reize in Riech- und Schmeckstoffe, ohne freilich angeben
zu können, worin der Unterschied zwischen beiden besteht. Aus den zitierten Worten geht hervof,
dass Blau e die Schmeckstoffe sich in Wasser gelöst denkt, für die Riechstoffe eine andere Art von
Verbreitung im Wasser annimmt. Dem gegenüber kann ich nur das Gesagte wiederholen: für die
Annahme einer Verbreitung von Riechstoffen im Wasser, ohne dass dieselben im Wasser gelöst wären,
fehlt jeglicher Boden, und die herkömmliche Behauptung, dass die Fische riechen könnten, steht
rein in der Luft.
Ich bin weit davon entfernt, die Entdeckung von Epithelknospen in der Fischnase für beweisend
dafür zu halten, das Olfactorius und Glossophciryngeus beide als gleichwertige Geschmacksnerven
zu betrachten wären, vielmehr nehme ja auch ich an, dass beide unter verschiedenen Bedingungen
in Thätigkeit treten. Dagegen vermute ich, dass die Zusammenordnung des Sinnesepithels
zu Knospen in irgend einer uns nicht bekannten Weise die Perzeption flüssiger chemischer Reizstoffe
begünstigt, und dass somit sowohl die Endapparate des Olfactorius wie die des Glossophciryngeus wirklich
diese Funktion haben und sich in dieselbe in unbekannter Weise teilen.
Ich komme auf die Frage des chemischen Sinnes der Fische und Amphibien im speziellen
Teile zurück, und fasse meine Folgerungen bezüglich des hier Erörterten folgendermassen zusammen:
Wir können mit g rö s s te r W a h r s c h e in lic h k e it an n ehm en , da ss d ie E n d kn
o sp en des Glossopharyngeus im Munde der F ische und. Am p h ib ien dem chemischen
S in n e , und zw a r dem G e schmacke d ie n e n , also b e im F re s s e n in T h ä tig h e i t
tre te n . Wir k ö n n e n mit e in ig e r W a h r s c h e in lic h k e it annehmen , dass d a s vom
Nervus „olfactorius“ v e rso rg te S in nesorgan d e r F isch e und W a s s e ram p h ib ie n ebenf
a lls dem chemischen Sinne d ie n t; d a s se lb e is t s ic h e rlic h k e in R ie c h o rg a n im
S in n e d e s je n ig e n d e r L a n d tie re . B e i welchen G e le g e n h e ite n es ch em isch e r r e g t
wird, ist ganz u n b e k a n n t; die A r t, wie cs e r re g t wird , is t h ö c h s t w a h rs c h e in lic h
d e r E r r e g u n g s a r t der G e s chm a ck sk n o sp en im Munde g le ic h , d. h. die E rre g u n g
e rfo lg t durch im W a s se r g e lö s te Stoffe.
Die praktische Konsequenz, welche ich aus der Unmöglichkeit, zwischen Riechen und Schmecken
der Wassertiere zu unterscheiden, ziehe, ist die, dass ich die verschiedenen Organe des chemischen
Sinnes bei Wassertieren trenne nicht in Riech- und Schmeckorgane, sondern in ä u s s e re und innere
Schmeckorgane. Die inneren Schmeckorgane liegen im Munde, alle übrigen sind „äussere“. Die
letzteren fallen somit häufig, aber nicht ausschliesslich, mit jenen zusammen, welche von anderen
Autoren als Riechorgane bezeichnet werden. Manche von den äusseren Schmeckorganen, welche wir
unten im speziellen Teile finden werden, sind auch von anderen Autoren (auch abgesehen von J o u r d an,
der bei Wassertieren, wie ich, überhaupt nur von Schmeckorganen spricht) als Schmeckorgane anerkannt.
IY. Die Bedeutung des chemischen Sinnes für die Wassertiere
im Yergleich zu den Lufttieren.
Als ein a llg em e in e s E rg e b n is meiner U n te rsu ch u n g e n ü b e r den chemischen
Sinn der W a s s e rtie re kann ich es h in s te lle n , dass d e rse lb e bei den W a s s e r tie re n
im a llg em e in en eine g e r in g e re B ede utung h a t, als b ei L u fttie r e n , und dass se in e
B ed eu tu n g b e i je n e n v ie lfa ch ü b e r s c h ä tz t wird.
Wie bei den Lufttieren ist der chemische Sinn auch bei den einzelnen Wassertieren in sehr
ungleichem Masse in Anspruch genommen. Bei einigen Wassertieren ist er so gering entwickelt, dass
er fast ganz zu fehlen scheint, bei anderen ist er wohl entwickelt. Doch kommt derartig feine chemische
Witterungs- und Unterscheidungsfähigkeit, wie wir sie bei einzelnen Lufttieren beobachten, bei keinem
Wassertiere vor.
Ich will im folgenden zunächst einmal den Fall eines Wassertieres betrachten, bei welchem
der chemische Sinn gut ausgebildet ist. Als wichtigsten Punkt untersuchen wir zunächst die Art, wie
ein solches Tier den chemischen Sinn bei der Nahrungssuche verwertet. Für die Besprechungen der
einzelnen Tiere und ihres sinnesphysiologischen Verhaltens im speziellen Teil scheint es mir zweckmässig,
bei der Thätigkeit des chemischen Sinnes (im Wasser, ganz ähnlich aber auch in der Luft)
d re i P h a s e n seiner Wirksamkeit zu unterscheiden.
1) Die e rs te P h a se der Thätigkeit des chemischen Sinnes ist damit eingeleitet, dass von der
Nahrung, welche das Tier bevorzugt, ein Extraktivstoff ausgeht, durch Diffusion, namentlich aber durch
Wasserströmungen weiter verbreitet wird, und dabei chemische Sinnesorgane des Tierefc, inbesondere
seine äusseren Schmeckorgane trifft.
Dadurch wird das Tier davon benachrichtigt, dass sich in unbekannter Entfernung ein Nahrungsstoff
befindet. Mit dieser Erkenntnis verbindet sich, wenn das Tier hungrig ist, sofort der Trieb,
jene Nahrung sich anzueignen, das Tier sucht die Nahrung.
Es sucht dieselbe aber nicht mittelst des chemischen Sinnes, dies geschieht nur in besonderen,
unten zu erwähnenden Fällen. Vielmehr bedient sich das Tier, durch den Geschmacksreiz erregt,
s e in e s G e s ich tssin n e s und se in e s mechanischen Sinnes (Tastsinnes). Es giebt besondere
Fälle, wo diese Sinne versagen, so der Gesichtssinn bei Nacht oder überhaupt im Dunkeln. In ändern
Fällen sind die Organe jener Sinne wenig entwickelt, so die Organe des mechanischen Sinnes an der
Schnauze der Plagiostomen im Gegensätze zum empfindlichen Munde der Teleostier. Treffen die Umstände
so zusammen, dass sowohl Gesichtssinn als Tastsinn geringe Thätigkeit entfalten können, so
ist das Tier beim Suchen völlig auf den Zufall angewiesen. Dies gilt z. B. für die Katzen- und
H u n d s h a ie , wenigstens wie wir sie aus den Aquarien kennen. Aktiv zu tasten vermögen die
Haie wie die meisten Fische nicht, nach allgemeiner Annahme sind sie am Tage fast blind, und so
sind sie darauf angewiesen, nachdem sie einmal die Nahrung g ew itte r t haben, so lange umherzuschwimmen,
bis der chemische Sinn in seiner zweiten Phase in Thätigkeit tritt.
2) Die zw e ite P h a se . Das Tier ist durch das Gesicht, den Tastsinn oder den Zufall in
die Nähe der Nahrung gelangt und fühlt nun plötzlich, dass von dem Gegenstände, welchen es unmittelbar
vor sich sieht oder welchen es berührt oder betastet, jener Geschmackseindruck ausgeht,