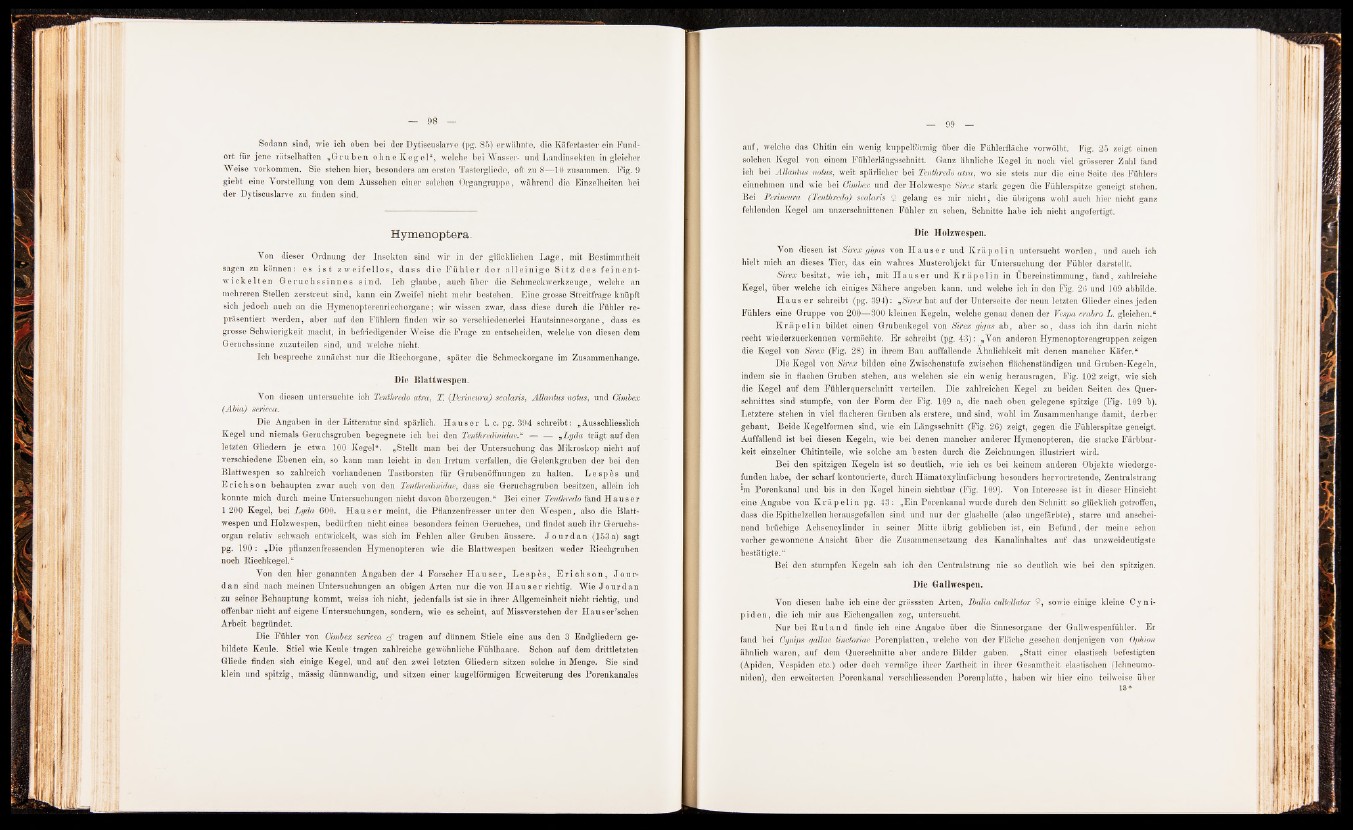
Sodann sind, wie ich oben bei der Dytiscuslarve (pg. 85) erwähnte, die Käfertaster ein Fundort
für jene rätselhaften „Gruben ohne K eg e l“, welche bei Wasser- und Landinsekten in gleicher
Weise Vorkommen. Sie stehen hier, besonders am ersten Tastergliede, oft zu 8—10 zusammen. P ig -t
giebt eine Vorstellung von dem Aussehen einer solchen Organgruppe, während die Einzelheiten bei
der Dytiscuslarve zu finden sind.
H ym en o p te ra .
Von dieser Ordnung der Insekten sind wir in der glücklichen Lage, mit Bestimmtheit
sagen zu können: es i s t zw e ife llo s, dass die F ü h le r d e r a lle in ig e S itz des f e in e n tw
ic k e lte n G e ru ch ss in n e s sind. Ich glaube, auch über die Schmeckwerkzeuge, welche an
mehreren Stellen zerstreut sind, kann ein Zweifel nicht mehr bestehen. Eine grosse Streitfrage knüpft
sich jedoch auch an die Hymenopterenriechorgane; wir wissen zwar, dass diese durch die Fühler repräsentiert
werden, aber auf den Fühlern finden wir so verschiedenerlei Hautsinnesorgane, dass es
grosse Schwierigkeit macht, in befriedigender Weise die Frage zu entscheiden, welche von diesen dem
Geruchssinne zuzuteilen sind, und welche nicht.
Ich bespreche zunächst nur die Riechorgane, später die Schmeckorgane im Zusammenhänge.
Die Blattwespen.
Von diesen untersuchte ich Tenthredo atra, T. (Perineum) scdlaris, ATlantus notus, und Gimbex
(Äbia) sericea.
Die Angaben in der Litteratur sind spärlich. H au s e r l.jc. pg. 394 schreibt: „Ausschliesslich
Kegel und niemals Geruchsgruben begegnete ich bei den Tenthredinidae.“ — »Lyda trägt auf den
letzten Gliedern je etwa 100 Kegel“. „Stellt man bei der Untersuchung das Mikroskop nicht auf
verschiedene Ebenen ein, so kann man leicht in den Irrtum verfallen, die Gelenkgruben der bei den
Blattwespen so zahlreich vorhandenen Tastborsten für Grubenöffnungen zu halten. L esp e s und
E rich so n behaupten zwar auch von den Tenthredinidae, dass sie Geruchsgruben besitzen, allein ich
konnte mich durch meine Untersuchungen nicht davon überzeugen.“ Bei einer Tenthredo fand H au se r
1 200 Kegel, bei Lyda 600. H a u s e r meint, die Pflanzenfresser unter den Wespen, also die Blattwespen
und Holzwespen, bedürften nicht eines besonders feinen Geruches, und findet auch ihr Geruchsorgan
relativ schwach entwickelt, was sich im Fehlen aller Gruben äussere. J o u rd a n (153a) sagt
pg. 190: »Die pflanzenfressenden Hymenopteren wie die Blattwespen besitzen weder Riechgruben
noch Riechkegel.“
Von den hier genannten Angaben der 4 Forscher H a u s e r, Lesp&s, E r ic h s o n , Jo u r dan
sind nach meinen Untersuchungen an obigen Arten nur die von H au s e r richtig. Wie Jo u rd an
zu seiner Behauptung kommt, weiss ich nicht, jedenfalls ist sie in ihrer Allgemeinheit nicht richtig, und
offenbar nicht auf eigene Untersuchungen, sondern, wie es scheint, auf Missverstehen der Hauser'schen
Arbeit begründet.
Die Fühler von Gimbex sericea cf tragen auf dünnem Stiele eine aus den 3 Endgliedern gebildete
Keule. Stiel wie Keule tragen zahlreiche gewöhnliche Fühlhaare. Schon auf dem drittletzten
Gliede finden sich einige Kegel, und auf den zwei letzten Gliedern sitzen solche in Menge. Sie sind
klein und spitzig, mässig dünnwandig, und sitzen einer kugelförmigen Erweiterung des Porenkanales
auf, welche das Chitin ein wenig kuppelförmig über die Fühlerfläche vorwölbt. Fig. 25 zeigt einen
solchen Kegel von einem Fühlerlängsschnitt. Ganz ähnliche Kegel in noch viel grösserer Zahl fand
ich bei ATlantus notus, weit spärlicher bei tenthredo atra, wo sie stets nur die eine Seite des Fühlers
einnehmen und wie bei Gimbex und der Holzwespe Sirex stark gegen die Fühlerspitze geneigt stehen.
Bei Perineum (Tenthredo) scalaris $ gelang es mir nicht, die übrigens wohl auch hier nicht ganz
fehlenden Kegel am unzerschnittenen Fühler zu sehen, Schnitte habe ich nicht angefertigt.
Die Holzwespen.
Von diesen ist Sirex gigas von H a u s e r und K rä p e lin untersucht worden, und auch ich
hielt mich an dieses Tier, das ein wahres Musterobjekt für Untersuchung der Fühler darstellt.
Sirex besitzt, wie ich, mit H a u s e r und K rä p e lin in Übereinstimmung, fand, zahlreiche
Kegel, über welche ich einiges Nähere angeben kann, und welche ich in den Fig. 20 und 109 abbilde.
H a u s e r schreibt (pg. 394): »Sirex hat auf der Unterseite der neun letzten Glieder eines jeden
Fühlers eine Gruppe von 200—300 kleinen Kegeln, welche genau denen der Vespa crabro L. gleichen.“
K rä p e lin bildet einen Grubenkegel von Sirex gigas ab, aber so, dass ich ihn darin nicht
recht wiederzuerkennen vermöchte. Er schreibt (pg. 43): „Von anderen Hymenopterengruppen zeigen
die Kegel von Sirex (Fig. 28) in ihrem Bau auffallende Ähnlichkeit mit denen mancher Käfer.“
Die Kegel von Sirex bilden eine Zwischenstufe zwischen flächenständigen und Gruben-Kegeln,
indem sie in flachen Gruben stehen, aus welchen sie ein wenig herausragen. Fig. 102 zeigt, wie sich
die Kegel auf dem Fühlerquerschnitt verteilen. Die zahlreichen Kegel zu beiden Seiten des Querschnittes
sind stumpfe, von der Form der Fig. 109 a, die nach oben gelegene spitzige (Fig. 109 b).
Letztere stehen in viel flacheren Gruben als erstere, und sind, wohl im Zusammenhänge damit, derber
gebaut. Beide Kegelformen sind, wie ein Längsschnitt (Fig. 26) zeigt, gegen die Fühlerspitze geneigt.
Auffallend ist bei diesen Kegeln, wie bei denen mancher anderer Hymenopteren, die starke Färbbarkeit
einzelner Chitinteile, wie solche am besten durch die Zeichnungen illustriert wird.
Bei den spitzigen Kegeln ist so deutlich, wie ich es bei keinem anderen Objekte wiedergefunden
habe, der scharf kontourierte, durch Hämatoxylinfärbung besonders hervortretende, Zentralstrang
hn Porenkanal und bis in den Kegel hinein sichtbar (Fig. 109). Von Interesse ist in dieser Hinsicht
eine Angabe von K rä p e lin pg. 43: „Ein Porenkanal wurde durch den Schnitt so glücklich getroffen,
dass die Epithelzellen herausgefallen sind und nur der glashelle (also ungefärbte), starre und anscheinend
brüchige Achsencylinder in seiner Mitte übrig geblieben ist, ein Befund, der meine schon
vorher gewonnene Ansicht über die Zusammensetzung des Kanalinhaltes auf das unzweideutigste
bestätigte. “
Bei den stumpfen Kegeln sah ich den Centralstrang nie so deutlich wie bei den spitzigen.
Die Gallwespen.
Von diesen habe ich eine der grösssten Arten, Ibalia cultellator $, sowie einige kleine Cyni-
p iden, die ich mir aus Eichengallen zog, untersucht.
Nur bei R u la n d finde ich eine Angabe über die Sinnesorgane der Gallwespenfühler. Er
fand bei Gynips gallae tinctoriae Porenplatten, welche von der Fläche gesehen denjenigen von Ophion
ähnlich waren, auf dem Querschnitte aber andere Bilder gaben. „Statt einer elastisch befestigten
(Apiden, Vespiden etc.) oder doch vermöge ihrer Zartheit in ihrer Gesamtheit elastischen (Ichneumo-
niden), den erweiterten Porenkanal verschliessenden Porenplatte, haben wir hier eine teilweise über
13*