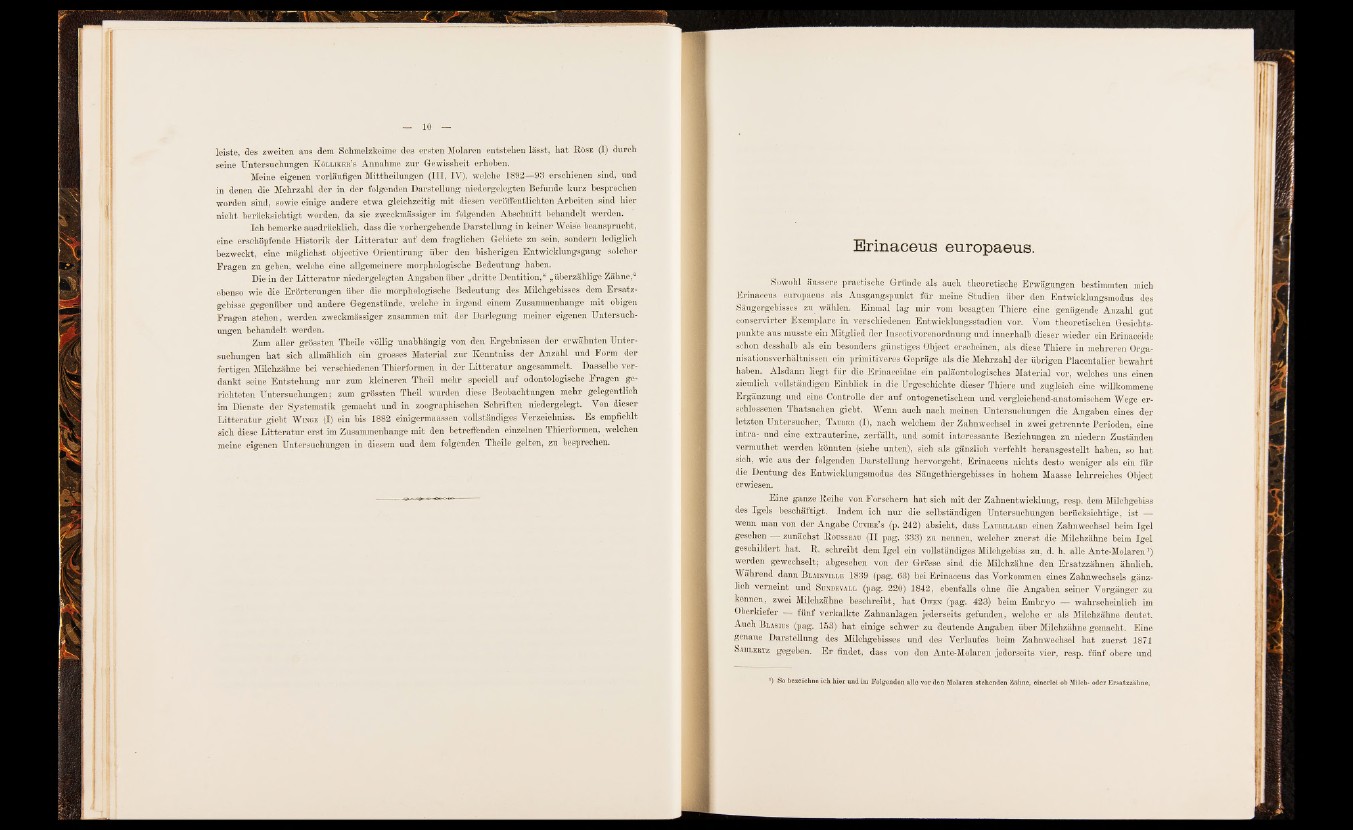
leiste, des zweiten aus dem Schmelzkeime des ersten Molaren entstehen lässt, hat R öse (I) durch
seine Untersuchungen K ölliker’s Annahme zur Gewissheit erhoben.
Meine eigenen vorläufigen Mittheilungen (III, IV), welche 1892—93 erschienen sind, und
in denen die Mehrzahl der in der folgenden Darstellung niedergelegten Befunde kurz besprochen
worden sind, sowie einige andere etwa gleichzeitig mit diesen veröffentlichten Arbeiten sind hier
nicht berücksichtigt worden, da sie zweckmässiger im folgenden Abschnitt behandelt werden.
Ich bemerke ausdrücklich, dass die vorhergehende Darstellung in keiner Weise beansprucht,
eine erschöpfende Historik der Litteratur auf dem fraglichen Gebiete zu sein, sondern lediglich
bezweckt, eine möglichst objective Orientirung über den bisherigen Entwicklungsgang solcher
Fragen zu geben, welche eine allgemeinere morphologische Bedeutung haben.
Die in der Litteratur niedergelegten Angaben über „dritte Dentition,“ „überzählige Zähne,“
ebenso wie die Erörterungen über die morphologische Bedeutung des Milchgebisses dem Ersatzgebisse
gegenüber und andere Gegenstände, welche in irgend einem Zusammenhänge mit obigen
Fragen stehen, werden zweckmässiger zusammen mit der Darlegung meiner eigenen Untersuchungen
behandelt werden.
Zum aller grössten Theile völlig unabhängig von den Ergebnissen der erwähnten Untersuchungen
hat sich allmählich ein grosses Material zur Kenntniss der Anzahl und Form der
fertigen Milchzähne bei verschiedenen Thierformen in der Litteratur angesammelt. Dasselbe verdankt
seine Entstehung nur zum kleineren Theil mehr speciell auf odontologische Fragen gerichteten
Untersuchungen; zum grössten Theil wurden diese Beobachtungen mehr gelegentlich
im Dienste der Systematik gemacht und in zoographischen Schriften niedergelegt. Von dieser
Litteratur giebt W inge (I) ein bis 188 2 einigermaassen vollständiges Verzeichniss. Es empfiehlt
sich diese Litteratur erst im Zusammenhänge mit den betreffenden einzelnen Thierformen, welchen
meine eigenen Untersuchungen in diesem und dem folgenden Theile gelten, zu besprechen.
Erinaceus europaeus.
Sowohl äussere practische Gründe als auch theoretische Erwägungen bestimmten mich
Erinaceus europaeus als Ausgangspunkt für meine Studien über den Entwicklungsmodus des
Säugergebisses zu wählen. Einmal lag mir vom besagten Thiere eine genügende Anzahl gut
conservirter Exemplare in verschiedenen Entwicklungsstadien vor. Vom theoretischen Gesichtspunkte
aus musste ein Mitglied der Insectivorenordnung und innerhalb dieser wieder ein Erinaceide
schon desshalb als ein besonders günstiges Object erscheinen, als diese Thiere in mehreren Organisationsverhältnissen
ein primitiveres Gepräge als die Mehrzahl der übrigen Placentalier bewahrt
haben. Alsdann liegt für die Erinaceidae ein paläontologisches Material vor, welches uns einen
ziemlich vollständigen Einblick in die Urgeschichte dieser Thiere und zugleich eine willkommene
Ergänzung und eine Controlle der auf ontogenetischem und vergleichend-anatomischem Wege erschlossenen
Thatsachen giebt. Wenn auch nach meinen Untersuchungen die Angaben eines der
letzten Untersucher, T auber (I), nach welchem der Zahnwechsel in zwei getrennte Perioden, eine
intra- und eine extrauterine, zerfällt, und somit interessante Beziehungen zu niedern Zuständen
vermuthet werden könnten (siehe unten), sich als gänzlich verfehlt herausgestellt haben, so hat
sich, wie aus der folgenden Darstellung hervorgeht, Erinaceus nichts desto weniger als ein für
die Deutung des Entwicklungsmodus des Säugethiergebisses in hohem Maasse lehrreiches Object
erwiesen.
Eine ganze Reihe von Forschern hat sich mit der Zahnentwicklung, resp. dem Milchgebiss
des Igels beschäftigt. Indem ich nur die selbständigen Untersuchungen berücksichtige, ist 9
wenn man von der Angabe Cuvier’s (p. 242) absieht, dass L aurillard einen Zahnwechsel beim Igel
gesehen zunächst R ousseau (II pag. 333) zu nennen, welcher zuerst die Milchzähne beim Igel
geschildert hat. R. schreibt dem Igel ein vollständiges Milchgebiss zu, d. h. alle Ante-Molaren *)
werden gewechselt; abgesehen von der Grösse sind die Milchzähne den Ersatzzähnen ähnlich.
Während dann B lainville 1839 (pag. 63) bei Erinaceus das Vorkommen eines Zahnwechsels gänzlich
verneint und Sundevall (pag. 220) 1842, ebenfalls ohne die Angaben seiner Vorgänger zu
kennen, zwei Milchzähne beschreibt, hat Owen (pag. 423) beim Embryo^- wahrscheinlich im
Oberkiefer — fünf verkalkte Zahnanlagen jederseits gefunden, welche er als Milchzähne deutet.
Auch B lasius (pag. 153) hat einige schwer zu deutende Angaben über Milchzähne gemacht. Eine
genaue Darstellung des Milchgebisses und des Verlaufes beim Zahnwechsel hat zuerst 1871
Sahlertz gegeben. Er findet, dass von den Ante-Molaren jederseits vier, resp. fünf obere und
J) So bezeichne ich hier und im Folgenden alle vor den Molaren stehenden Zähne, einerlei ob Milch- oder Ersatzzähne.