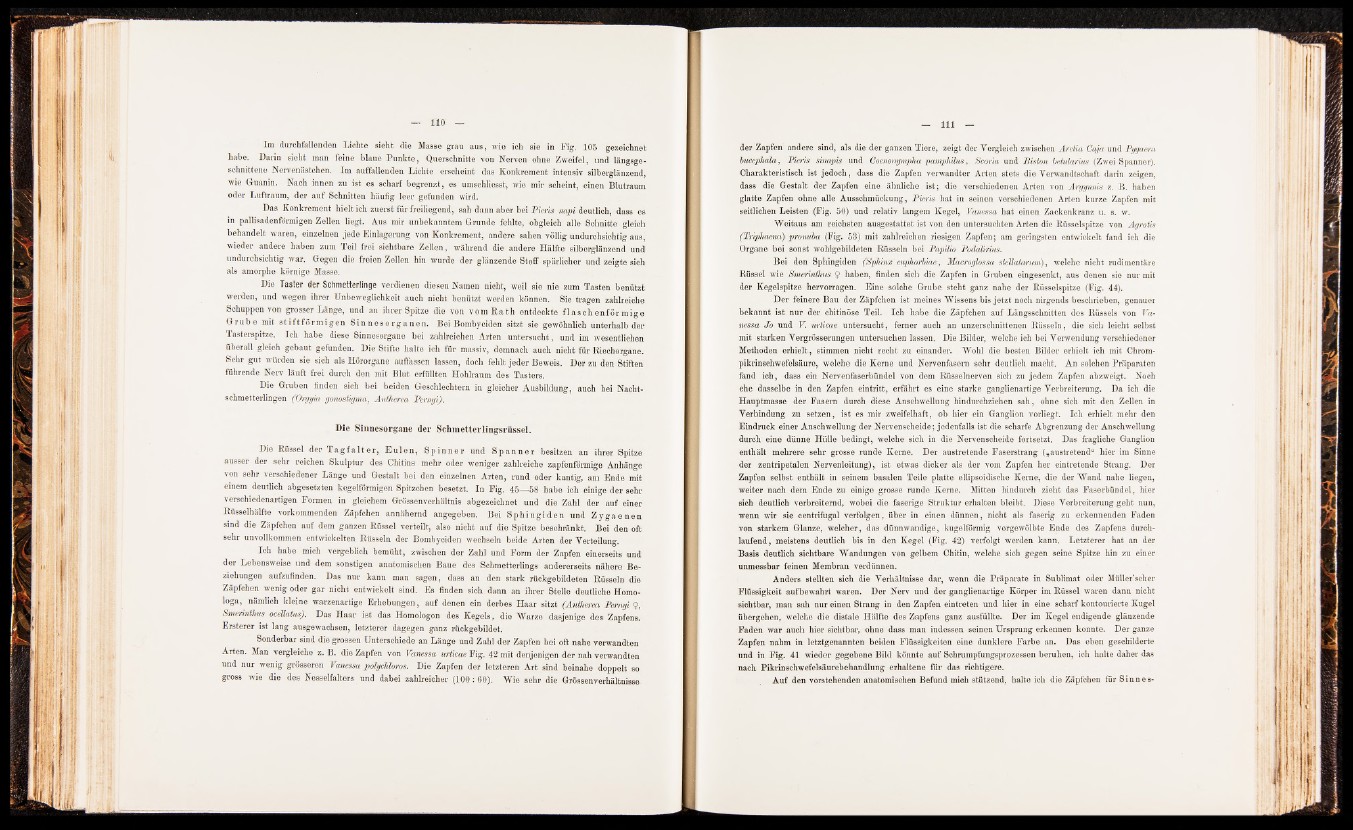
Im durchfallenden Lichte sieht die Masse grau aus, wie ich sie in Fig. 105 gezeichnet
habe. Darin sieht man feine blaue Punkte, Querschnitte von Nerven ohne Zweifel, und längsgeschnittene
Nervenästchen. Im auffallenden Lichte erscheint das Konkrement intensiv silberglänzend,
wie Guanin. Nach innen zu ist es scharf begrenzt, es umschliesst, wie mir scheint, einen Blutraum
oder Luftraum, der auf Schnitten häufig leer gefunden wird.
Das Konkrement hielt ich zuerst für freiliegend, sah dann aber bei Pieris napi deutlich, dass es
in pallisadenförmigen Zellen liegt. Aus mir unbekanntem Grunde fehlte, obgleich alle Schnitte gleich
behandelt waren, einzelnen jede Einlagerung von Konkrement, andere sahen völlig undurchsichtig aus,
wieder andere haben zum Teil frei sichtbare Zellen, während die andere Hälfte silberglänzend und
undurchsichtig war. Gegen die freien Zellen hin wurde der glänzende Stoff spärlicher und zeigte sich
als amorphe körnige Masse.
Die Taster der Schmetterlinge verdienen diesen Namen nicht, weil sie nie zum Tasten benützt
werden, und wegen ihrer Unbeweglichkeit auch nicht benützt werden können. Sie tragen zahlreiche
Schuppen von grösser Länge, und an ihrer Spitze die von vom R a th entdeckte fla sch en fö rra ig e
Grube mit stiftfö rm ig en S in n e so rg a n e n . Bei Bombyciden sitzt sie gewöhnlich unterhalb der
Tasterspitze. Ich habe diese Sinnesorgane bei zahlreichen Arten untersucht, und im wesentlichen
überall gleich gebaut gefunden. Die Stifte halte ich für massiv, demnach auch nicht für Riechorgane.
Sehr gut würden sie sich als Hörorgane auffassen lassen, doch fehlt jeder Beweis. Der zu den Stiften
führende Nerv läuft frei durch den mit Blut erfüllten Hohlraum des Tasters.
Die Gruben finden sich bei beiden Geschlechtern in gleicher Ausbildung, auch bei Nachtschmetterlingen
(Orgyia gonostigma, Antherea Pernyi).
Die Sinnesorgane der Schmetterlingsrnssel.
Die Rüssel der T a g fa lte r , E u len , S p in n e r und S p a n n e r besitzen an ihrer Spitze
ausser der sehr reichen Skulptur des Chitins mehr oder weniger zahlreiche zapfenförmige Anhänge
von sehr verschiedener Länge und Gestalt bei den einzelnen Arten, rund oder kantig, am Ende mit
einem deutlich abgesetzten kegelförmigen Spitzeben besetzt. In Fig. 45—58 habe ich einige der sehr
verschiedenartigen Formen in gleichem Grössenverhältnis abgezeichnet und die Zahl der auf einer
Rüsselhälfte vorkommenden Zäpfchen annähernd angegeben. Bei S p h in g id en und Z y g a e n e n
sind die Zäpfchen auf dem ganzen Rüssel verteilt, also nicht auf die Spitze beschränkt. Bei den oft
sehr unvollkommen entwickelten Rüsseln der Bombyciden wechseln beide Arten der Yerteilung.
Ich habe mich vergeblich bemüht, zwischen der Zahl und Form der Zapfen einerseits und
der Lebensweise und dem sonstigen anatomischen Baue des Schmetterlings andererseits nähere Beziehungen
aufzufinden. Das nur kann man sagen, dass an den stark rückgebildeten Rüsseln die
Zäpfchen wenig oder gar nicht entwickelt sind. Es finden sich dann an ihrer Stelle deutliche Homo-
l°ga, nämlich kleine warzenartige Erhebungen, auf denen ein derbes Haar sitzt (Antherea P&rnyi ?,
Smerinthus oceTlatus). Das Haar ist das Homologon des Kegels, die Warze dasjenige des Zapfens.
Ersterer ist lang ausgewachsen, letzterer dagegen ganz rückgebildet.
Sonderbar sind die grossen Unterschiede an Länge und Zahl der Zapfen bei oft nahe verwandten
Arten. Man vergleiche z. B. die Zapfen von Vanessa urticae Fig. 42 mit denjenigen der nah verwandten
und nur wenig grösseren Vanessa polychbros. Die Zapfen der letzteren Art sind beinahe doppelt so
gross wie die des Nesselfalters und dabei zahlreicher (100: 60). Wie sehr die Grössenverhältnisse
der Zapfen andere sind, als die der ganzen Tiere, zeigt der Vergleich zwischen Arctia Caja und Pygaera
bucephala, Pieris sinapis und Goenonympha pamphihis, Scoria und Biston betulwius (ZweiSpanner).
Charakteristisch ist jedoch, dass die Zapfen verwandter Arten stets die Verwandtschaft darin zeigen,
dass die Gestalt der Zapfen eine ähnliche ist; die verschiedenen Arten von Argynnis z. B. haben
glatte Zapfen ohne alle Ausschmückung, Pieris hat in seinen verschiedenen Arten kurze Zapfen mit
seitlichen Leisten (Fig. 50) und relativ langem Kegel, Vanessa hat einen Zackenkranz u. s. w.
Weitaus am reichsten ausgestattet ist von den untersuchten Arten die Rüsselspitze von Agrotis
(Triphaena) pronuba (Fig. 53) mit zahlreichen riesigen Zapfen; am geringsten entwickelt fand ich die
Organe bei sonst wohlgebildeten Rüsseln bei Papilio Pocldlirius.
Bei den Sphingiden (Sphinx euphorbiae, Macroglossa stellatarum), welche nicht rudimentäre
Rüssel wie Smerinthus $ haben, finden sich die Zapfen in Gruben eingesenkt, aus denen sie nur mit
der Kegelspitze hervorragen. Eine solche Grube steht ganz nahe der Rüsselspitze (Fig. 44).
Der feinere Bau der Zäpfchen ist meines Wissens bis jetzt noch nirgends beschrieben, genauer
bekannt ist nur der chitinöse Teil. Ich habe die Zäpfchen auf Längsschnitten des Rüssels von Vanessa
Jo und V. urticae untersucht, ferner auch an unzerschnittenen Rüsseln, die sich leicht selbst
mit starken Vergrösserungen untersuchen lassen. Die Bilder, welche ich bei Verwendung verschiedener
Methoden erhielt, stimmen nicht recht zu einander. Wohl die besten Bilder erhielt ich mit Chrom-
pikrinschwefelsäure, welche die Kerne und Nervenfasern sehr deutlich macht. An solchen Präparaten
fand ich, dass ein Nervenfaserbündel von dem Rüsselnerven sich zu jedem Zapfen abzweigt. Noch
ehe dasselbe in den Zapfen ein tritt, erfährt es eine starke ganglienartige Verbreiterung. Da ich die
Hauptmasse der Fasern durch diese Anschwellung hindurchziehen sah, ohne sich mit den Zellen in
Verbindung zu setzen, ist es mir zweifelhaft, ob hier ein Ganglion vorliegt. Ich erhielt mehr den
Eindruck einer Anschwellung der Nervenscheide; jedenfalls ist die scharfe Abgrenzung der Anschwellung
durch eine dünne Hülle bedingt, welche sich in die Nervenscheide fortsetzt. Das fragliche Ganglion
enthält mehrere sehr grosse runde Kerne. Der austretende Faserstrang („austretend“ hier im Sinne
der zentripetalen Nervenleitung), ist etwas dicker als der vom Zapfen her ein tretende Strang. Der
Zapfen selbst enthält in seinem basalen Teile platte ellipsoidische Kerne, die der Wand nahe liegen,
weiter nach dem Ende zu einige grosse runde Kerne. Mitten hindurch zieht das Faserbündel, hier
sich deutlich verbreiternd, wobei die faserige Struktur erhalten bleibt. Diese Verbreiterung geht nun,
wenn wir sie centrifugal verfolgen, über in einen dünnen, nicht als faserig zu erkennenden Faden
von starkem Glanze, welcher, das dünnwandige, kugelförmig vorgewölbte Ende des Zapfens durchlaufend,
meistens deutlich bis in den Kegel (Fig. 42) verfolgt werden kann. Letzterer hat an der
Basis deutlich sichtbare Wandungen von gelbem Chitin, welche sich gegen seine Spitze hin zu einer
unmessbar feinen Membran verdünnen.
Anders stellten sich die Verhältnisse dar, wenn die Präparate in Sublimat oder Müller’scher
Flüssigkeit aufbewahrt waren. Der Nerv und der ganglienartige Körper im Rüssel waren dann nicht
sichtbar, man sah nur einen Strang in den Zapfen eintreten und hier in eine scharf kontourierte Kugel
übergehen, welche die distale Hälfte des Zapfens ganz ausfüllte. Der im Kegel endigende glänzende
Faden war auch hier sichtbar, ohne dass man indessen seinen Ursprung erkennen konnte. Der ganze
Zapfen nahm in letztgenannten beiden Flüssigkeiten eine dunklere Farbe an. Das eben geschilderte
und in Fig. 41 wieder gegebene Bild könnte auf Schrumpfungsprozessen beruhen, ich halte daher das
nach Pikrinschwefelsäurebehandlung erhaltene für das richtigere.
Auf den vorstehenden anatomischen Befund mich stützend, halte ich die Zäpfchen für Sinnes