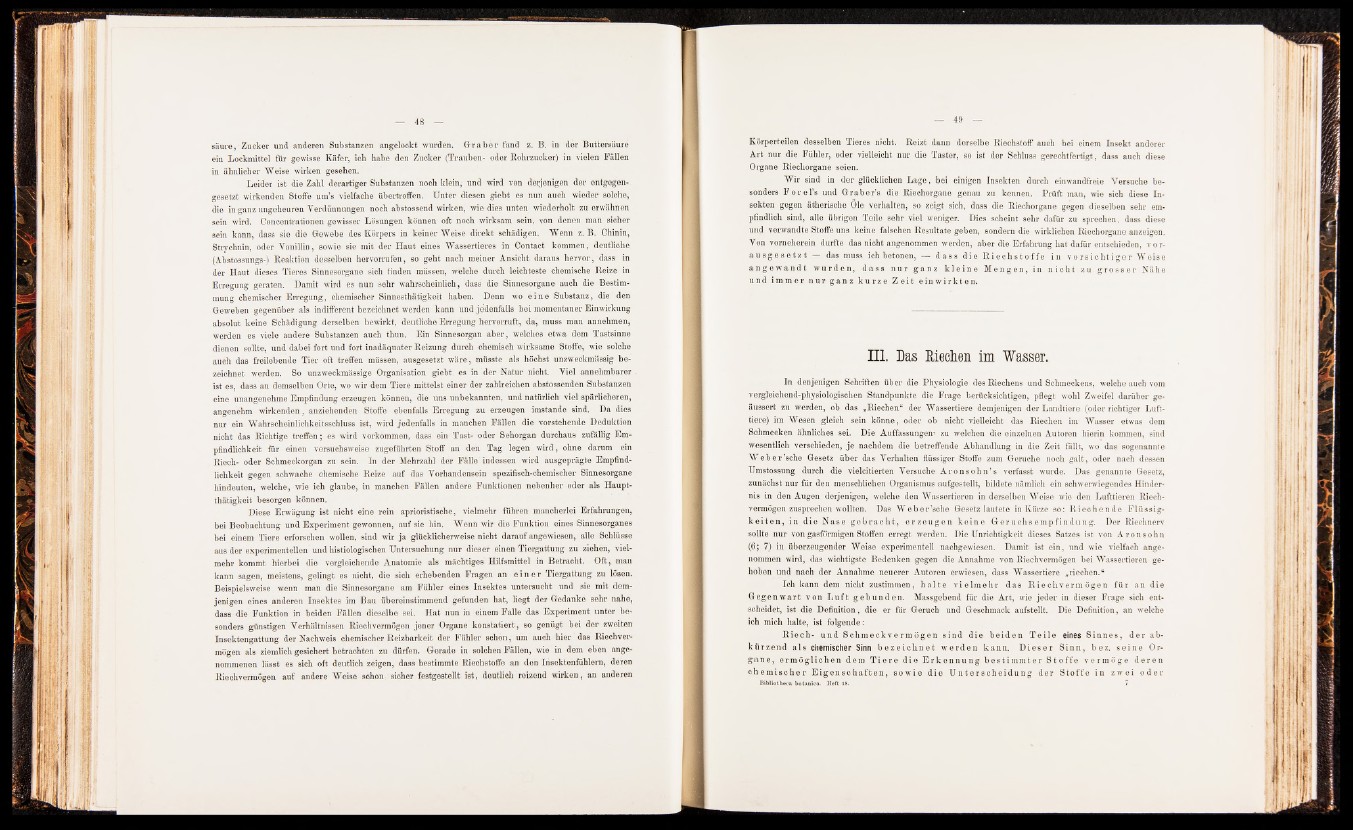
säure, Zucker und anderen Substanzen angelockt wurden. G räber fand z. B. in der Buttersäure
ein Lockmittel für gewisse Käfer, icb habe den Zucker (Trauben- oder Rohrzucker) in vielen Fällen
in ähnlicher Weise wirken gesehen.
Leider ist die Zahl derartiger Substanzen noch klein,- und wird von derjenigen der entgegengesetzt
wirkenden Stoffe um’s vielfache übertroffen. Unter diesen giebt es nun auch wieder solche,
die in ganz ungeheuren Verdünnungen noch abstossend wirken, wie dies unten wiederholt zu erwähnen
sein wird. Concentrationen gewisser Lösungen können oft noch wirksam sein, von denen man sicher
sein kann, dass sie die Gewebe des Körpers in keiner Weise direkt schädigen. Wenn z. B. Chinin,
Strychnin, oder Vanillin, sowie sie mit der Haut eines Wassertieres in Contact kommen, deutliche
(Abstossungs-) Reaktion desselben hervorrufen, so geht nach meiner Ansicht daraus hervor, dass in
der Haut dieses Tieres Sinnesorgane sich finden müssen, welche durch leichteste chemische Reize in
Erregung geraten. Damit wird es nun sehr wahrscheinlich, dass die Sinnesorgane auch die Bestimmung
chemischer Erregung, chemischer Sinnesthätigkeit haben. Denn wo e in e Substanz, die den
Geweben gegenüber als indifferent bezeichnet werden kann und jedenfalls bei momentaner Einwirkung
absolut keine Schädigung derselben bewirkt, deutliche Erregung hervorruft, da, muss man annehmen,
werden es viele andere Substanzen auch thun. Ein Sinnesorgan aber, welches etwa dem Tastsinne
dienen sollte, und dabei fort und fort inadäquater Reizung durch chemisch wirksame Stoffe, wie solche
auch das freilebende Tier oft treffen müssen, ausgesetzt wäre, müsste als höchst unzweckmässig bezeichnet
werden. So unzweckmässige Organisation giebt. es in der Natur nicht. Viel annehmbarer
ist es, dass an demselben Orte, wo wir dem Tiere mittelst einer der zahlreichen abstossenden Substanzen
eine unangenehme Empfindung erzeugen können, die uns unbekannten, und natürlich viel spärlicheren,
angenehm wirkenden, anziehenden Stoffe ebenfalls Erregung zu erzeugen imstande sind. Da dies
nur ein Wahrscheinlichkeitsschluss ist, wird jedenfalls in manchen Fällen die vorstehende Deduktion
nicht das Richtige treffen; es wird Vorkommen, dass ein Tast- oder Sehorgan durchaus zufällig Empfindlichkeit
für einen versuchsweise zugeführten Stoff an den Tag legen wird, ohne darum ein
Riech- oder Schmeckorgan zu sein. In der Mehrzahl der Fälle’ indessen wird ausgeprägte Empfindlichkeit
gegen schwache chemische Reize auf das Vorhandensein spezifisch-chemischer Sinnesorgane
hindeuten, welche, wie ich glaube, in manchen Fällen andere Funktionen nebenher oder als Haupt-
thätigkeit besorgen können.
Diese Erwägung ist nicht eine rein aprioristische, vielmehr führen mancherlei Erfahrungen,
bei Beobachtung und Experiment gewonnen, auf sie hin. Wenn wir die Funktion eines Sinnesorganes
bei einem Tiere erforschen wollen, sind wir ja glücklicherweise nicht darauf angewiesen, alle Schlüsse
aus der experimentellen und histiologischen Untersuchung nur dieser einen Tiergattung zu ziehen, vielmehr
kommt hierbei die vergleichende Anatomie als mächtiges Hilfsmittel in Betracht. Oft, man
kann sagen, meistens, gelingt es nicht, die sich erhebenden Fragen an e in e r Tiergattung zu lösen.
Beispielsweise wenn man die Sinnesorgane am Fühler eines Insektes untersucht und sie mit demjenigen
eines anderen Insektes im Bau übereinstimmend gefunden hat, liegt der Gedanke sehr nahe,
dass die Funktion in beiden Fällen dieselbe sei. Hat nun in einem Falle das Experiment unter besonders
günstigen Verhältnissen Riechvermögen jener Organe konstatiert, so genügt bei der zweiten
Insektengattung der Nachweis chemischer Reizbarkeit der Fühler schön, um auch hier das Riechvermögen
als ziemlich gesichert betrachten zu dürfen. Gerade in solchen Fällen, wie in dem eben angenommenen
lässt es sich oft deutlich zeigen, dass bestimmte Riechstoffe an den Insekteiifühlem, deren
Riechvermögen auf andere Weise schon sicher festgestellt ist, deutlich reizend wirken, an anderen
Körperteilen desselben Tieres nicht. Reizt dann derselbe Riechstoff auch bei einem Insekt anderer
Art nur die Fühler, oder vielleicht nur die Taster, so ist der Schluss gerechtfertigt, dass auch diese
Organe Riechorgane seien.
Wir sind in der glücklichen Lage, bei einigen Insekten durch einwandfreie Versuche besonders
F o r e l’s und Graber's die Riechorgane genau zu kennen. Prüft man, wie sich diese Insekten
gegen ätherische Oie verhalten, so zeigt sich, dass die Riechorgane gegen dieselben sehr empfindlich
sind, alle übrigen Teile sehr viel weniger. Dies scheint sehr dafür zu sprechen, dass diese
und verwandte Stoffe uns keine falschen Resultate geben, sondern die wirklichen Riechorgane anzeigen.
Von vorneherein durfte das nicht angenommen werden, aber die Erfahrung hat dafür entschieden, vora
u s g e s e t z t 9 das muss ich betonen, — d a s s d ie R ie c h s to f fe in v o r s ic h tig e r Weise
a n g ew a n d t w u rd e n , d a s s n u r g a n z k l e in e Men g en , in n ic h t zu g rö s s e r Nähe
und im m e r n u r g an z k u r z e Z e it e inw irk te n .
III Das Riechen im Wasser.
In denjenigen Schriften über die Physiologie des Riechens und Schmeckens, welche auch vom
vergleichend-physiologischen Standpunkte die Frage berücksichtigen, pflegt wohl Zweifel darüber ge-
äussert zu werden, ob das „Riechen“ der Wassertiere demjenigen der Landtiere (oder richtiger Lufttiere)
im Wesen gleich sein könne, oder ob nicht vielleicht das Riechen im Wasser etwas dem
Schmecken ähnliches sei. Die Auffassungen’ zu welchen die einzelnen Autoren hierin kommen, sind
wesentlich verschieden, je nachdem die betreffende Abhandlung in die Zeit fällt, wo das sogenannte
W e b e r ’sche Gesetz über das Verhalten flüssiger Stoffe zum Gerüche noch galt, oder nach dessen
Umstossung durch die vielcitierten Versuche A ro n so h n ’s verfasst wurde. Das genannte Gesetz,
zunächst nur für den menschlichen Organismus aufgestellt, bildete nämlich ein schwerwiegendes Hindernis
in den Augen derjenigen, welche den Wassertieren in derselben Weise wie den Lufttieren Riechvermögen
zusprechen wollten. Das W e b e r’sche Gesetz lautete in Kürze so: R ie c h en d e Flüssigk
e ite n , in die Nase g e b ra c h t, e rz e u g e n k e in e Geru ch sem p fin d u n g . Der Riechnerv
sollte nur von gasförmigen Stoffen erregt werden. Die Unrichtigkeit dieses Satzes ist von Aronsohn
(6; 7) in überzeugender Weise experimentell nachgewiesen. Damit ist ein, und wie vielfach angenommen
wird, das wichtigste Bedenken gegen die Annahme von Riechvermögen bei Wassertieren gehoben
und nach der Annahme neuerer Autoren erwiesen, dass Wassertiere „riechen.“
Ich kann dem nicht zustimmen, h a lte v ie lm e h r das R ie c h v e rm ö g en für an die
Gegenwart von L u ft gebu n d en . Massgebend für die Art, wie jeder in dieser Frage sich entscheidet,
ist die Definition, die er für Geruch und Geschmack aufstellt. Die Definition, an welche
ich mich halte, ist folgende:
Riech- und Schmeck v e rm ö g en sind die b e id en T e ile eines Sinnes, d e r abkürzend
als chemischer Sinn b e z e ic h n e t w e rd en kann. D ie s e r Sinn, bez. se in e Organe,
e rmöglichen dem T ie re die E rk e n n u n g b e s tim m te r S to ffe v e rm ö g e d e re n
ch em is c h e r E ig e n s c h a fte n , sowie d ie U n te r s c h e id u n g der Stoffe in zwei o d e r
Bibliotbeca botanica. Heft 18. 7