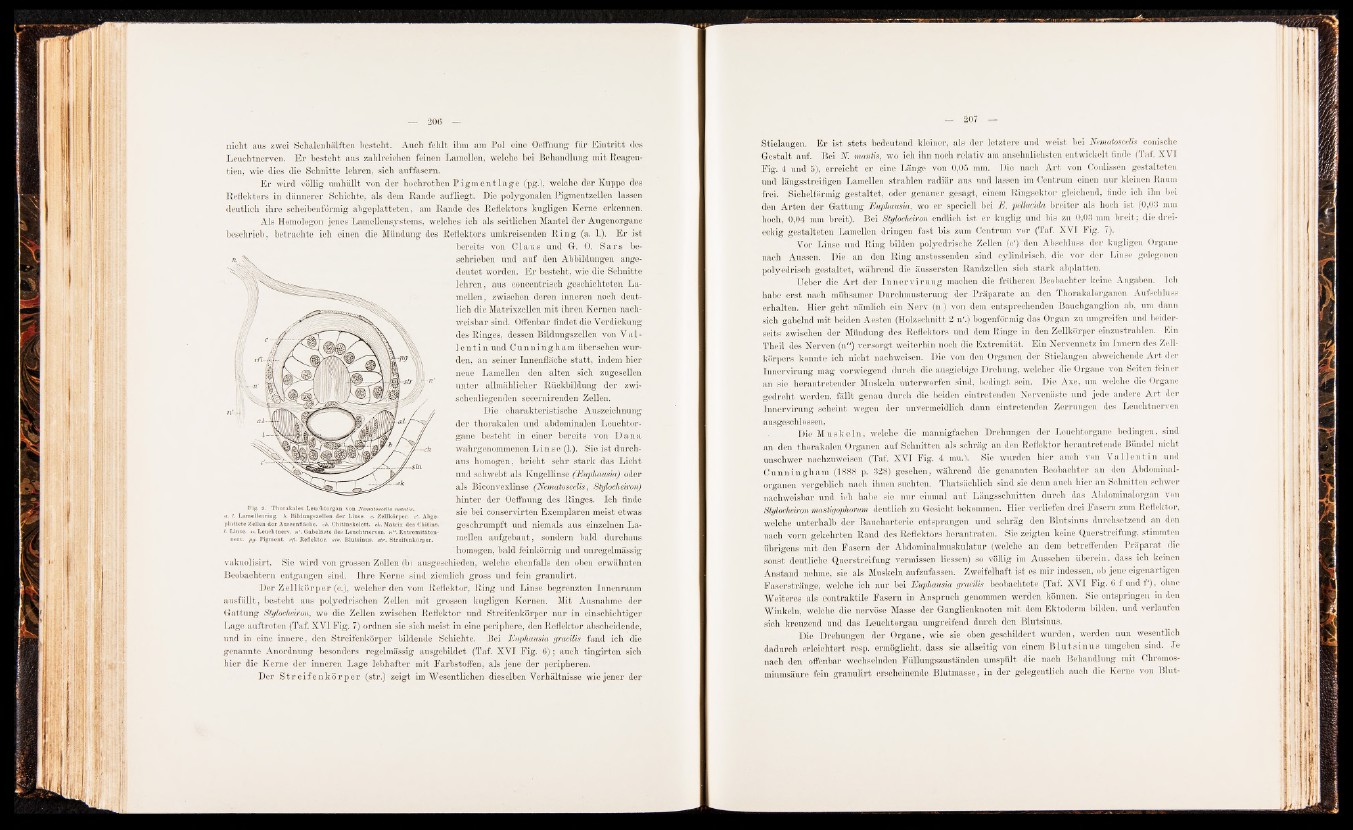
nicht aus zwei Schalenhälften besteht. Auch fehlt ihm am Pol eine Oeffnung für Eintritt des
Leuchtnerven. Er besteht aus zahlreichen feinen Lamellen, welche bei Behandlung mit Reagen-
tien, wie dies die Schnitte lehren, sich auffasern.
Er wird völlig umhüllt von der hoehrothen P i gm e n t lä g e (pg.), welche der Kuppe des
Reflektors in dünnerer Schichte, als dem Rande aufliegt. Die polygonalen Pigmentzellen lassen
deutlich ihre scheibenförmig abgeplatteten, am Rande des Reflektors kugligen Kerne erkennen.
Als Homologon jenes Lamellensystems, welches ich als seitlichen Mantel der Augenorgane
beschrieb, betrachte ich einen die Mündung des Reflektors umkreisenden R in g (a. 1.). Er ist
bereits von C lau s und Gr. 0. S a r s beschrieben
und auf den Abbildungen angedeutet
worden. Er besteht, wie die Schnitte
lehren, aus concentrisch geschichteten Lamellen,
zwischen deren inneren noch deutlich
die Matrixzellen mit ihren Kernen nachweisbar
sind. Offenbar findet die Verdickung
des Ringes, dessen Bildungszellen von Val-
l e n t in und C u n n in g h am übersehen wurden,
an seiner Innenfläche statt, indem hier
neue Lamellen den alten sich zugesellen
unter allmählicher Rückbildung der zwischenliegenden
secernirenden Zellen.
Die charakteristische Auszeichnung
der thorakalen und abdominalen Leuchtorgane
besteht in einer bereits von D a n a
wahrgenommenen L in s e (1.). Sie ist durchaus
homogen, bricht sehr stark das Licht
und schwebt als Kugellinse (Euphausia) oder
als Bieonvexlinse (Nematoscelis, Stylocheiron)
hinter der Oeffnung des Ringes. Ich finde
sie bei conservirten Exemplaren meist etwas
geschrumpft und niemals aus einzelnen Lamellen
aufgebaut, sondern bald durchaus
'homogen, bald feinkörnig und unregelmässig
Fig. 2. Thorakales Lenchtorgan von Nematoscelis a. I. manlis. Lamellenring. ¿1. Bi] dungszellen der Linse, c. Zellkörper, c'. Abgeplattete
Zellen der Aussenfläche. ch: Chitinskelett, ek. Matrix des Chitins. I. Linse, n. Leuchtnerv. «'. Gabeläste des Leuchtnerven. «".Extremitätennerv.
pg. Pigment, rfl. Reflektor, sin. Blntsinos. str. Streifenkörper.
vakuolisirt. Sie wird von grossen Zellen (b) ausgeschieden, welche ebenfalls den oben erwähnten
Beobachtern entgangen sind. Ihre Kerne sind ziemlich gross und fein granulirt.
Der Z e llk ö rp e r (c.), welcher den vom Reflektor, Ring und Linse begrenzten Innenraum
ausfüllt, besteht aus polyedrischen Zellen mit grossen kugligen Kernen. Mit Ausnahme der
Gattung Stylocheiron, wo die Zellen zwischen Reflektor und Streifenkörper nur in einschichtiger
Lage auftreten (Taf. XVI Fig. 7) ordnen sie sich meist in eine periphere, den Reflektor abscheidende,
und in eine innere, den Streifenkörper bildende Schichte. Bei Euphausia gracilis fand ich die
genannte Anordnung besonders regelmässig ausgebildet (Taf. XVI Fig. 6); auch tingirten sich
hier die Kerne der inneren Lage lebhafter mit Farbstoffen, als jene der peripheren.
Der S t r e if e n k ö r p e r (str.) zeigt im Wesentlichen dieselben Verhältnisse wie jener der
Stielaugen. Er ist stets bedeutend kleiner, als der letztere und weist bei Nematoscelis conische
Gestalt auf. Bei N. mantis, wo ich ihn noch relativ am ansehnlichsten entwickelt finde (Taf. XVI
Fig. 4 und 5), erreicht er eine Länge von 0,05 mm. Die nach Art von Coulissen gestalteten
und längsstreifigen Lamellen strahlen radiär aus und lassen im Centrum einen nur kleinen Raum
frei. Sichelförmig gestaltet, oder genauer gesagt, einem Ringsektor gleichend, finde ich ihn bei
den Arten der Gattung Euphausia, wo er speciell bei E. pellucida breiter als hoch ist (0,03 mm
hoch, 0,04 mm breit). Bei Stylocheiron endlich ist er kuglig und bis zu 0,03 mm breit; die dreieckig
gestalteten Lamellen dringen fast bis zum Centrum vor (Taf. XVI Fig. 7).
Vor Linse und Ring bilden polyedrische Zellen (c') den Abschluss der kugligen Organe
nach Aussen. Die an den Ring anstossenden sind cylindrisch, die vor der Linse gelegenen
polyedrisch gestaltet, während die äussersten Randzellen sich stark abplatten.
Ueber die Art der In n e rv iru n g machen die früheren Beobachter keine Angaben. Ich
habe erst nach mühsamer Durchmusterung der Präparate an den Thorakalorganen Aufschluss
erhalten. Hier geht nämlich ein Nerv (n.) von dem entsprechenden Bauchganglion ab, um dann
sich gabelnd mit beiden Aesten (Holzschnitt 2 n'.) bogenförmig das Organ zu umgreifen und beiderseits
zwischen der Mündung des Reflektors und dem Ringe in den Zellkörper einzustrahlen. Ein
Theil des Nerven (n") versorgt weiterhin noch die Extremität. Ein Nervennetz im Innern des Zellkörpers
konnte ich nicht naehweisen. Die von den Organen der Stielaugen abweichende Art der
Innervirung mag vorwiegend durch die ausgiebige Drehung, welcher die Organe von Seiten feiner
an sie herantretender Muskeln unterworfen sind, bedingt sein. Die Axe, um welche die Organe
gedreht werden, fällt genau durch die beiden eintretenden Nervenäste und jede andere Art der
Innervirung scheint wegen der unvermeidlich dann eintretenden Zerrungen des Leuchtnerven
ausgeschlossen.
Die M u sk e ln , welche die mannigfachen Drehungen der Leuchtorgane bedingen, sind
an den thorakalen Organen auf Schnitten als schräg an den Reflektor herantretende Bündel nicht
unschwer nachzuweisen (Taf. XVI Fig. 4 mu.). Sie wurden hier auch von V a lle n tin und
C u n n in g h am (1888 p. 328) gesehen, während die genannten Beobachter an den Abdominalorganen
vergeblich nach ihnen suchten. Thatsächlich sind sie denn auch hier an Schnitten schwer
nachweisbar und ich habe sie nur einmal auf Längsschnitten durch das Abdominalorgan von
Stylocheiron mastigophonm deutlich zu Gesicht bekommen. Hier verliefen drei Fasern zum Reflektor,
welche unterhalb der Baucharterie entsprangen und schräg den Blutsinus durchsetzend an den
nach vorn gekehrten Rand des Reflektors herantraten. Sie zeigten keine Querstreifung, stimmten
übrigens mit den Fasern der Abdominalmnskulatur (welche an dem betreffenden Präparat die
sonst deutliche Querstreifung vermissen Hessen) so völlig im Aussehen überein, dass ich keinen
Anstand nehme, sie als Muskeln aufzufassen. Zweifelhaft ist es mir indessen, ob jene eigenartigen
Faserstränge, welche ich nur bei Euphausia gracilis beobachtete (Taf. XVI Fig. 6 f und f'), ohne
Weiteres als contraktile Fasern in Anspruch genommen werden können. Sie entspringen in den
Winkeln, welche die nervöse Masse der Ganglienknoten mit dem Ektoderm bilden, und verlaufen
sich kreuzend und das Leuchtorgan umgreifend durch den Blutsinus.
Die Drehungen der Organe, wie sie oben geschildert wurden, werden nun wesentlich
dadurch erleichtert resp. ermöglicht, dass sie allseitig von einem B lu ts in u s umgeben sind. Je
nach den offenbar wechselnden Füllungszuständen umspült die nach Behandlung mit Chromosmiumsäure
fein granulirt erscheinende Blutmasse, in der gelegentlich auch die Kerne von Blut