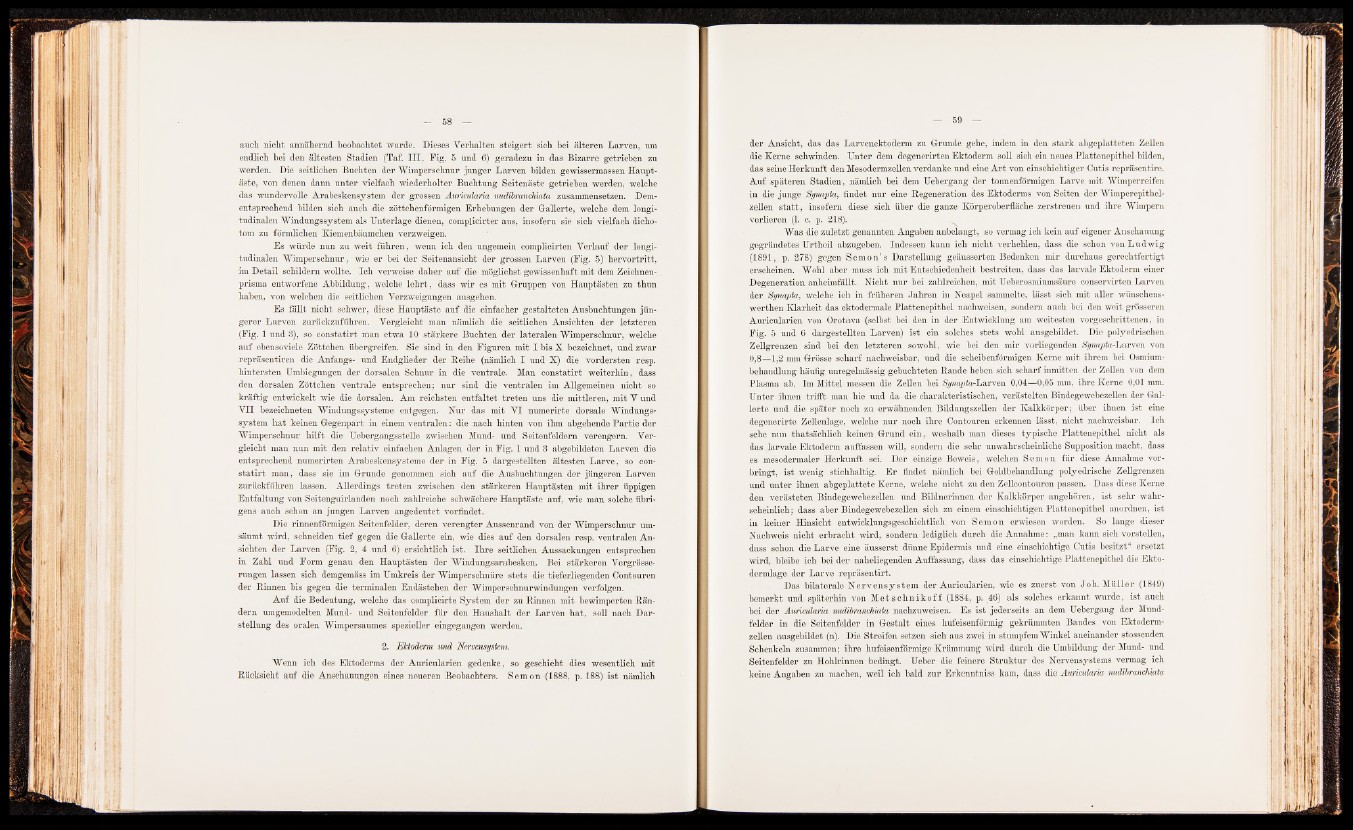
auch nicht annähernd beobachtet wurde. Dieses Verhalten steigert sich bei älteren Larven, um
endlich bei den ältesten Stadien (Taf. III, Fig. 5 und 6) geradezu in das Bizarre getrieben zu
werden. Die seitlichen Buchten der Wimperschnur junger Larven bilden gewissermassen Hauptäste,
von denen dann unter vielfach wiederholter Buchtung Seitenäste getrieben werden, welche
das wundervolle Arabeskensystem der grossen Aurieularia nudibranchiata zusammensetzen. Dementsprechend
bilden sich auch die zöttchenförmigen Erhebungen der Gallerte, welche dem longitudinalen
Windungssystem als Unterlage dienen, complicirter aus, insofern sie sich vielfach dicho-
tom zu förmlichen Kiemenbäumchen verzweigen.
Es würde nun zu weit führen, wenn ich den ungemein complicirten Verlauf der longitudinalen
Wimperschnur, wie er bei der Seitenansicht der grossen Larven (Fig. 5) hervortritt,
im Detail schildern wollte. Ich verweise daher auf die möglichst gewissenhaft mit dem Zeichnenprisma
entworfene Abbildung, welche lehrt, dass wir es mit Gruppen von Hauptästen zu thun
haben, von welchen die seitlichen Verzweigungen ausgehen.
Es fällt nicht schwer, diese Hauptäste auf die einfacher gestalteten Ausbuchtungen jüngerer
Larven zurückzuführen. Vergleicht man nämlich die seitlichen Ansichten der letzteren
(Fig. 1 und 3), so constatirt man etwa 10 stärkere Buchten der lateralen Wimperschnur, welche
auf ebensoviele Zöttchen übergreifen. Sie sind in den Figuren mit I bis X bezeichnet, und zwar
repräsentiren die Anfangs- und Endglieder der Reihe (nämlich I und X) die vordersten resp.
hintersten Umbiegungen der dorsalen Schnur in die ventrale. Man constatirt weiterhin, dass
den dorsalen Zöttchen ventrale entsprechen; nur sind die ventralen im Allgemeinen nicht so
kräftig entwickelt wie die dorsalen. Am reichsten entfaltet treten uns die mittleren, mit V und
VH bezeichneten Windungssysteme entgegen. Nur das mit VI numerirte dorsale Windungs*
system hat keinen Gegenpart in einem ventralen: die nach hinten von ihm abgehende Partie der
Wimperschnur hilft die Uebergangsstelle zwischen Mund- und Seitenfeldem verengern. Vergleicht
man nun mit den relativ einfachen Anlagen der in Fig. 1 und 3 abgebildeten Larven die
entsprechend numerirten Arabeskensysteme der in Fig. 5 dargestellten ältesten Larve, so constatirt
man, dass sie im Grunde genommen sich auf die Ausbuchtungen der jüngeren Larven
zurückführen lassen. Allerdings treten zwischen den stärkeren Hauptästen mit ihrer üppigen
Entfaltung von Seitenguirlanden noch zahlreiche schwächere Hauptäste auf, wie man solche übrigens
auch schon an jungen Larven angedeutet vorfindet.
Die rinnenförmigen Seitenfelder, deren verengter Aussenrand von der Wimperschnur umsäumt
wird, schneiden tief gegen die Gallerte ein, wie dies auf den dorsalen resp. ventralen Ansichten
der Larven (Fig. 2, 4 und 6) ersichtlich ist. Ihre seitlichen Aussackungen entsprechen
in Zahl und Form genau den Hauptästen der Windungsarabesken. Bei stärkeren Vergrösse-
rungen lassen sich demgemäss im Umkreis der Wimperschnüre stets die tieferliegenden Contouren
der Rinnen bis gegen die terminalen Endästchen der Wimperschnur Windungen verfolgen.
Auf die Bedeutung, welche das complicirte System der zu Rinnen mit bewimperten Rändern
umgemodelten Mund- und Seitenfelder für den Haushalt der Larven hat, soll nach Darstellung
des oralen Wimpersaumes spezieller eingegangen werden.
2. Ektoderm und Nervensystem.
Wenn ich des Ektoderms der Auricularien gedenke, so geschieht dies wesentlich mit
Rücksicht auf die Anschauungen eines neueren Beobachters. Semon (1888, p. 188) ist nämlich
der Ansicht, das das Larvenektoderm zu Grunde gehe, indem in den stark abgeplatteten Zellen
die Kerne schwinden. Unter dem degenerirten Ektoderm soll sich ein neues Plattenepithel bilden,
das seine Herkunft den Mesodermzellen verdanke und eine Art von einschichtiger Cutis repräsentire.
Auf späteren Stadien, nämlich bei dem Uebergang der tonnenförmigen Larve mit Wimperreifen
in die junge Syncipta, findet nur eine Regeneration des Ektoderms von Seiten der Wimperepithelzellen
sta tt, insofern diese sich über die ganze Körperoberfläche zerstreuen und ihre Wimpern
verlieren (L c. p. 218). .
Was die zuletzt genannten Angaben anbelangt, so vermag ich kein auf eigener Anschauung
gegründetes Urtheil abzugeben. Indessen kann ich nicht verhehlen, dass die schon von Ludwig
(1891, p. 278) gegen Semon’s Darstellung geäusserten Bedenken mir durchaus gerechtfertigt
erscheinen. Wohl aber muss ich mit Entschiedenheit bestreiten, dass das larvale Ektoderm einer
Degeneration anheimfällt. Nicht nur bei zahlreichen, mit Ueberosmiumsäure conservirten Larven
der Synapta, welehe ich in früheren Jahren in Neapel sammelte, lässt sich mit aller wünschens-
werthen Klarheit das ektodermale Plattenepithel nachweisen, sondern auch bei den weit grösseren
Auricularien von Orotava (selbst bei den in der Entwicklung am weitesten vorgeschrittenen, in
Fig. 5 und 6 dargestellten Larven) ist ein solches stets wohl ausgebildet. Die polyedrischen
Zellgrenzen sind bei den letzteren sowohl, wie bei den mir vorliegenden Synapta-h^rven von
0,8—1,2 mm Grösse scharf nachweisbar, und die scheibenförmigen Kerne mit ihrem bei Osmiumbehandlung
häufig unregelmässig gebuchteten Rande heben sich scharf inmitten der Zellen von dem
Plasma ab. Im Mittel messen die Zellen bei Synapta-ljQ,w&a. 0,04—0,05 mm, ihre Kerne 0,01 mm.
Unter ihnen trifft man hie und da die charakteristischen, verästelten Bindegewebezellen der Gallerte
und die später noch zu erwähnenden Bildungszellen der Kalkkörper ;i^i|ber ihnen ist eine
degenerirte Zellenlage, welche nur noch ihre Contouren erkennen lässt, nicht nachweisbar. Ich
sehe nun thatsächlich keinen Grund ein, weshalb man dieses typische Plattenepithel nicht als
das .larvale Ektoderm auffassen will, sondern die sehr unwahrscheinliche Supposition macht, dass
es mesodermaler Herkunft sei. Der einzige Beweis, welchen Semon für diese Annahme vorbringt,
ist wenig stichhaltig. Er findet nämlich bei Goldbehandlung polyedrische Zellgrenzen
und unter ihnen abgeplattete Kerne, welche nicht zu den Zellcontouren passen. Dass diese Kerne
den verästeten Bindegewebezellen und Bildnerinnen der Kalkkörper angehören, ist sehr wahrscheinlich
; dass aber Bindegewebezellen sich zu einem einschichtigen Plattenepithel anordnen, ist
in keiner Hinsicht entwicklungsgeschichtlich von Semon erwiesen worden. So lange dieser
Nachweis nicht erbracht wird, sondern lediglich durch die Annahme: „man kann sich vor stellen,
dass schon die Larve eine äusserst dünne Epidermis und eine einschichtige Cutis besitzt“ ersetzt
wird, bleibe ich bei der naheliegenden Auffassung, dass das einschichtige Plattenepithel die Ektodermlage
der Larve repräsentirt.
Das bilaterale Nerv en sy stem der Auricularien, wie es zuerst von Joh. Müller (1849)
bemerkt und späterhin von M e ts c h n ik o f f (1884, p. 46) als solches erkannt wurde, ist auch
bei der Aurieularia nudibranchiata nachzuweisen. Es ist jederseits an dem Uebergang der Mundfelder
in die Seitenfelder in Gestalt eines hufeisenförmig gekrümmten Bandes von Ektodermzellen
ausgebildet (n). Die Streifen setzen sich aus zwei in stumpfem Winkel aneinander stossenden
Schenkeln zusammen; ihre hufeisenförmige Krümmung wird durch die Umbildung der Mund- und
Seitenfelder zu Hohlrinnen bedingt. Ueber die feinere Struktur des Nervensystems vermag ich
keine Angaben zu machen, weil ich bald zur Erkenntniss kam, dass die Aurieularia nudibranchiata