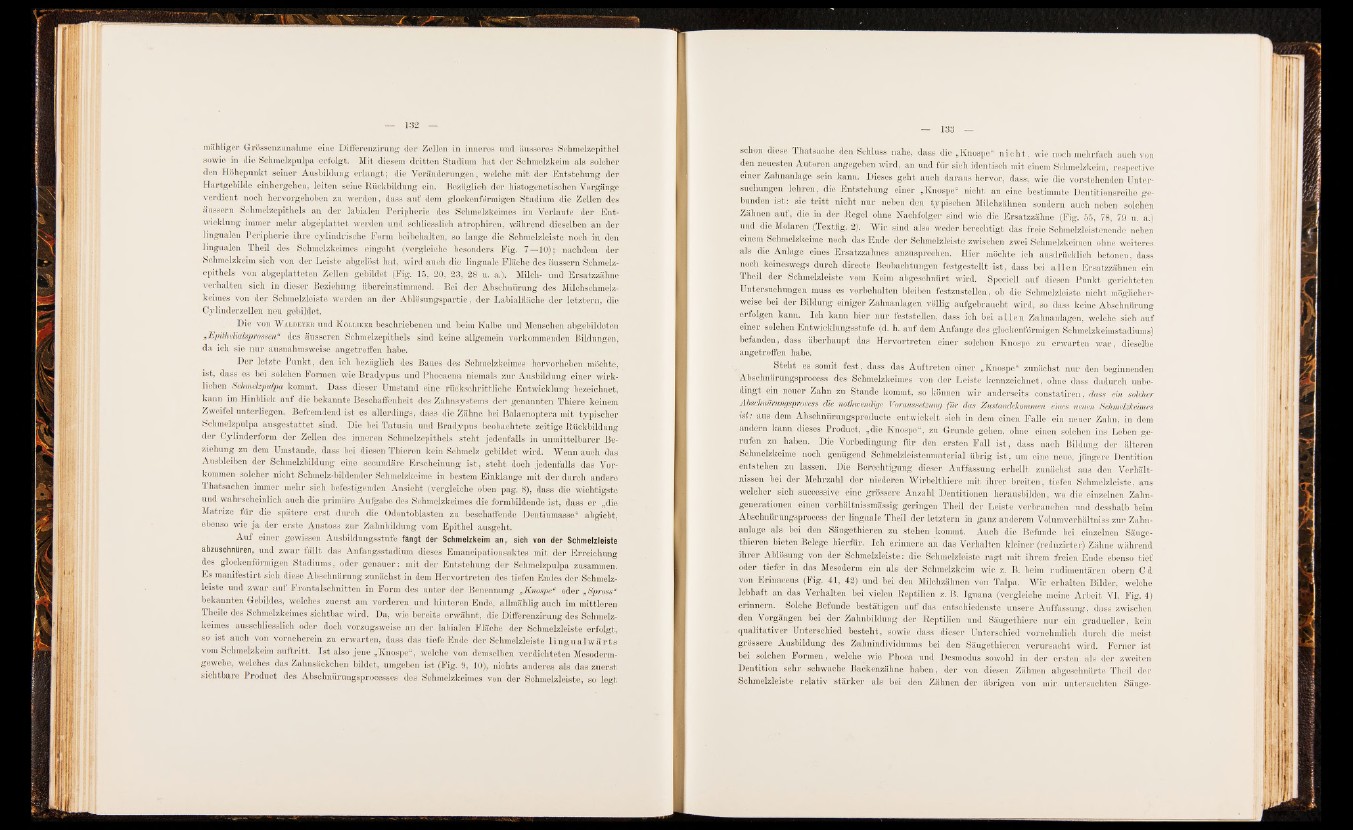
mähliger Grössenzunahme eine Differenzirung der Zellen in inneres und äusseres Schmelzepithel
sowie in die Schmelzpulpa erfolgt. Mit diesem dritten Stadium hat der Schmelzkeim als solcher
den Höhepunkt seiner Ausbildung erlangt; die Veränderungen, welche mit der Entstehung der
Hartgebilde einhergehen, leiten seine Rückbildung ein. Bezüglich der histogenetischen Vorgänge
verdient noch hervorgehoben zu werden, dass auf dem glockenförmigen Stadium die Zellen des
äussern Schmelzepithels an der labialen Peripherie des Schmelzkeimes im Verlaufe der Entwicklung
immer mehr abgeplattet werden und schliesslich atrophiren, während dieselben an der
lingualen Peripherie ihre cylindrische Form beibehalten, so lange die Schmelzleiste noch in den
lingualen Theil des Schmelzkeimes eingeht (vergleiche besonders Fig. 7—10); nachdem der
Schmelzkeim sich von der Leiste abgelöst hat, wird auch die linguale Fläche des äussern S.chmelz-
epithels von abgeplatteten Zellen gebildet (Fig. 15, 20, 23, 28 u. a.). Milch- und Ersatzzähne
verhalten sich in dieser Beziehung übereinstimmend. Bei der Abschnürung des Milchschmelzkeimes
von der Schmelzleiste werden an der Ablösungspartie, der Labialfläche der letztem, die
Cylinderzellen neu gebildet.
Die von W a l d e y e r und K ö l l i k e r beschriebenen und beim Kalbe und Menschen abgebildeten
„Epithelialsprossen“ des äusseren Schmelzepithels sind keine allgemein vorkommenden Bildungen,
da ich sie nur ausnahmsweise angetroffen habe.
Der letzte Punkt, den ich bezüglich des Baues des Schmelzkeimes hervorheben möchte,
ist, dass es bei solchen Formen wie Bradypus und Phocaena niemals zur Ausbildung einer wirklichen
Schmelzpulpa kommt. Dass dieser Umstand eine rückschrittliche Entwicklung bezeichnet,
kann im Hinblick auf die bekannte Beschaffenheit des Zahnsystems der genannten Thiere keinem
Zweifel unterliegen.. Befremdend ist es allerdings, dass die Zähne bei Balaenoptera mit typischer
Schmelzpulpa ausgestattet sind. Die bei Tatusia und Bradypus beobachtete zeitige Rückbildung
der Cylinderform der Zellen des inneren Schmelzepithels steht jedenfalls in unmittelbarer Beziehung
zu dem Umstande, dass bei diesen Thieren kein Schmelz gebildet wird. Wenn auch >das
Ausbleiben der Schmelzbildung eine secundäre Erscheinung ist, steht doch jedenfalls das Vorkommen
solcher nicht Schmelz-bildender Schmelzkeime in bestem Einklänge mit der durch andere
Thatsachen immer mehr sich befestigenden Ansicht (vergleiche oben pag. 8), dass die wichtigste
und wahrscheinlich auch die primäre Aufgabe des Schmelzkeimes die formbildende ist, dass er „die
Matrize für die spätere erst durch die Odontoblasten zu beschaffende Dentinmasse“ abgiebt,
ebenso wie ja der erste Anstoss zur Zahnbildung vom Epithel ausgeht.
Auf einer gewissen Ausbildungsstufe fängt der Schmelzkeim an, sich von der Schmelzleiste
abzuschnüren, und zwar fällt das Anfangsstadium dieses Emancipationsaktes mit der Erreichung
des glockenförmigen Stadiums, oder genauer: mit der Entstehung der Schmelzpulpa zusammen.
Es manifestirt sich diese Abschnürung zunächst in dem Hervortreten des tiefen Endes der Schmelzleiste
und zwar auf Frontalschnitten in Form des unter der Benennung „Knospe“ oder „Spross“
bekannten Gebildes, welches zuerst am vorderen und hinteren Ende, allmählig auch im mittleren
Theile des Schmelzkeimes sichtbar wird. Da, wie bereits erwähnt, die Differenzirung des Schmelzkeimes
ausschliesslich oder doch vorzugsweise an der labialen Fläche der Schmelzleiste erfolgt,
so ist auch von vorneherein zu erwarten, dass das tiefe Ende der Schmelzleiste l in g u a lwä r t s
vom Schmelzkeim auftritt. Ist also jene „Knospe“, welche von demselben verdichteten Mesodermgewebe,
welches das Zahnsäckchen bildet, umgeben ist (Fig. 9, 10), nichts anderes als das zuerst
sichtbare Product des Abschnürungsprocesses des Schmelzkeimes von der Schmelzleiste, so legt
schon diese Thatsache den Schluss nahe, dass die „Knospe“ n icht , wie noch mehrfach auch von
den neuesten Autoren angegeben wird, an und für sich identisch mit einem Schmelzkeim, respective
einer Zahnanlage sein kann. Dieses geht auch daraus hervor, dass; wie die vorstehenden Untersuchungen
lehren, die Entstehung einer „Knospe“ nicht an eine bestimmte Dentitionsreihe gebunden
ist: sie tritt nicht nur neben den typischen Milchzähnen sondern auch neben solchen
Zähnen auf, die in der Regel ohne Nachfolger sind wie die Ersatzzähne (Fig. 55, 78, 79 u. a.)
und die Molaren (Textfig. 2). Wir. sind also weder berechtigt das freie Schmelzleistenende neben
einem Schmelzkeime noch das Ende der Schmelzleiste zwischen zwei Schmelzkeimen ohne weiteres
als die Anlage eines Ersatzzahnes anzusprechen. Hier möchte ich ausdrücklich betonen, dass
noch keineswegs durch directe Beobachtungen festgestellt ist, dass bei a l l en Ersatzzähnen ein
Theil der Schmelzleiste vom Keim abgeschnürt wird. Speciell auf diesen Punkt gerichteten
Untersuchungen muss es Vorbehalten bleiben festzustellen, ob die Schmelzleiste nicht möglicherweise
bei der Bildung einiger Zahnanlagen völlig aufgebraucht wird, so dass keine Abschnürung
erfolgen kann. Ich kann hier nur feststellen, dass ich bei al l e n Zahnanlagen, welche sich auf
einer solchen Entwicklungsstufe (d. h. auf dem Anfänge des glockenförmigen Sehmelzkeimstadiums)
befanden, dass überhaupt das Hervortreten einer solchen Knospe zu erwarten war, dieselbe
angetroffen habe.
Steht es somit fest, dass das Auftreten einer „Knospe“ zunächst nur den beginnenden
Abschnürungsprocess des Schmelzkeimes von der Leiste kennzeichnet, ohne dass dadurch unbedingt
ein neuer Zahn zu Stande kommt, so können wir anderseits constatiren, dass ein solcher
Abschnürungsprocess die nothwendige Voraussetzung für das Zustandekommen eines neuen Schmelzkeimes
ist: aus dem Abschnürungsproducte entwickelt sich in dem einen Falle ein neuer Zahn, in dem
ändern kann dieses Product, „die Knospe“, zu Grunde gehen, ohne einen solchen ins Leben gerufen
zu haben. Die Vorbedingung für den ersten Fall ist, dass nach Bildung der älteren
Sehmelzkeime noch genügend Schmelzleistenmaterial übrig ist, um eine neue, jüngere Dentition
entstehen zu lassen. Die Berechtigung dieser Auffassung erhellt zunächst aus den Verhältnissen
bei der Mehrzahl der niederen Wirbelthiere mit ihrer breiten, tiefen Schmelzleiste, aus
welcher sich successive eine grössere Anzahl Dentitionen herausbilden, wo die einzelnen Zahngenerationen
einen verhältnissmässig geringen Theil der Leiste verbrauchen und desshalb beim
Abschnürungsprocess der linguale Theil der letztem in ganz anderem Volumverhältniss zur Zahnanlage
als bei den Säugethieren zu stehen kommt. Auch die Befunde bei einzelnen Säuge-
thieren bieten Belege hierfür. Ich erinnere an das Verhalten kleiner (reduzirter) Zähne während
ihrer Ablösung von der Schmelzleiste: die Schmelzleiste ragt mit ihrem freien Ende ebenso tief
oder tiefer in das Mesoderm ein als der Schmelzkeim wie z. B. beim rudimentären obern C d
von Erinaceus (Fig. 41, 42) und bei den Milchzähnen von Talpa, Wir erhalten Bilder, welche
lebhaft an das Verhalten bei vielen Reptilien z. B. Iguana (vergleiche meine Arbeit VI, Fig. 4)
erinnern. Solche Befunde bestätigen auf das entschiedenste unsere Auffassung, dass zwischen
den Vorgängen bei der Zahnbildung der Reptilien und Säugethiere nur ein gradueller, kein
qualitativer Unterschied besteht, sowie dass dieser Unterschied vornehmlich durch die meist
grössere Ausbildung des Zahnindividuums bei den Säugethie ren verursacht wird. Ferner ist
bei solchen Formen, welche wie Phoca und Desmodns sowohl in der ersten, als der zweiten
Dentition sclir schwache Backenzähne haben,, der von diesen Zähnen abgeschniirte Theil der
Schmelzleiste relativ ' stärker als bei den Zähnen der übrigen von mir untersuchten .Säuge