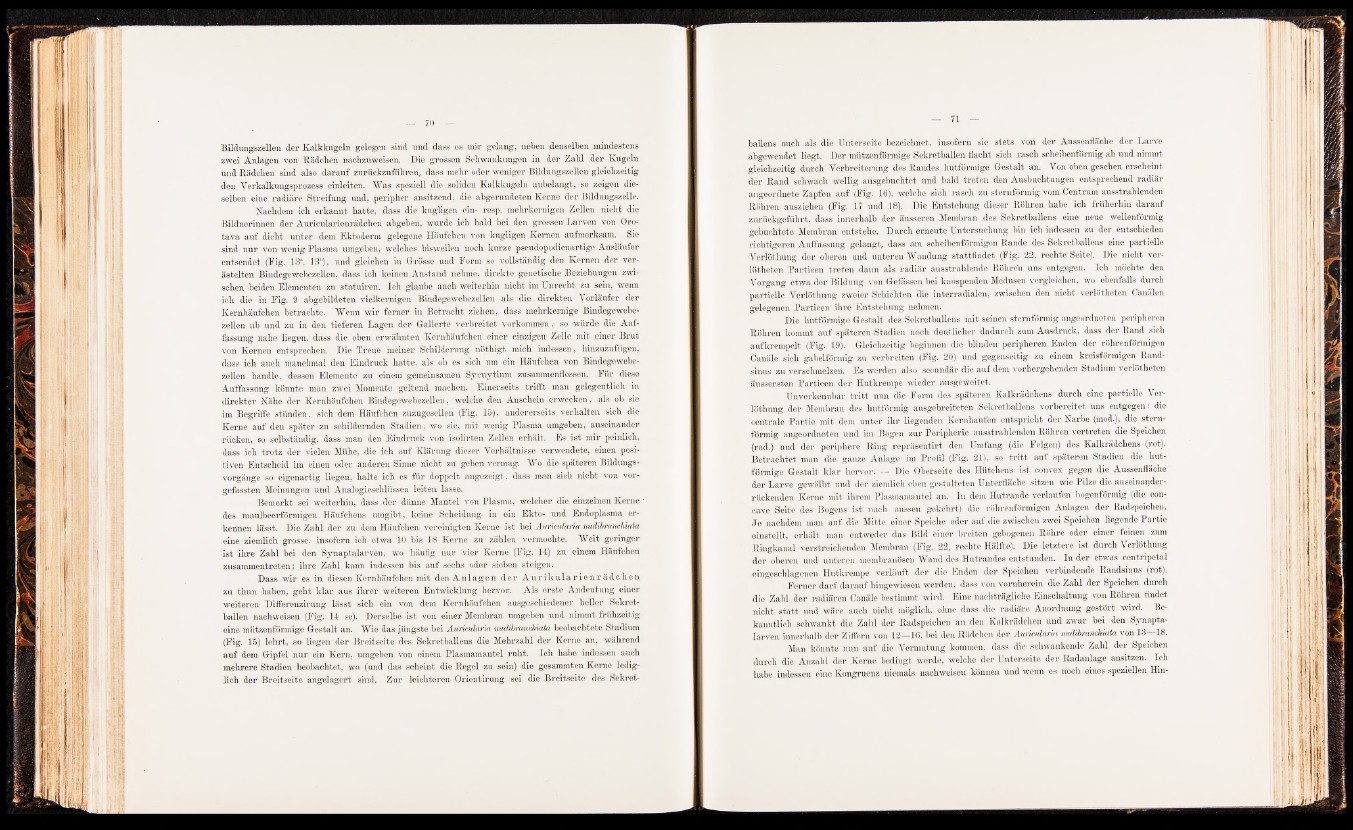
Bildungszellen der Kalkkugeln gelegen sind und dass es mir gelang, neben denselben mindestens
zwei Anlagen von Rädchen nachzuweisen. Die grossen Schwankungen in der Zahl der Kugeln
und Rädchen sind also darauf zurückzuführen, dass mehr oder weniger Bildungszellen gleichzeitig
den Verkalkungsprozess einleiten. Was speziell die soliden Kalkkugeln anbelangt, - so zeigen dieselben
eine radiäre Streifung und, peripher ansitzend, die abgerundeten Kerne der Bildungszelle.
Nachdem ich erkannt hatte, dass die kugligen ein- resp. mehrkernigen Zellen nicht die
Bildnerinnen der Auricularienrädchen abgehen, wurde ich bald bei den grossen Larven von Orotava
auf dicht unter dem Ektoderm gelegene Häufchen von kugligen Kernen aufmerksam. Sie
sind nur von wenig Plasma umgeben, welches bisweilen noch kurze pseudopodienartige Ausläufer
entsendet (Eig. 13“, 13b), und gleichen in Grösse und Form so vollständig den Kernen der verästelten
Bindegewebezellen, dass ich keinen Anstand nehme, direkte genetische Beziehungen zwischen
beiden Elementen zu statuiren. Ich glaube auch weiterhin nicht im Unrecht zu sein, wenn
ich die in Fig. 9 abgebildeten vielkernigen Bindegewebezellen als die direkten Vorläufer der
Kernhänfchen betrachte. Wenn wir ferner in Betracht ziehen, dass mehrkernige Bindegewebezellen
ab und zu in den tieferen Lagen der Gallerte verbreitet Vorkommen, so würde die Auffassung
nahe liegen, dass die oben erwähnten Kernhäufchen einer einzigen Zelle mit einer Brut
von Kernen entsprechen. Die Treue meiner Schilderung nöthigt mich indessen, hinzuzufügen,
dass ich auch manchmal den Eindruck hatte, als oh es sich um ein Häufchen von Bindegewebezellen
handle, dessen Elemente zu einem gemeinsamen Sycuytium Zusammenflüssen. Für diese
Auffassung könnte man zwei Momente geltend machen. Einerseits trifft man gelegentlich in
direkter Nähe der Kemhäufchen Bindegewebezellen, welche den Anschein erwecken, als ob sie
im Begriffe stünden, sich dem Häufchen zuzugesellen (Fig. 15), andererseits verhalten sich die
Kerne auf den später zu schildernden Stadien, wo sie, mit wenig Plasma umgeben, auseinander
rücken, so selbständig, dass man den Eindruck von isolirten Zellen erhält. Es ist mir peinlich,
dass ich trotz der vielen Mühe, die ich auf Klärung dieser Verhältnisse verwendete, einen positiven
Entscheid im einen oder anderen Sinne nicht zu gehen vermag. Wo die späteren Bildungsvorgänge
so eigenartig liegen, halte ich es für doppelt angezeigt, dass man sich nicht von vorgefassten
Meinungen und Analogieschlüssen leiten lasse.
Bemerkt sei weiterhin, dass der dünne Mantel von Plasma, welcher die einzelnen Kerne ■
des manlbeerförmigen Häufchens umgibt, keine Scheidung in ein Ekto- und Endoplasma erkennen
lässt. Die Zahl der zu dem Häufchen vereinigten Kerne ist bei Auricularia nudibrcmchiata
eine ziemlich grosse, insofern ich etwa 10 bis 18 Kerne zu zählen vermochte. Weit geringer
ist ihre Zahl bei den Synaptalarven, wo häufig nur vier Kerne (Fig. 14) zu einem Häufchen
zusammentreten; ihre Zahl kann indessen bis auf sechs oder sieben steigen.
Dass wir es in diesen Kernhäufchen mit den A n la g e n d e r A u r i k u l a r i e n r ä d c h e n
zu thun haben, geht klar aus ihrer weiteren Entwicklung hervor. Als erste Andeutung einer
weiteren Differenzirung lässt sich ein von dem Kernhänfchen ausgeschiedener heller Sekrethallen
nachweisen (Fig. 14 se). Derselbe ist von einer Membran umgeben und nimmt frühzeitig
eine mützenförmige Gestalt an. Wie das jüngste bei Auricularia nudibranchiata beobachtete Stadium
(Fig. 15) lehrt, so liegen der Breitseite des Sekretballens die Mehrzahl der Kerne an, während
auf dem Gipfel nur ein Kern, umgeben von einem Plasmamantel ruht. Ich habe indessen auch
mehrere Stadien beobachtet, wo (und das scheint die Regel zu sein) die gesammten Kerne lediglich
der Breitseite angelagert sind. Zur leichteren Orientirung sei die Breitseite des Sekretballens
auch als die Unterseite bezeichnet, insofern sie stets von der Aussenfläche der Larve
abgewendet liegt. Der mützenförmige Sekretballen flacht sich rasch scheibenförmig ab und nimmt
gleichzeitig durch Verbreiterung des Randes hutförmige Gestalt an. Von oben gesehen erscheint
der Rand schwach wellig ausgebuchtet und bald treten den Ausbuchtungen entsprechend radiär
angeordnete Zapfen auf (Fig. 16), welche sich rasch zu sternförmig vom Centrum ausstrahlenden
Röhren ausziehen (Fig. 17 und 18). Die Entstehung dieser Röhren habe ich früherhin darauf
zurückgeführt, dass innerhalb der äusseren Membran des Sekretballens eine neue wellenförmig
gebuchtete Membran entstehe. Durch erneute Untersuchung hin ich indessen zu der entschieden
richtigeren Auffassung gelangt, dass am scheibenförmigen Rande des Sekretballens eine partielle
VerlÖthung der oberen und unteren Wandung stattfindet. (Fig. 22, rechte Seite). Die nicht ver-
lötheten Partieen treten dann als radiär ausstrahlende Röhren uns entgegen. Ich möchte den
Vorgang etwa der Bildung von Gefässen bei knospenden Medusen vergleichen, wo ebenfalls durch
partielle VerlÖthung zweier Schichten die interradialen, zwischen den nicht verlötheten Canälen
gelegenen Partieen ihre Entstehung nehmen.
Die hutförmige Gestalt des Sekretballens mit seinen sternförmig angeordneten peripheren
Röhren kommt auf späteren Stadien noch deutlicher dadurch zum Ausdruck, dass der Rand sich
aufkrempelt (Fig. 19). Gleichzeitig beginnen die blinden peripheren Enden der röhrenförmigen
Canäle sich gabelförmig zu verbreiten (Fig. 20) und gegenseitig zu einem kreisförmigen Randsinus
zu verschmelzen. Es werden also secundär die auf dem vorhergehenden Stadium verlötheten
äussersten Partieen der Hutkrempe wieder ausgeweitet.
' Unverkennbar tr itt nun die Form des späteren Kalkrädchens durch eine partielle Ver-
lötbung der Membran des hutförmig ausgebreiteten Sekretballens vorbereitet uns entgegen: die
centrale Partie mit dem unter ihr liegenden Kernhanfen entspricht der Narbe (mod.), die sternförmig
angeordneten und im Bögen zur Peripherie ausstrahlenden Röhren vertreten die Speichen
(rad.) und der periphere Ring repräsentirt den Umfang (die Felgen) des Kalkrädchens (rot).
Betrachtet man die ganze Anlage im Profil (Fig. 21), so tr itt auf späteren Stadien die hut-
förmige Gestalt klar hervor. — Die Oberseite des Hütchens ist convex gegen die Aussenfläche
der Larve gewölbt und der ziemlich eben gestalteten Unterfläche sitzen wie Pilze die auseinanderrückenden
Kerne mit ihrem Plasmamantel an. In dem Hutrände verlaufen bogenförmig (die con-
cave Seite des Bogens ist nach aussen gekehrt) die röhrenförmigen Anlagen der Radspeichen.
Je nachdem man auf die Mitte einer Speiche oder auf die zwischen zwei Speichen liegende Partie
einstellt, erhält man entweder das Bild einer breiten gebogenen Röhre oder einer feinen zum
Ringkanal verstreichenden Membran (Fig. 22, rechte Hälfte). Die letztere ist durch VerlÖthung
der oberen und unteren membranösen Wand des Hutrandes entstanden. In der etwas centripetal
eingeschlagenen Hutkrempe verläuft der die Enden der Speichen verbindende Randsinus (rot).
Ferner darf darauf hingewiesen werden, dass von vornherein die Zahl der Speichen durch
die Zahl der radiären Canäle bestimmt wird. Eine nachträgliche Einschaltung von Röhren findet
nicht sta tt und wäre auch nicht möglich, ohne dass die radiäre Anordnung gestört wird. Bekanntlich
schwankt die Zahl der Radspeichen an den Kalkrädchen und zwar bei den Synaptalarven
innerhalb der Ziffern von 12—16, bei den Rädchen der Auricularia nudibranchiata von 13—18.
Man könnte nun auf die Vermutung kommen, dass die schwankende Zahl der Speichen
durch die Anzahl der Kerne bedingt werde, welche der Unterseite der Radanlage ansitzen. Ich
habe indessen eine Kongruenz niemals nachweisen können und wenn es noch eines speziellen Hin