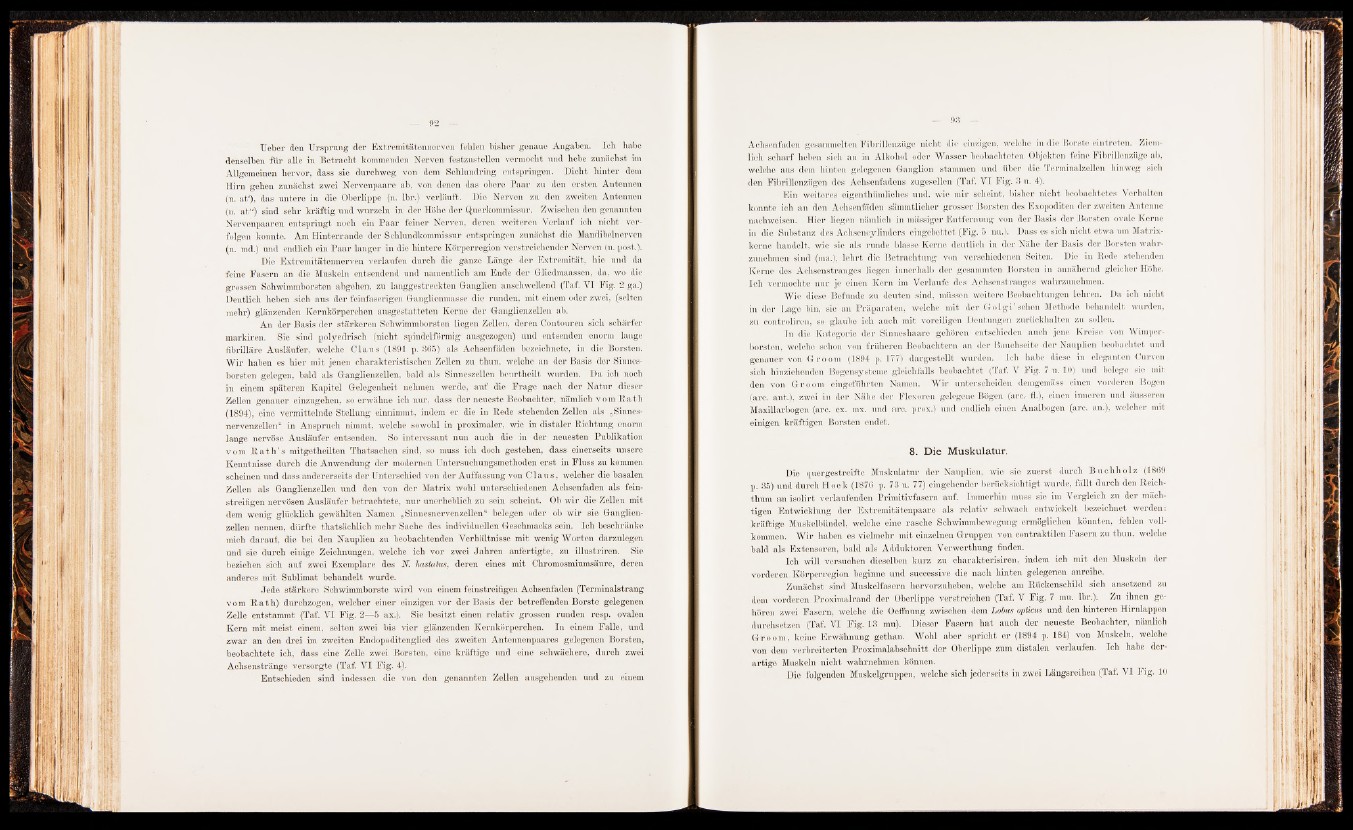
Ueber den Ursprung der Extremitätennerven fehlen bisher genaue Angaben. Ich habe
denselben für alle in Betracht kommenden Nerven festzustellen vermocht und hebe zunächst im
Allgemeinen hervor, dass sie durchweg von dem Schlundring entspringen. Dicht hinter dem
Hirn gehen zunächst zwei Nervenpaare ab, von denen das obere Paar zu den ersten Antennen
(n. at'), das untere in die Oberlippe (n. lbr.) verläuft. Die Nerven zu den zweiten Antennen
(n. at") sind sehr kräftig und wurzeln in- der Höhe der Querkommissur. Zwischen den genannten
Nervenpaaren entspringt noch ein Paar feiner Nerven, deren weiteren Verlauf ich nicht verfolgen
konnte. Am Hinterrande der Schlundkommissur entspringen zunächst die Mandibelnerven
(n. md.) und endlich ein Paar langer in die hintere Körperregion verstreichender Nerven (11. post.).
Die Extremitätennerven verlaufen durch die ganze Länge der Extremität, hie und da
feine Fasern an die Muskeln entsendend und namentlich am Ende der Gliedmaassen, da, wo die
grossen Schwimmborsten abgehen, zu langgestreckten Ganglien anschwellend (Taf. VI Fig. 2 ga.)
Deutlich heben sich aus der feinfaserigen Ganglienmasse die runden, mit einem oder zwei, (selten
mehr) glänzenden Kernkörperchen ausgestatteten Kerne der Ganglienzellen ab.
An der Basis der stärkeren Schwimmborsten liegen Zellen, deren Contouren sich schärfer
markiren. Sie sind polyedrisch (nicht sinndelförmig ausgezogen) und entsenden enorm lange
fibrilläre Ausläufer, welche C lau s (1891 p. 365) als Achsenfäden bezeichnete, in die Borsten.
Wir haben es hier mit jenen charakteristischen Zellen zu thun, welche an der Basis der Sinnesborsten
gelegen, bald als Ganglienzellen, bald als Sinneszellen bcurtheilt wurden. Da ich noch
in einem späteren Kapitel Gelegenheit nehmen werde, auf die Frage nach der Natur dieser
Zellen genauer einzugehen, so erwähne ich nur, dass der neueste Beobachter, nämlich vom R a th
(1894), eine vermittelnde Stellung einnimmt, indem er die in Rede stehenden Zellen als „Sinnesnervenzellen“
in Anspruch nimmt, welche sowohl in proximaler, wie in distaler Richtung enorm
lange nervöse Ausläufer entsenden. So interessant nun auch die in der neuesten Publikation
vom R a th ’s mitgetheilten Thatsachen sind, so muss ich doch gestehen, dass einerseits unsere
Kenntnisse durch die Anwendung der modernen Untersuchungsmethoden erst in Fluss zu kommen
scheinen und dass andererseits der Unterschied von der Auffassung von C la u s , welcher die basalen
Zellen als Ganglienzellen und den von der Matrix wohl unterschiedenen Achsenfaden als feinstreifigen
nervösen Ausläufer betrachtete, nur unerheblich zu sein scheint. Ob wir die Zellen mit
dem wenig glücklich gewählten Namen „Sinnesnervenzellen“ belegen oder ob wir sie Ganglienzellen
nennen, dürfte thatsächlich mehr Sache des individuellen Geschmacks sein. Ich beschränke
mich darauf, die bei den Nauplien zu beobachtenden Verhältnisse mit wenig Worten darzulegen
und sie durch einige Zeichnungen, welche ich vor zwei Jahren anfertigte, zu illustriren. Sie
beziehen sich auf zwei Exemplare des N. Iicistatus, deren eines mit Chromosmiumsäure, deren
anderes mit Sublimat behandelt wurde.
Jede stärkere Schwimmborste wird von einem feinstreifigen Achsenfaden (Terminalstrang
vom R a th ) durchzogen, welcher einer einzigen vor der Basis der betreffenden Borste gelegenen
Zelle entstammt (Taf. VI Kg. 2—5 ax.). Sie besitzt einen relativ grossen runden resp. ovalen
Kern mit meist einem, selten zwei bis vier glänzenden Kernkörperchen. In einem Falle, und
zwar an den drei im zweiten Endopoditenglied des zweiten Antennenpaares gelegenen Borsten,
beobachtete ich, dass eine Zelle zwei Borsten, eine kräftige und eine schwächere, durch zwei
Achsenstränge versorgte (Taf. VI Fig. 4).
Entschieden sind indessen die von den genannten Zellen ausgehenden und zu einem
Achsenfaden gesammelten Fibrillenzügc nicht die einzigen, welche in die Borste eintreten. Ziemlich
scharf heben sich an in Alkohol oder Wasser beobachteten Objekten feine Fibrillenzüge ab,
welche aus dem hinten gelegenen Ganglion stammen und über die Terminalzellen hinweg sich
den Fibrillenzügen des Achsenfadens zugesellen (Taf. VI Fig. 3 u. 4).
Ein weiteres eigenthümliches und. wie mir scheint, bisher nicht beobachtetes Verhalten
konnte ich an den Achsenfäden sämmtlicher grösser Borsten des Exopoditen der zweiten Antenne
nachweisen. Hier liegen nämlich in mässiger Entfernung von der Basis der Borsten ovale Kerne
in die Substanz des Achsencylinders eingebettet (Fig. 5 nu.). Dass es sich nicht etwa um Matrixkerne
handelt, wie sie als runde blasse Kerne deutlich in der Nähe der Basis der Borsten wahrzunehmen
sind (ma.), lehrt die Betrachtung von verschiedenen Seiten. Die in Rede stehenden
Kerne des Achsenstranges liegen innerhall) der gesammten Borsten in annähernd gleicher Höhe.
Ich vermochte nur je einen Kern im Verlaufe des Achsenstranges wahrzunehmen.
Wie diese Befunde zu deuten sind, müssen weitere Beobachtungen lehren. Da ich nicht
in der Lage bin, sie an Präparaten, welche mit der G0l g i ’sehen Methode behandelt wurden,
zu controliren, so glaube ich auch mit voreiligen Deutungen zurückhalten zu sollen.
In die Kategorie der Sinneshaare gehören entschieden auch jene Kreise von Wimperborsten,
welche schon von früheren Beobachtern an der Bauchseite der Nauplien beobachtet und
genauer von Groom (1894 p. 177) dargestellt wurden. Lch habe diese in eleganten Curveu
sich hinziehenden Bogensysteme gleichfalls beobachtet (Taf. V Fig. 7 u. 10) und belege sie mit
den von Groom eingeführten Namen. Wir unterscheiden demgemäss einen vorderen Bogen
(arc. ant.), zwei in der Nähe der Flexoren gelegene Bögen (arc.- fl.), einen inneren und äusseren
Maxillarbogen (arc. ex. mx. und arc. prox.) und endlich einen Analbogen (arc. an.), welcher mit
einigen kräftigen Borsten endet.
8. Die Muskulatur.
Die quergestreifte Muskulatur der Nauplien, wie sie zuerst durch B u c h h o lz (1869
p. 35) und durch Hoek (1876 p. 73 u.' 77) eingehender berücksichtigt wurde, fällt durch den Reichthum
an isolirt verlaufenden Primitivfasern auf. Immerhin muss sie im Vergleich zu der mächtigen
Entwicklung der Extremitätenpaare als relativ schwach entwickelt bezeichnet werden:
kräftige Muskelbündel, welche eine rasche Schwimmbewegung ermöglichen könnten, fehlen vollkommen.
Wir haben es vielmehr mit einzelnen Gruppen von contraktilen Fasern zu thun, welche
bald als Extensoren, bald als Adduktoren Verwerthung finden.
Ich will versuchen dieselben kurz zu charakterisiren, indem ich mit den Muskeln der
vorderen Körperregion beginne und successive die nach hinten gelegenen anreihe.
Zunächst sind Muskelfasern hervorzuheben, welche am Rückenschild sich ansetzend zu
dem vorderen Proximalrand der Oberlippe verstreichen (Taf. V Fig. 7 mu. lbr.). Zu ihnen gehören
zwei Fasern, welche die Oeffnung zwischen dem Lohns opticus und den hinteren Hirnlappen
durchsetzen (Taf. VI Fig. 13 mu). Dieser Fasern hat auch der neueste Beobachter, nämlich
Groom, keine Erwähnung gethan. Wohl aber spricht er (1894 p. 184) von Muskeln, welche
von dem verbreiterten Proximalabschnitt der Oberlippe zum distalen verlaufen. Ich habe derartige
Muskeln nicht wahrnehmen können.
Die folgenden Muskelgruppen, welche sich jederseits in zwei Längsreihen (Taf. VI Fig. 10