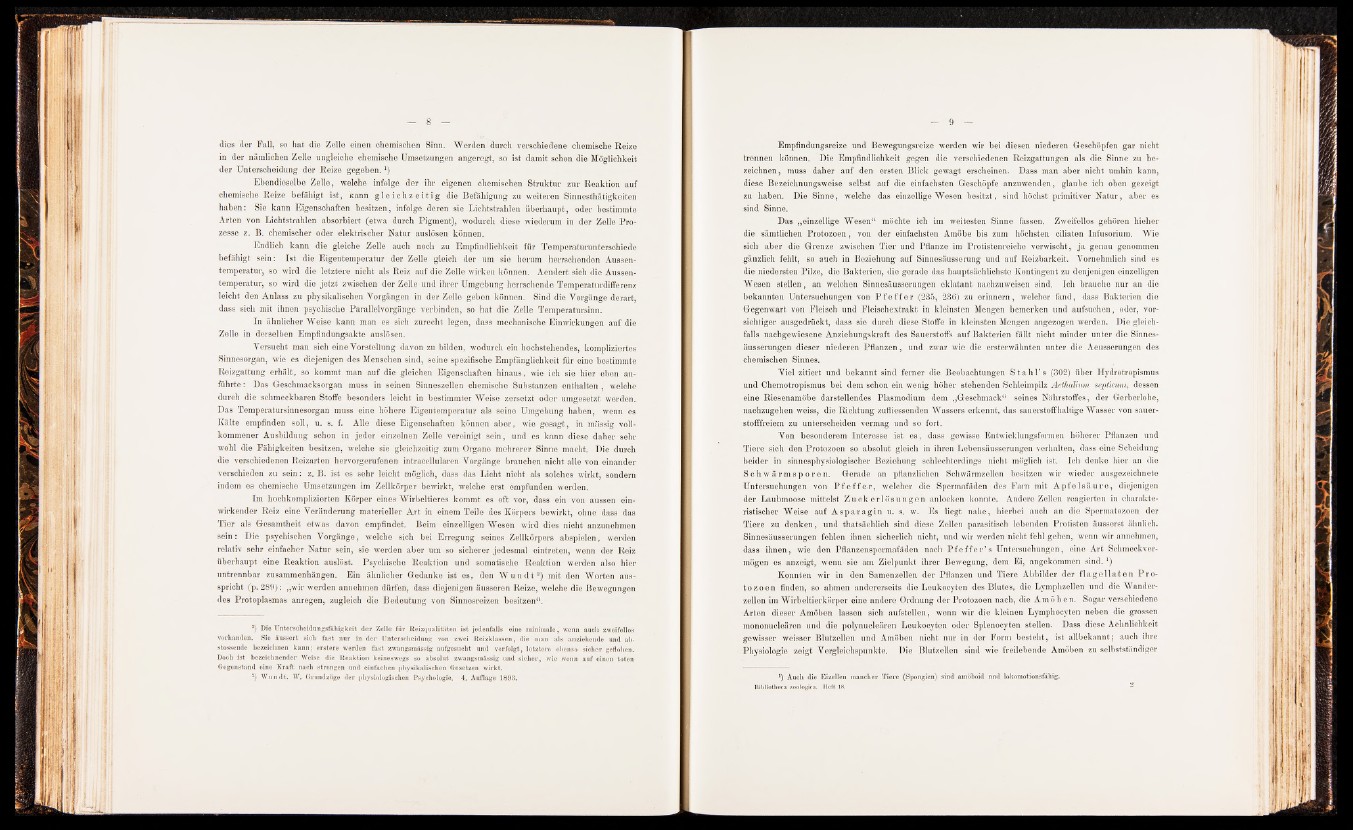
dies der Fall, so hat die Zelle einen chemischen Sinn. Werden durch verschiedene chemische Reize
in der nämlichen Zelle ungleiche chemische Umsetzungen angeregt, so ist damit schon die Möglichkeit
der Unterscheidung der Reize gegeben.J)
Ebendieselbe Zelle, welche infolge der ihr eigenen chemischen Struktur zur Reaktion auf
chemische Reize befähigt ist, kann g l e i c h z e i t ig die Befähigung zu weiteren Sinnesthätigkeiton
haben: Sie kann Eigenschaften besitzen, infolge deren sie Lichtstrahlen überhaupt, oder bestimmte
Arten von Lichtstrahlen absorbiert (etwa durch Pigment), wodurch diese wiederum in der Zelle Prozesse
z. B. chemischer oder elektrischer Natur auslösen können.
Endlich kann die gleiche Zelle auch noch zu Empfindlichkeit für Temperaturunterschiede
befähigt sein: Ist die Eigentemperatur der Zelle gleich der um sie herum herrschenden Aussen-
temperatur, so wird die letztere nicht als Reiz auf die Zelle wirken können. Aendert sich die Aussen-
temperatur, so wird die jetzt zwischen der Zelle und ihrer Umgebung herrschende Temperaturdifferenz
leicht den Anlass zu physikalischen Vorgängen in der Zelle geben können. Sind die Vorgänge derart,
dass sich mit ihnen psychische Parallelvorgänge verbinden, so hat die Zelle Temperatursinn.
In ähnlicher Weise kann man es sich zurecht legen, dass mechanische Einwirkungen auf die
Zelle in derselben Empfindungsakte auslösen.
Versucht man sich eine Vorstellung davon zu bilden, wodurch ein hochstehendes, kompliziertes
Sinnesorgan, wie es diejenigen des Menschen sind, seine spezifische Empfänglichkeit für eine bestimmte
Reizgattung erhält, so kommt man auf die gleichen Eigenschaften hinaus, wie ich sie hier eben anführte
: Das Geschmacksorgan muss in seinen Sinneszellen chemische Substanzen enthalten , welche
durch die schmeckbaren Stoffe besonders leicht in bestimmter Weise zersetzt oder umgesetzt werden.
Das Temperatursinnesorgan muss eine höhere Eigentemperatur als seine Umgebung haben, wenn es
Kälte empfinden soll, u. s. f. Alle diese Eigenschaften können aber, wie gesagt, in mässig vollkommener
Ausbildung schon in jeder einzelnen Zelle vereinigt sein, und es kann diese daher sehr
wohl die Fähigkeiten besitzen, welche sie gleichzeitig zum Organe mehrerer Sinne macht. Die durch
die verschiedenen Reizarten hervorgerufenen intracellularen Vorgänge brauchen nicht alle von einander
verschieden zu sein: z. B. ist es sehr leicht möglich, dass das Licht nicht als solches wirkt, sondern
indem es chemische Umsetzungen im Zellkörper bewirkt, welche erst empfunden werden.
Im hochkomplizierten Körper eines Wirbeltieres kommt es oft vor, dass ein von aussen einwirkender
Reiz eine Veränderung materieller Art in einem Teile des Körpers bewirkt, ohne dass das
Tier als Gesamtheit etwas davon empfindet. Beim einzelligen Wesen wird dies nicht anzunehmen
sein: Die psychischen Vorgänge, welche sich bei Erregung seines Zellkörpers abspielen, werden
relativ sehr einfacher Natur sein, sie werden aber um so sicherer jedesmal cintreten, wenn der Reiz
überhaupt eine Reaktion auslöst. Psychische Reaktion und somatische Reaktion werden also hier
untrennbar Zusammenhängen. Ein ähnlicher Gedanke ist es, den W u n d t2) mit den Worten ausspricht
(p. 289): „wir werden annehmen dürfen, dass diejenigen äusseren Reize, welche die Bewegungen
des Protoplasmas anregen, zugleich die Bedeutung von Sinnesreizen besitzen“.
J) Die Unterscheidungsfälligkeit der Zelle für Reizqualitäten ist jedenfalls eine minimale, wenn auch zweifellos
vorhanden. Sie äussert sich fast nur in der Unterscheidung von zwei Reizklassen, die man als anziehende und ab-
stossende bezeichnen kann; erstere werden fast zwangsmässig aufgesucht und verfolgt, letztere ebenso sicher geflohen.
Doch ist bezeichnender Weise die Reaktion keineswegs so absolut zwangsmässig und sicher, wie wenn auf einen toten
Gegenstand eine Kraft nach strengen und einfachen physikalischen Gesetzen wirkt.
Wundt. W. Grundzüge der physiologischen Psychologie. 4. Auflage 1893.
Empfindungsreize und Bewegungsreize werden wir bei diesen niederen Geschöpfen gar nicht
trennen können. Die Empfindlichkeit gegen die verschiedenen Reizgattungen als die Sinne zu bezeichnen,
muss daher auf den ersten Blick gewagt erscheinen. Dass man aber nicht umhin kann,
diese Bezeichnungsweise selbst auf die einfachsten Geschöpfe anzuwenden, glaube ich oben gezeigt
zu haben. Die Sinne, welche das einzellige Wesen besitzt, sind höchst primitiver Natur, aber es
sind Sinne.
Das „einzellige Wesen“ möchte ich im weitesten Sinne fassen. Zweifellos gehören hieher
die sämtlichen Protozoen, von der einfachsten Amöbe bis zum höchsten ciliaten Infusorium. Wie
sich aber die Grenze zwischen Tier und Pflanze im Protistenreiche verwischt, ja genau genommen
gänzlich fehlt, so auch in Beziehung auf Sinnesäusserung und auf Reizbarkeit. Vornehmlich sind es
die niedersten Pilze, die Bakterien, die gerade das hauptsächlichste Kontingent zu denjenigen einzelligen
Wesen stellen, an welchen Sinnesäusserungen eklatant nachzuweisen sind. Ich brauche nur an die
bekannten Untersuchungen von P f e f f e r (235, 236) zu erinnern, welcher fand, dass Bakterien die
Gegenwart von Fleisch und Fleischextrakt in kleinsten Mengen bemerken und aufsuchen, oder, vorsichtiger
ausgedrückt, dass sie durch diese Stoffe in kleinsten Mengen angezogen werden. Die gleichfalls
nachgewiesene Anziehungskraft des Sauerstoffs auf Bakterien fällt nicht minder unter die Sinnesäusserungen
dieser niederen Pflanzen, und zwar wie die ersterwähnten unter die Aeusserungen des
chemischen Sinnes.
Viel zitiert und bekannt sind ferner die Beobachtungen S t a h l ’s (302) über Hydrotropismus
und Chemotropismus bei dem schon ein wenig höher stehenden Schleimpilz Actlialhmi septicum, dessen
eine Riesenamöbe darstellendes Plasmodium dem „Geschmack“ seines Nährstoffes, der Gerberlohe,
nachzugehen weiss, die Richtung zufliessenden Wassers erkennt, das sauerstoffhaltige Wasser von sauerstofffreiem
zu unterscheiden vermag und so fort.
Von besonderem Interesse ist es, dass gewisse Entwicklungsformen höherer Pflanzen und
Tiere sich den Protozoen so absolut gleich in ihren Lebensäusserungen verhalten, dass eine Scheidung
beider in sinnesphysiologischer Beziehung schlechterdings nicht möglich ist. Ich denke hier an die
S c hw ä rm sp o re n . Gerade an pflanzlichen Schwärmzellen besitzen wir wieder ausgezeichnete
Untersuchungen von Pfe ffe -r, welcher die Spermafäden des Farn mit A p fe ls ä u re , diejenigen
der Laubmoose mittelst Z u ck e rlö su n g en anlocken konnte. Andere Zellen reagierten in charakteristischer
Weise auf A sp a rag in u. s. w. Es liegt nahe, hierbei auch an die Spermatozoen der
Tiere zu denken, und thatsächlich sind diese Zellen parasitisch lebenden Protisten äusserst ähnlich.
Sinnesäusserungen fehlen ihnen sicherlich nicht, und wir werden nicht fehl gehen, wenn wir annehmen,
dass ihnen, wie den Pflanzenspermafäden nach P f e f f e r ’s Untersuchungen, eine Art Schmeckver-
mögen es anzeigt, wenn sie am Zielpunkt ihrer Bewegung, dem Ei, angekommen sind. *)
Konnten wir in den Samenzellen der Pflanzen und Tiere Abbilder der fla g e lla te n Protozoen
finden, so ahmen andererseits die Leukocyten des Blutes, die Lymphzellen und die Wanderzellen
im Wirbeltierkörper eine andere Ordnung der Protozoen nach, die Amöben. Sogar verschiedene
Arten dieser Amöben lassen sich aufstellen, wenn wir die kleinen Lymphocyten neben die grossen
mononucleären und die polynucleären Leukocyten oder Splenocyten stellen. Dass diese Aehnlichkeit
gewisser weisser Blutzellen und Amöben nicht nur in der Form besteht, ist allbekannt; auch ihre
Physiologie zeigt Vergleichspunkte. Die Blutzellen sind wie freilebende Amöben zu selbstständiger
>) Auch die Eizellen mancher Tiere (Spongien) sind amöboid nnd lokomotionsfähig.
Bibliotheca zoologica. Heft 18. %