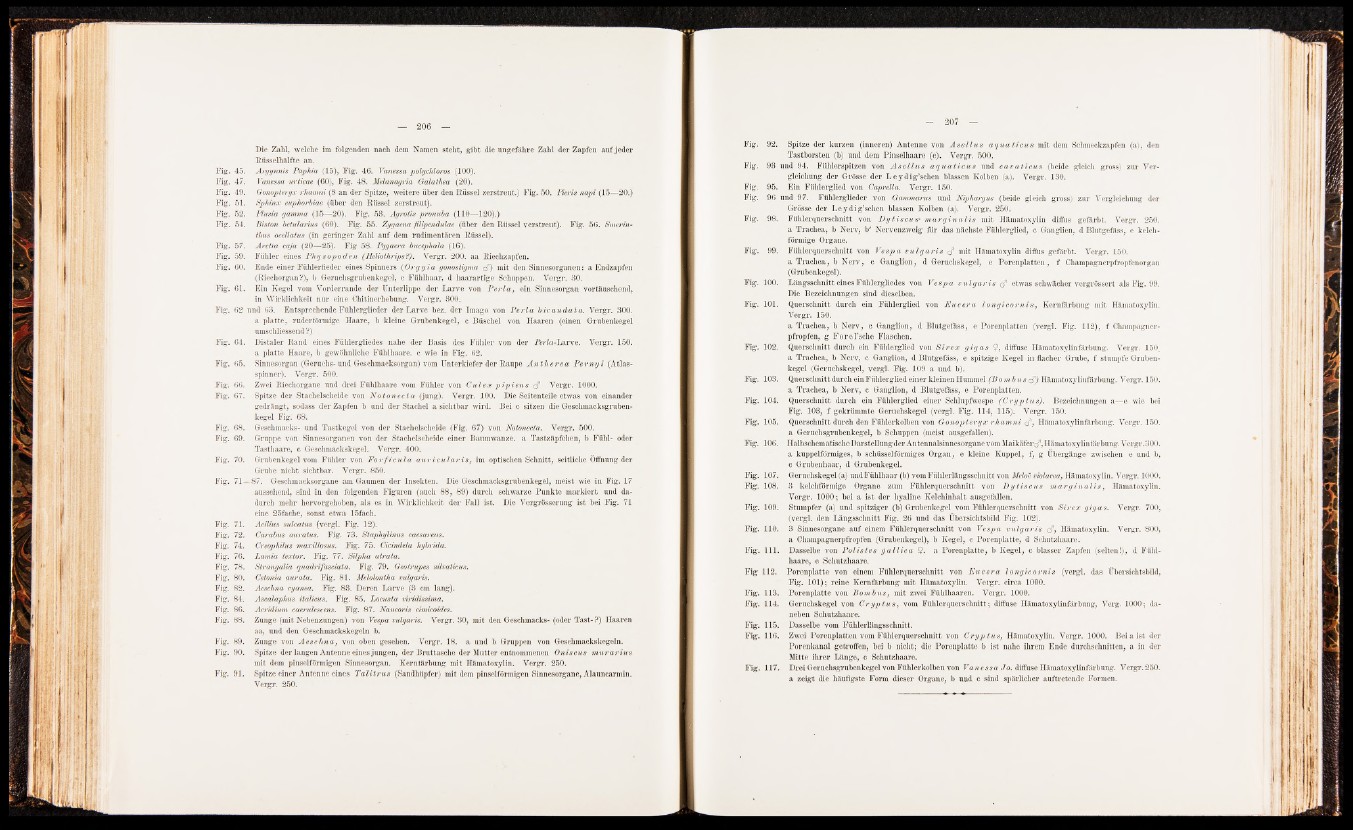
Die Zahl, welche im folgenden nach dem Namen steht, gibt die ungefähre Zahl der Zapfen auf jeder
Rüsselhälfte an.
Fig. 45. Argynnis Paphia (15), Fig. 46. Vanessa polyckloros (100).
Fig. 47. Vanessa urticae (60), Fig. 48. Melanagria Galathea (20).
Fig. 49. Gonopteryx rhamni (8 an der Spitze, weitere über den Rüssel zerstreut.) Fig. 50. Pieris napi (15—20.)
Fig. 51. Sphinx euphorbiae (über den Rüssel zerstreut).
Fig. 52. Plnsia gamma (15—20). Fig. 53. Agrotis pronuba (110—120).)
Fig. 54. Biston betularius (60). Fig. 55. Zygama filipmdulae (über den Rüssel verstreut). Fig. 56. Smerinthus
ocellatus (in geringer Zahl auf dem rudimentären Rüssel).
Fig. 57. Arctia caja (20—25). Fig 58. Pygaera bucepliala (16).
Fig. 59. Fühler eines Phy sopoden (Heliothrips?). Vergr. 200. aa Riechzapfen.
Fig. 60. Ende einer Fühlerfieder eines Spinners (Orgyia gonostigma cf) mit den Sinnesorganen: a Endzapfen
(Riechorgan?), b Geruchsgrubenkegel, c Fiihlhaar, d haarartige Schuppen. Vergr. 30.
Fig. 61. Ein Kegel vom Vorderrande der Unterlippe der Larve von Perla, ein Sinnesorgan vortäuschend,
in Wirklichkeit nur eine Chitinerhebung. Vergr. 300.
Fig. 62 und 63. Entsprechende Fühlerglieder der Larve bez. der Imago von Perla bicaudata. Vergr. 300.
a platte, ruderförmige Haare, b kleine Grubenkegel, c Büschel von Haaren (einen Grubenkegel
umschliessend ?)
Fig. 64. Distaler Rand eines Fühlergliedes nahe der Basis des Fühler von der PeHa-Larve. Vergr. 150.
a platte Haare, b gewöhnliche Fühlhaare. c wie in Fig. 62.
Fig. 65. Sinnesorgan (Geruchs-und Geschmacksorgan) vom Unterkiefer der Raupe Antherea Pernyi (Atlasspinner).
Vergr. 500.
Fig. 66. Zwei Riechorgane und drei Fühlhaare vom Fühler von Culex pipiens cf Vergr. 1000.
Fig. 67. Spitze der Stachelscheide von Notonecta (jung). Vergr. 100. Die Seitenteile etwas von einander
gedrängt, sodass der Zapfen b and der Stachel a sichtbar wird. Bei c sitzen die Geschmacksgrubenkegel
Fig. 68.
Fig. 68. Geschmacks- und Tastkegel von der Stachelscheide (Fig. 67) von Notonecta. Vergr. 500.
Fig. 69. Gruppe von Sinnesorganen von der Stachelscheide einer Baumwanze, a Tastzäpfchen, b Fühl- oder
Tasthaare, c Geschmackskegel. Vergr. 400.
Fig. 70. Grubenkegel vom Fühler von Forficula auricularis, im optischen Schnitt, seitliche Öffnung der
Grube nicht sichtbar. Vergr. 850.
Fig. 71—87. Geschmacksorgane am Gaumen der Insekten. Die Geschmacksgrubenkegel, meist wie in Fig. 17
aussehend, sind in den folgenden Figuren (auch 88, 89) durch schwarze Punkte markiert und dadurch
mehr hervorgehoben, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Die Vergrösserung ist bei Fig. 71
eine 25fache, sonst etwa 15fach.
Acilius sulcatus (vergl. Fig. 12).
Carabus auratus. Fig. 73. Staphylinus caesareus.
Creophilus maxillosus. Fig. 75. Cicindela hybrida.
Lamia textor. Fig. 77. Silpha atrata.
Strangalia quadrifasciata. Fig. 79. Geotrupes silvaticus.
Cetonia aurata. Fig. 81. Melolontha vulgaris.
Aeschna cyanea. Fig. 83. Deren Larve (3 cm lang).
Ascalaphus italicus. Fig. 85. Locusta viridissima.
Acridium caerulescens. Fig. 87. Naucoris cimicoides.
Zunge (mit Nebenzungen) von Vespa vulgaris. Vergr. 30, mit den Geschmacks-(oder Tast-?) Haaren
aa, und den Geschmackskegeln b.
Zunge von Aeschna, von oben gesehen. Vergr. 18. a und b Gruppen von Geschmackskegeln.
Spitze der langen Antenne eines jungen, der Bruttasche der Mutter entnommenen Oniscus murarius
mit dem pinselförmigen Sinnesorgan. Kerntärbung mit Hämatoxylin. Vergr. 250.
Spitze einer Antenne eines Talitrus (Sandhüpfer) mit dem pinselförmigen Sinnesorgane, Alauncarmin.
Vergr. 250.
Fig. 71.
Fig. 72.
Fig.
74.
Fig.
76.
Fig. 78.
Fig. 80.
Fig. 82.
Fig. 84.
Fig. 86.
Fig. 88.
Fig. 89.
Fig. 90.
Fig. 91.
Fig. 92. Spitze der kurzen (inneren) Antenne von Asellus aquaticus mit dem Schmeckzapfen (a), den
Tastborsten (b) und dem Pinselhaare (c). Vergr. 500.
Fig. 93 und 94. Fühlerspitzen von Asellus aqtiaticus und cavaticus (beide gleich gross) zur Vergleichung
der Grösse der Leydig’schen blassen Kolben (a). Vergr. 130.
Fig. 95. Ein Fühlerglied von Caprella. Vergr. 150.
Fig. 96 und 97. Fühlerglieder von Gammarus und Niphargus (beide gleich gross) zur Vergleichung der
Grösse der Leydig’schen blassen Kolben (a). Vergr. 250.
Fig. 98. Fühlerquerschnitt von Dytiscus- murginalis mit Hämatoxylin diffus gefärbt. Vergr. 250.
a Trachea, b Nerv, b' Nervenzweig für das nächste Fühlerglied, c Ganglien, d Blutgefäss, e kelch-
förmige Organe.
Fig. 99. Fühlerquerschnitt von Vespa vulgaris cf mit Hämatoxylin diffus gefärbt. Vergr. 150.
a Trachea, b Nerv, c Ganglion, d Geruchskegel, e Porenplatten, f Champagnerpfropfenorgan
(Grubenkegel).
Fig. 100. Längsschnitt eines Fühlergliedes von Vespa vulgaris cf etwas schwächer vergrössert als Fig. 99.
Die Bezeichnungen sind dieselben.
Fig. 101. Querschnitt durch ein Fühlerglied von Eucera longicornis, Kernfärbung mit Hämatoxylin.
Vergr. 150.
a Trachea, b Nerv, c Ganglion, d Blutgefäss, e Porenplatten (vergl. Fig. 112), f Champagnerpfropfen,
g Forel’sche Flaschen.
Fig. 102. Querschnitt durch ein Fühlerglied von Sirex gigas $, diffuse Hämatoxylinfärbung. Vergr. 150
a Trachea, b Nerv, c Ganglion, d Blutgefäss, e spitzige Kegel in flacher Grube, f stumpfe Grubenkegel
(Geruchskegel, vergl. Fig. 109 a und b).
Fig. 103. Querschnitt durch ein Fühlerglied einer kleinen Hummel (Bombus cf) Hämatoxylinfärbung. Vergr. 150.
a Trachea, b Nerv, c Ganglion, d Blutgefäss, e Porenplatten.
Fig. 104. Querschnitt durch ein Fühlerglied einer Schlupfwespe (Cryptus). Bezeichnungen a—e wie bei
Fig. 103, f gekrümmte Geruchskegel (vergl. Fig. 114, 115). Vergr. 150.
Fig. 105. Querschnitt durch den Fühlerkolben von Gonopteryx rhamni cf, Hämatoxylinfärbung. Vergr. 150.
a Geruchsgrubenkegel, b Schuppen (meist ausgefallen).
Fig. 106. Halbschematische Darstellung der Antennalsinnesorgane vom Maikäfercf, Hämatoxylinfärbung. Vergr. 300.
a kuppelförmiges, b schüsselförmiges Organ, e kleine Kuppel, f, g Übergänge zwischen e und b,
c Grubenhaar, d Grubenkegel.
Fig. 107. Geruchskegel (a) undFühlliaar (b) vom Fühlerlängsschnitt von Meloe violacea, Hämatoxylin. Vergr. 1000.
Fig. 108. 3 kelchförmige Organe zum Fühlerquerschnitt von Dytiscus marginalis, Hämatoxylin.
Vergr. 1000; bei a ist der hyaline Kelchinhalt ausgefallen.
Fig. 109. Stumpfer (a) und spitziger (b) Grubenkegel vom Fühlerquerschnitt von Sirex gigas. Vergr. 700,
(vergl. den Längsschnitt Fig. 26 und das Übersichtsbild Fig. 102).
Fig. 110. 3 Sinnesorgane auf einem Fühlerquerschnitt von Vespa vulgaris cf; Hämatoxylin. Vergr. 800,
a Champagnerpfropfen (Grubenkegel), b Kegel, c Porenplatte, d Schutzhaare.
Fig. 111. Dasselbe von Polistes gallica $. a Porenplatte, b Kegel, c blasser Zapfen (selten!), d Fühlhaare,
e Schutzhaare.
Fig 112. Porenplatte von einem Fühlerquerschnitt von Eucera longicornis (vergl. das Übersichtsbild,
Fig. 101); reine Kernfärbung mit Hämatoxylin. Vergr. circa 1000.
Fig. 113. Porenplatte von Bombus, mit zwei Füblhaaren. Vergr. 1000.
Fig. 114. Geruchskegel von Cryptus, vom Fühlerquerschnitt; diffuse Hämatoxylinfärbung, Verg. 1000; daneben
Schutzhaare.
Fig. 115. Dasselbe vom Fühlerlängsschnitt.
Fig. 116. Zwei Porenplatten vom Fühlerquerschnitt von Cryptus, Hämatoxylin. Vergr. 1000. Bei a ist der
Porenkanal getroffen, bei b nicht; die Porenplatte b ist nahe ihrem Ende durchschnitten, a in der
Mitte ihrer Länge, c Schutzhaare.
Fig. 117. Drei Geruchsgrubenkegel von Fühlerkolben von Vanessa Jo. diffuse Hämatoxylinfärbung. Vergr. 250.
a zeigt die häufigste Form dieser Organe, b und c sind spärlicher auftretende Formen.