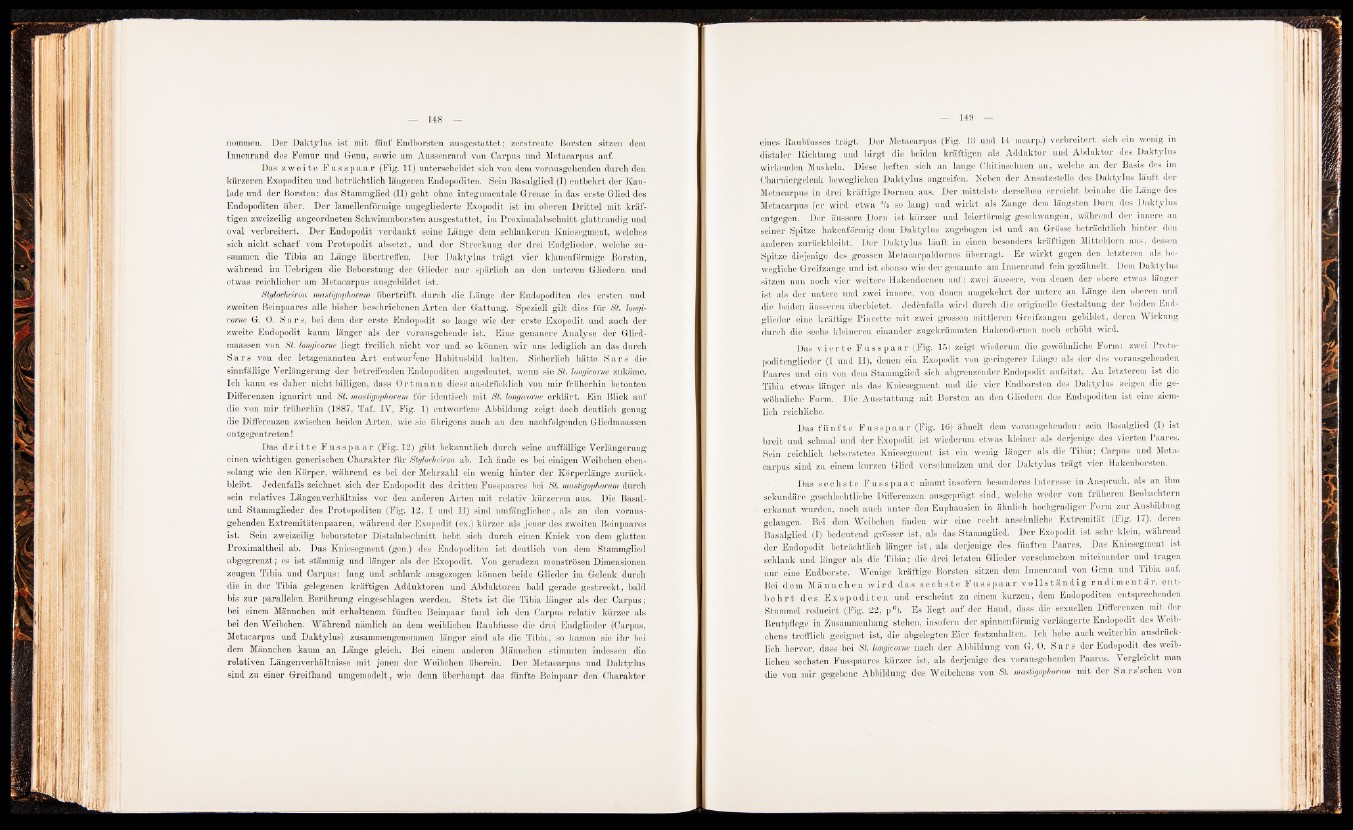
nommen. Der Daktylus ist mit fünf Endborsten ausgestattet; zerstreute Borsten sitzen dem
Innenrand des Femur und Genu, sowie am Aussenrand von Carpus und Metacarpus auf.
Das z w e i t e F u s s p a a r (Fig. 11) unterscheidet sich von dem vorausgehenden durch den
kürzeren Exopoditen und beträchtlich längeren Endopoditen. Sein Basalglied (I) entbehrt der Kau-
lade und der Borsten; das Stammglied (II) geht ohne integumentale Grenze in das erste Glied des
Endopoditen über. Der lamellenförmige ungegliederte Exopodit ist im oberen Drittel mit kräftigen
zweizeilig angeordneten Schwimmborsten ausgestattet, im Proximalabschnitt glattrandig und
oval verbreitert. Der Endopodit verdankt seine Länge dem schlankeren Kniesegment, welches
sich nicht scharf vom Protopodit absetzt, und der Streckung der drei Endglieder, welche zusammen
die Tibia an Länge übertreffen. Der Daktylus trägt vier klauenförmige Borsten,
während im Uebrigen die Beborstung der Glieder nur spärlich an den unteren Gliedern und
etwas reichlicher am Metacarpus ausgebildet ist.
Stylocheiron mastigophonmi übertrifft durch die Länge der Endopoditen des ersten und
zweiten Beinpaares alle bisher beschriebenen Arten der Gattung. Speziell gilt dies für St. longicornc
G. 0. S a r s, bei dem der erste Endopodit so lange wie der erste Exopodit und auch der
zweite Endopodit kaum länger als der vorausgehende ist. Eine genauere Analyse der Glied-
maassen von St. longicornc liegt freilich nicht vor und so können wir uns lediglich an das durch
S a r s von der letzgenannten Art entworfene Habitusbild halten. Sicherlich hätte S a r s die
sinnfällige Verlängerung der betreffenden Endopoditen angedeutet, wenn sie St. longicornc zukäme.
Ich kann es daher nicht billigen, dass O r tm a n n diese ausdrücklich von mir früherhin betonten
Differenzen ignorirt und St. mastigophonmi für identisch mit St. longicornc erklärt. Ein Blick auf
die von mir früherhin (1887, Taf. IV, Fig. 1) entworfene Abbildung zeigt doch deutlich genug
die Differenzen zwischen beiden Arten, wie sie übrigens auch an den nachfolgenden Gliedmaassen
entgegen treten!
Das d r i t t e F u s s p a a r (Fig.. 12) gibt bekanntlich durch seine auffällige Verlängerung
einen wichtigen generischen Charakter für Stylocheiron ab. Ich finde es bei einigen Weibchen ebensolang
wie den Körper, während es bei der Mehrzahl ein wenig hinter der Körperlänge zurückbleibt.
Jedenfalls zeichnet sich der Endopodit des dritten Fusspaares bei St. mastigqphomm durch
sein relatives Längenverhältniss vor den anderen Arten mit relativ kürzerem ans. Die Basalund
Stammglieder des Protopoditen (Fig. 12, I und II) sind umfänglicher, als an den vorausgehenden
Extremitätenpaaren, während der Exopodit (ex.) kürzer als jener des zweiten Beinpaares
ist. Sein zweizeilig beborsteter Distalabschnitt hebt sich durch einen Knick von dem glatten
Proximaltheil ab. Das Kniesegment (gen.) des Endopoditen ist deutlich von dem Stammglied
abgegrenzt; es ist stämmig und länger als der Exopodit. Von geradezu monströsen Dimensionen
zeugen Tibia und Carpus: lang und schlank ausgezogen können beide Glieder im Gelenk durch
die in der Tibia gelegenen kräftigen Adduktoren und Abduktoren bald gerade gestreckt, bald
bis zur parallelen Berührung eingeschlagen werden. Stets ist die Tibia länger als der Carpus;
bei einem Männchen mit erhaltenem fünften Beinpaar fand ich den Carpus relativ kürzer als
bei den Weibchen. Während nämlich an dem weiblichen Raubfusse die drei Endglieder (Carpus,
Metacarpus und Daktylus) zusammengenommen länger sind als die Tibia, so kamen sie ihr bei
dem Männchen kaum an Länge gleich. Bei einem anderen Männchen stimmten indessen die
relativen Längenverhältnisse mit jenen der Weibchen überein. Der Metacarpus und Daktylus
sind zu einer Greifhand umgemodelt, wie denn überhaupt das fünfte Beinpaar den Charakter
eines Raubfüsses trägt. Der Metacarpus (Fig. 13 und 14 mcarp.) verbreitert sich ein wenig in
distaler Richtung und birgt die beiden kräftigen als Adduktor und Abduktor des Daktylus
wirkenden Muskeln. Diese heften sich an lange Chitinsehnen an, welche an der Basis des im
Charniergelenk beweglichen Daktylus angreifen. Neben der Ansatzstelle des Daktylus läuft der
Metacarpus in drei kräftige Dornen aus. Der mittelste derselben erreicht beinahe die Länge des
Metacarpus (er wird etwa 4/s so lang) und wirkt als Zange dem längsten Dorn des Daktylus
entgegen. Der äussere Dorn ist kürzer und leierförmig geschwungen, während der innere an
seiner Spitze hakenförmig dem Daktylus zugebogen ist und an Grösse beträchtlich hinter den
anderen zurückbleibt. Der Daktylus läuft in einen besonders kräftigen Mitteldorn aus, dessen
Spitze diejenige des grossen Metacarpaldornes überragt. Er wirkt gegen den letzteren als bewegliche
Greifzange und ist ebenso wie der genannte am Innenrand fein gezähnelt. Dem Daktylus
sitzen nun noch vier weitere Hakendornen auf: zwei äussere, von denen der obere etwas länger
ist als der untere und zwei innere, von denen umgekehrt der untere an Länge den oberen und
die beiden äusseren iiberbietet. Jedenfalls wird durch die originelle Gestaltung der beiden Endglieder
eine kräftige Pincette mit zwei grossen mittleren Greifzangen gebildet, deren Wirkung
durch die sechs kleineren einander zugekrümmten Hakendornen noch erhöht wird.
Das v i e r t e F u s s p a a r (Fig. 15) zeigt wiederum die gewöhnliche Form: zwei Proto-
poditenglieder (I und H), denen ein Exopodit von geringerer Länge als der des vorausgehenden
Paares und ein von dem Stammglied sich abgrenzender Endopodit aufsitzt. An letzterem ist die
Tibia etwas länger als das Kniesegment und die vier Endborsten des Daktylus zeigen die gewöhnliche
Form. Die Ausstattung mit Borsten an den Gliedern des Endopoditen ist eine ziemlich
reichliche.
Das f ü n f t e F u s s p a a r (Fig. 16) ähnelt dem vorausgehenden: sein Basalglied (I) ist
breit und schmal und der Exopodit ist wiederum etwas kleiner als derjenige des vierten Paares.
Sein reichlich beborstetes Kniesegment ist ein wenig länger als die Tibia; Carpus und Metacarpus
sind zu einem kurzen Glied verschmolzen und der Daktylus trägt vier Hakenborsten.
Das s e c h s t e F u s s p a a r nimmt insofern besonderesinteresse in Anspruch, als an ihm
sekundäre geschlechtliche Differenzen ausgeprägt sind, welche weder von früheren Beobachtern
erkannt wurden, noch auch unter den Euphausien in ähnlich hochgradiger Form zur Ausbildung
gelangen. Bei dem Weibchen finden wir eine recht ansehnliche Extremität (Fig. 17), deren
Basalglied (I) bedeutend grösser ist, als das Stammglied. Der Exopodit ist sehr klein, während
der Endopodit beträchtlich länger ist, als derjenige des fünften Paares. Das Kniesegment ist
schlank und länger als die Tibia; die drei letzten Glieder verschmelzen miteinander und tragen
nur eine Endborste. Wenige kräftige Borsten sitzen dem Innenrand von Genu und Tibia auf.
Bei dem M ä n n c h e n w i r d d a s s e c h s t e F u s s p a a r v o l l s t ä n d i g r u d im e n t ä r , e n tb
e h r t d e s E x o p o d it e n und erscheint zu einem kurzen, dem Endopoditen entsprechenden
Stummel reducirt (Fig. 22, p 6). Es liegt auf der Hand, dass die sexuellen Differenzen mit der
Brutpflege in Zusammenhang stehen, insofern der spinnenförmig verlängerte Endopodit des Weibchens
trefflich geeignet ist, die abgelegten Eier festzuhalten. Ich hebe auch weiterhin ausdrücklich
hervor, dass bei St. longicornc nach der Abbildung von G. 0. S a r s der Endopodit des weiblichen
sechsten .Fusspaares kürzer ist, als derjenige des vorausgehenden Paares. Vergleicht man
die von mir gegebene Abbildung des Weibchens von St. mastigophornm mit der S a r s sehen von