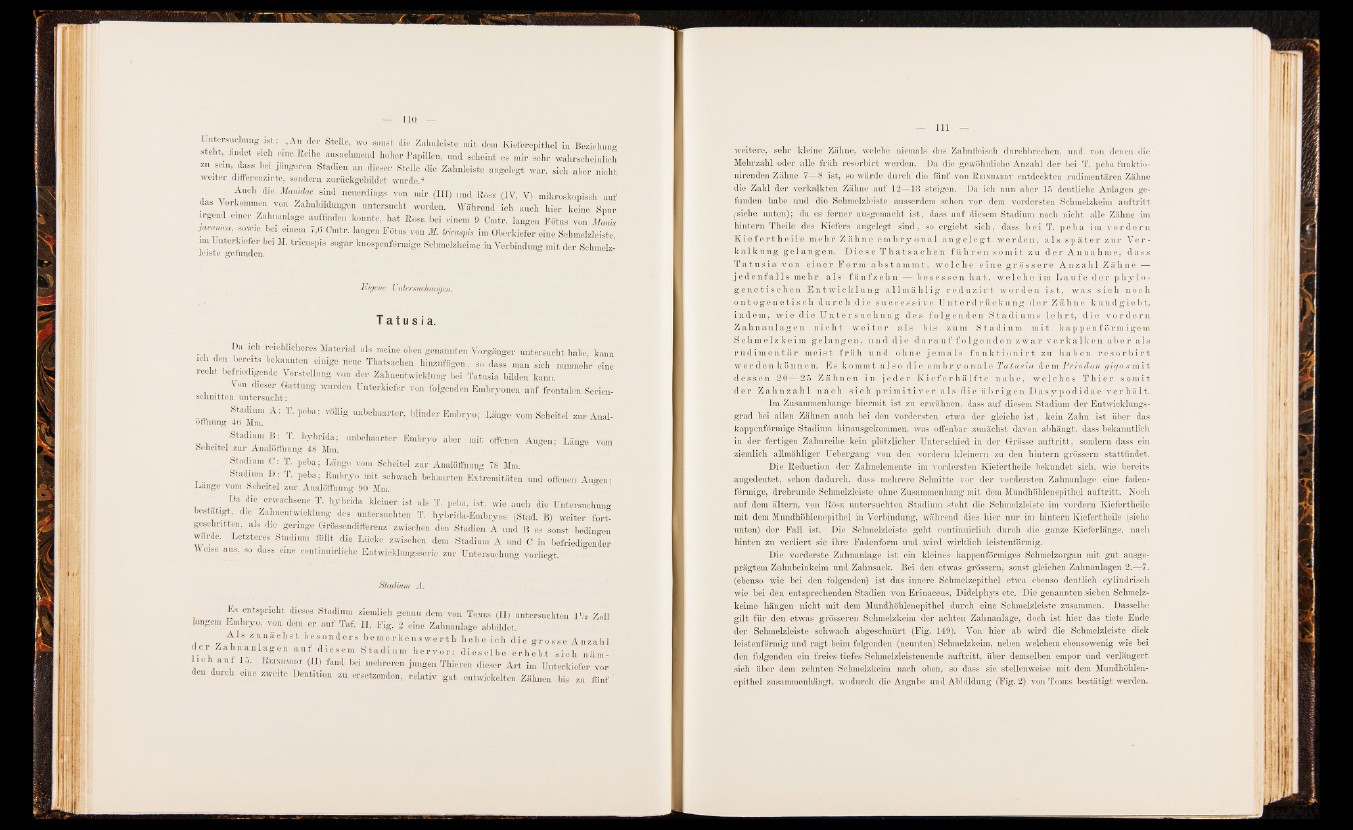
Untersuchung ist: „An der Stelle, wu sonst die Zahnleiste mit dem Kieferepithel in Beziehung
steht, findet sieh eine Reihe ausnehmend hoher Papillen, und scheint es mir sehr wahrscheinlich
zu sein, dass: bei jüngeren Stadien an dieser Stelle die Zahnleiste. angelegt war, sich aber nicht
weiter differenzirte, sondern zurückgebildet wurde.“
. Auch die Mandat sind neuerdings von mir (Hl) und Röse (IV, V) mikroskopisch auf
das Vorkommen von Zahnbildungen untersucht worden. Während ich auch hier keine Spur
irgend einer Zahnanlage auffinden konnte, hat Röse bei einem 9 Cmtr. langen Fötus Von Monis
1S0™ 1,01 einem 7’6 Cmtr- la»S°nFötus von M trimspis im Oberkiefer eine,Sehmelzleiste,
im Unterkiefer bei M. tncuspis sogar knospenförmige Schmelzkeime in Verbindung mit der Schmelz-
leiste gefunden.
Eigene Untersuchungen.
T a t u s i a .
Da ich reichlicheres Material als meine oben gekannten Vorgänger untersucht habe, kann
ich den bereits bekannten einige neue Thafsaohen hinzufügen, so dass man sich nuninehr eine
recht befriedigende Vorstellung von der Zahnentwicklnng bei Tatusia bilden kann.
Von dieser Gattung wurden Unterkiefer von folgenden Embryonen auf frimtaieu Serien-
sennitten untersucht:
Stadium A: T. peba; völlig unbehaarter, blinder Embryo; Länge vom Scheitel zur Anal-
oirnung 46 Mm.
Stadium B: T. hybrida; unbehaarter Embryo aber mit offenen Augen; Länge vom
öcheitel-zur Analöffnung 48 Mm. . ...
Stadium C: T. peba; Länge vom Scheitel zur Analöffnung 78 Mm.
Stadium D: T. peba; Embryo mit schwach behaarten Extremitäten und offenen Augen-
Lange vom Scheitel zur Analöffnung 90 Mm.
. M iDa die «-wacl,sene T. hybrida kleiner ist als T. peba, ist, wie aucl, diu Untersuchung
bestätigt, die Zahnentwicklnng des untersuchten T. hybrida-Embryös (Stad. B) weiter fortgeschritten,
als die geringe Grössendifferenz'zwischen den Stadien A und B es -somit bedingen
wurde. Letzteres Stadium füllt die Lücke zwischen dem Stadium A und C in befriedigender
Weise aus, so dass eine continnirliehe Entwicklungsserie -zur Untersuchung vorliegt. .......
• Stadium A.
Es entspricht fiieses. Stadium ziemlich genau dem von Tomes-®; untersuchten IV. Zoll
langem Embryo, von dem er. auf Taf. H, Fig. 2 eine Zahnanlage abbildet.
H ^-l s z u n ä c h s t b e s o n d e r s b eme r k e n swe r t ! ! h e b e i ch di e g ro s s o An z a h l
d e r Z a h n a n l a g e n a u f d i e s em S t a d i um h e r v o r : d i e s e lb e e r h e b t s i e h nä-m-
ic h a u f 15. R einiiaudt (II) fand bei mehreren jungen Thieren dieser Art im Unterkiefer vor
den durch eine zweite Dentition'zu.ersetzenden, „relativ gut entwickelten Zähnen bis zu fünf
— i n B
weitere, sehr kleine Zähne, welche niemals das Zahnfleisch durchbrechenj und von denen die
Mehrzahl oder alle früh resorbirt werden. Da die gewöhnliche Anzahl der bei T. peba funktio-
nirenden Zähne 7— 8 ist, so würde durch die fünf von R einhardt entdeckten rudimentären Zähne
die Zahl der verkalkten Zähne auf 12—13 steigen. Da ich nun aber 15 deutliche Anlagen gefunden
habe und die Schmelzleiste -ausserdem schon vor dem vordersten Schmelzkeim auftritt
/siehe unten); da es ferner ausgemacht ist, dass auf diesem Stadium noch nicht alle Zähne im
hintern Theile des Kiefers angelegt sind, so ergiebt sich, dass. b e i T. pe ba im v o r d em
K i e f e r t h e i l e me h r Zä h n e emb r y o n a l a n g e l e g t werden, a l s s p ä t e r zu r V e r k
a l k u n g g e l an ge n. Di e s e T h a t s a c k e n f ü h r e n s omi t zu de r An nahme , d a s s
T a t u s i a von e i n e r F o rm ab s t ammt , we l c h e e i n e g r ö s s e r e An z a h l Zä h n e —
j e d e n f a l l s mehr a l s f ü n f z e h n —^ b e s e s s e n h a t , we l c h e im L a u f e de r p h y l o g
e n e t i s c h e n E n tw i c k l u n g a l lmä k l i g r e d u z i r t wo r d e n i s t , was .sich noch
o n t o g e n e t i s c h d u r c h d ie su c c e s s i v e U n t e r d r ü c k u n g de r Zä h n e k u n d g i e b t ,
indem, w i e di e U n t e r s u c h u n g des fo l g e n d e n S t a d i ums l e h r t , d i e v o r d em
Zahnan l ' a g e n n i c h t we i t e r a l s bis zum S t a d i um mi t k a p p e n f ö rmi g em
Schme l z k e im gelangen , und d ie d a r a u f f o l g e n d e n zwa r v e r k a l k e n a b e r als
r u d im e n t ä r meis t f r ü h u n d ohn e j ema l s f u n k t i o n i r t zu h a b e n r e s o r b i r t
we r d e n können . Es kommt a l s o d ie emb r y ona l e T a tu sia dem Priodon gigas mit
des^sen 20 — 25 Z ä h n e n in j e d e r K i e f e r h a l f t e na he , we l ch e s T h i e r somi t
' d e r Z a h n z a h l na c h s i c h P r im i t i v e r a l s d i e ü b r i g e n Da s y p o d i d a e v e r h ä l t .
Im Zusammenhänge hiermit ist zu erwähnen, dass auf diesem Stadium der Entwicklungsgrad
bei allen Zähnen auch bei den vordersten etwa der gleiche ist, kein Zahn ist über das
kappenförmige Stadium hinausgekommen, was offenbar zunächst davon abhängt, dass bekanntlich
in der fertigen Zahnreihe kein plötzlicher Unterschied in der Grösse auftritt, sondern dass ein
ziemlich allmähliger Uebergang von den vordem kleinern zu den hintern grössern stattfindet.
Die Reduction der Zahnelemente im vordersten Kiefertheile bekundet sich, wie bereits
angedeutet, schon dadurch, dass mehrere Schnitte vor der vordersten Zahnanlage eine fadenförmige,
drehrunde Schmelzleiste ohne Zusammenhang mit dem Mundhöhlenepithel auftritt. Noch
auf dem ältern, von Röse untersuchten Stadium steht die Schmelzleiste im vordem Kiefertheile
mit dem Mundhöhlenepithel in Verbindung, während dies hier nur im hintern Kiefertheile (siehe
unten) der Fall ist. Die Schmelzleiste geht continuirliclr durch die ganze Kieferlänge, nach
hinten zu verliert sie ihre Fadenform und wird wirklich leistenförmig.
Die vorderste Zahnanlage ist ein kleines kappenförmiges Schmelzorgan mit gut ausgeprägtem
Zahnbeinkeim und Zahnsack. Bei den etwas grössern,- sonst gleichen Zahnanlagen 2.—7.
(ebenso wie bei den folgenden) ist das innere Schmelzepithel etwa ebenso deutlich cylindrisch
wie bei den entsprechenden Stadien von Erinaceus, Didelphys etc. Die genannten sieben Schmelzkeime
hängen nicht mit dem Mundhöhlenepithel durch eine Schmelzleiste zusammen. Dasselbe
gilt für den etwas grösseren Schmelzkeim der achten Zahnanlage, doch ist hier das tiefe Ende
der Schmelzleiste schwach abgeschnürt (Fig. 149). Von hier ab wird die Schmelzleiste dick
leistenförmig und ragt beim folgenden (neunten) Schmelzkeim, neben welchem ebensowenig wie bei
den folgenden ein freies tiefes Schmelzleistenende auftritt, über demselben empor und verlängert
sich über dem zehnten Schmelzkeim nach oben, so dass sie stellenweise mit dem Mundhöhlenepithel
zusammenhängt, wodurch die Angabe und Abbildung (Fig. 2) von T omes bestätigt werden.