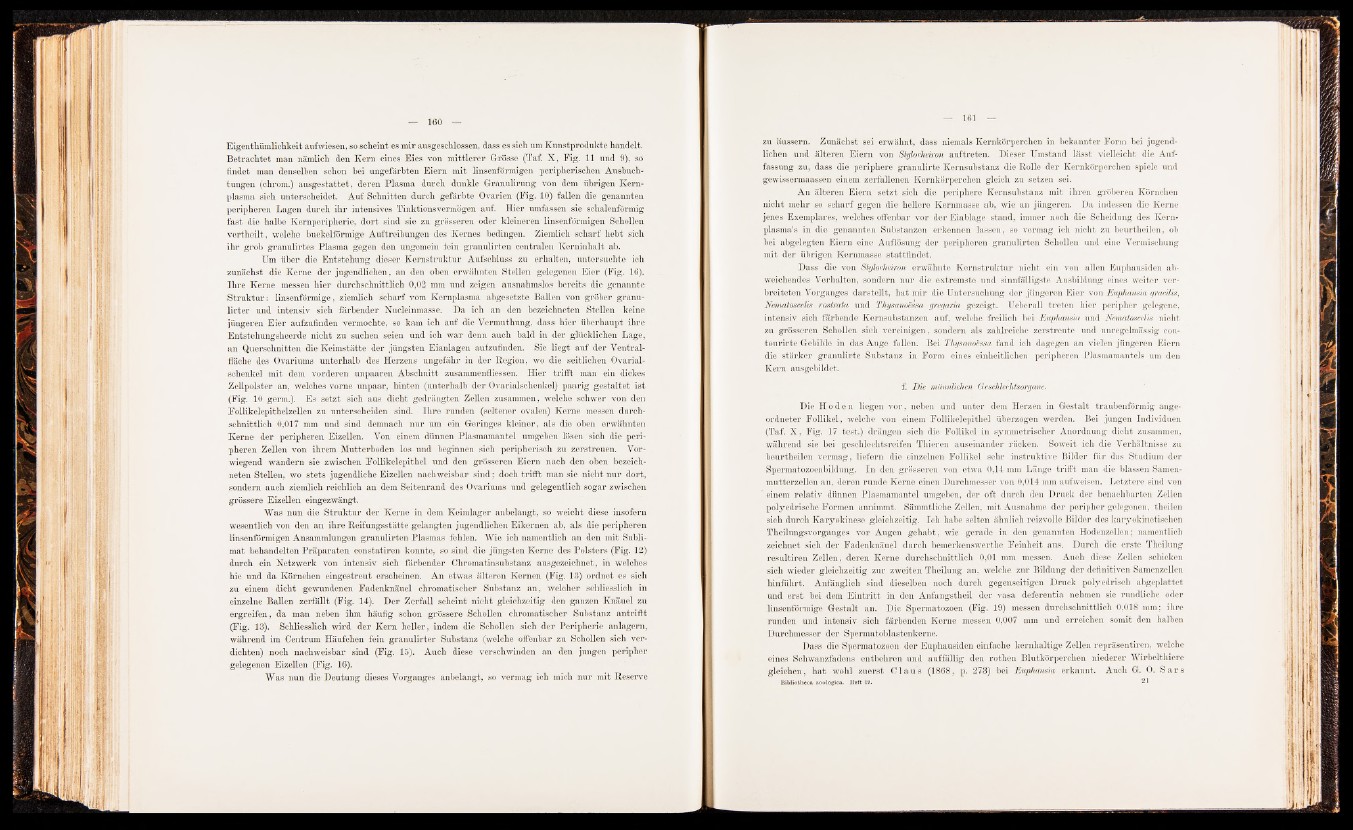
Eigentümlichkeit aufwiesen, so scheint es mir ausgeschlossen, dass es sich um Kunstprodukte handelt.
Betrachtet man nämlich den Kern eines Eies von mittlerer Grösse (Taf. X, Fig. 11 und 9), so
findet man denselben schon bei ungefärbten Eiern mit linsenförmigen peripherischen Ausbuchtungen
(chrom.) ausgestattet, deren Plasma durch dunkle Granulirung von dem übrigen Kernplasma
sich unterscheidet. Auf Schnitten durch gefärbte Ovarien (Fig. 10) fallen die genannten
peripheren Lagen durch ihr intensives Tinktionsvermögen auf. Hier umfassen sie schalenförmig
fast die halbe Kernperipherie, dort sind sie zu grösseren oder kleineren linsenförmigen Schollen
vertheilt, welche buckelförmige Auftreibungen des Kernes bedingen. Ziemlich scharf hebt sich
ihr grob granulirtes Plasma gegen den ungemein fein granulirten centralen Kerninhalt ab.
Um über die Entstehung dieser Kernstruktur Aufschluss zu erhalten, untersuchte ich
zunächst die Kerne der jugendlichen, an den oben erwähnten Stellen gelegenen Eier (Fig. 16).
Ihre Kerne messen hier durchschnittlich 0,02 mm und zeigen ausnahmslos bereits die genannte
Struktur: linsenförmige, ziemlich scharf vom Kernplasma abgesetzte Ballen von gröber granfi-
lirter und intensiv sich färbender Nucleinmasse. Da ich an den bezeichneten Stellen keine
jüngeren Eier aufzufinden vermochte, so kam ich auf die Vermuthung, dass hier überhaupt ihre
Entstehungsheerde nicht zu suchen seien und ich war denn auch bald in der glücklichen Lage,
an Querschnitten die Keimstätte der jüngsten Eianlagen aufzufinden. Sie liegt auf der Ventralfläche
des Ovariums unterhalb des Herzens ungefähr in der Region, wo die seitlichen Ovarial-
schenkel mit dem vorderen unpaaren Abschnitt zusammenfliessen. Hier trifft man ein dickes
Zellpolster an, welches vorne unpaar, hinten (unterhalb der Ovarialschenkel) paarig gestaltet ist
(Fig. 10 germ.). Es setzt sich aus dicht gedrängten Zellen zusammen, welche schwer von den
Follikelepithelzellen zu unterscheiden sind. Ihre runden (seltener ovalen) Kerne messen durchschnittlich
0,017 mm und sind demnach nur um ein Geringes kleiner, als die oben erwähnten
Kerne der peripheren Eizellen. Von einem dünnen Plasmamantel umgeben lösen sich die peripheren
Zellen von ihrem Mutterboden los und beginnen sich peripherisch zu zerstreuen. Vorwiegend
wandern sie zwischen Follikelepithel und den grösseren Eiern nach den oben bezeichneten
Stellen, wo stets jugendliche Eizellen nachweisbar sind; doch trifft man sie nicht nur dort,
sondern auch ziemlich reichlich an dem Seitenrand des Ovariums und gelegentlich sogar zwischen
grössere Eizellen eingezwängt.
Was nun die Struktur der Kerne in dem Keimlager anbelangt, so weicht diese insofern
wesentlich von den an ihre Reifungsstätte gelangten jugendlichen Eikernen ab, als die peripheren
linsenförmigen Ansammlungen granulirten Plasmas fehlen. Wie ich namentlich an den mit Sublimat
behandelten Präparaten constatiren konnte, so sind die jüngsten Kerne des Polsters (Fig. 12)
durch ein Netzwerk von intensiv sich färbender Chromatinsubstanz ausgezeichnet, in welches
hie und da Körnchen eingestreut erscheinen. An etwas älteren Kernen (Fig. 18) ordnet es sich
zu einem dicht gewundenen Fadenknäuel chromatischer Substanz an, welcher schliesslich in
einzelne Ballen zerfällt (Fig. 14). Der Zerfall scheint nicht gleichzeitig den ganzen Knäuel zu
ergreifen, da man neben ihm häufig schon grössere Schollen chromatischer Substanz antrifft
(Fig. 13). Schliesslich wird der Kern heller, indem die Schollen sich der Peripherie anlagern,
während im Centrum Häufchen fein granulirter Substanz (welche offenbar zu Schollen sich verdichten)
noch nachweisbar sind (Fig. 15). Auch diese verschwinden an den jungen peripher
gelegenen Eizellen (Fig. 16).
Was nun die Deutung dieses Vorganges anbelangt, so vermag ich mich nur mit Reserve
zu äussern. Zunächst sei erwähnt, dass niemals Kernkörperchen in bekannter Form bei jugendlichen
und älteren Eiern von Stylocheiron auftreten. Dieser Umstand lässt vielleicht die Auffassung
zu, dass die periphere granulirte Kernsubstanz die Rolle der Kernkörperchen spiele und
gewissermaassen einem zerfallenen Kernkörperchen gleich zu setzen sei.
An älteren Eiern setzt sich die periphere Kernsubstanz mit ihren gröberen Körnchen
nicht mehr so scharf gegen die hellere Kernmasse ab, wie an jüngeren. Da indessen die Kerne
jenes Exemplares, welches offenbar vor der Eiablage stand, immer noch die Scheidung des Kern-
plasma’s in die genannten Substanzen erkennen lassen, so vermag ich nicht zu beurtheilen, ob
bei abgelegten Eiern eine Auflösung der peripheren granulirten Schollen und eine Vermischung
mit der übrigen Kernmasse stattfindet.
Dass die von Stylocheiron erwähnte Kernstruktur nicht ein von allen Euphausiden abweichendes
Verhalten, sondern nur die extremste und sinnfälligste Ausbildung eines weiter verbreiteten
Vorganges darstellt, hat mir die Untersuchung der jüngeren Eier von Euphausia grac.ilis,
Nematoscelis rostrota und Thysanoessa gregaria gezeigt. Ueberall treten hier peripher gelegene,
intensiv sich färbende Kernsubstanzen auf, welche freilich bei Euphausia und Nematoscelis nicht
zu grösseren Schollen sich vereinigen, sondern als zahlreiche zerstreute und unregelmässig con-
tourirte Gebilde in das Auge fallen. Bei Thysanoessa fand ich dagegen an vielen jüngeren Eiern
die stärker granulirte Substanz in Form eines einheitlichen peripheren Plasmamantels um den
Kern ausgebildet.
f. Die männlichen Geschlechtsorgane.
Die H o d e n liegen vor, neben und unter dem Herzen in Gestalt traubenförmig angeordneter
Follikel, welche von einem Follikelepithel überzogen werden. Bei jungen Individuen
(Taf. X, Fig. 17 test.) drängen , sich die Follikel in symmetrischer Anordnung dicht zusammen,
während sie bei geschlechtsreifen Thieren auseinander rücken. Soweit ich die Verhältnisse zu
beurtheilen vermag, liefern die einzelnen Follikel sehr instruktive Bilder für das Studium der
Spermatozoenbildung. In den grösseren von etwa 0,14 mm Länge trifft man die blassen Samenmutterzellen
an, deren runde Kerne einen Durchmesser von 0,014 mm aufweisen. Letztere sind von
* einem relativ dünnen Plasmamantel umgeben, der oft durch den Druck der benachbarten Zellen
polyedrische Formen annimmt. Sämmtliche Zellen, mit Ausnahme der peripher gelegenen, theilen
sich durch Karyokinese gleichzeitig. Ich habe selten ähnlich reizvolle Bilder des karyokinetischen
Theilungsvorganges vor Augen gehabt, wie gerade in den genannten Hodenzellen; namentlich
zeichnet sich der Fadenknäuel durch bemerkenswerthe Feinheit aus. Durch die erste Theilung
resultiren Zellen, deren Kerne durchschnittlich 0,01 mm messen. Auch diese Zellen schicken
sich wieder gleichzeitig zur zweiten Theilung an, welche zur Bildung der definitiven Samenzellen
hinführt. Anfänglich sind dieselben noch durch gegenseitigen Druck polyedrisch abgeplattet
und erst bei dem Eintritt in den Anfangstheil der vasa deferentia nehmen sie rundliche oder
linsenförmige Gestalt an. Die Spermatozoen (Fig. 19) messen durchschnittlich 0,018 mm; ihre
runden und intensiv sich färbenden Kerne messen 0,007 mm und erreichen somit den halben
Durchmesser der Spermatoblastenkerne.
Dass die Spermatozoen der Euphausiden einfache kernhaltige Zellen repräsentiren, welche
eines Schwanzfadens entbehren und auffällig den rothen Blutkörperchen niederer Wirbelthiere
gleichen, hat wohl zuerst C la u s (1868, p. 278) bei Euphausia erkannt. Auch G. O. S a r s
Bibliotheca zoologica. Heft 19. 21