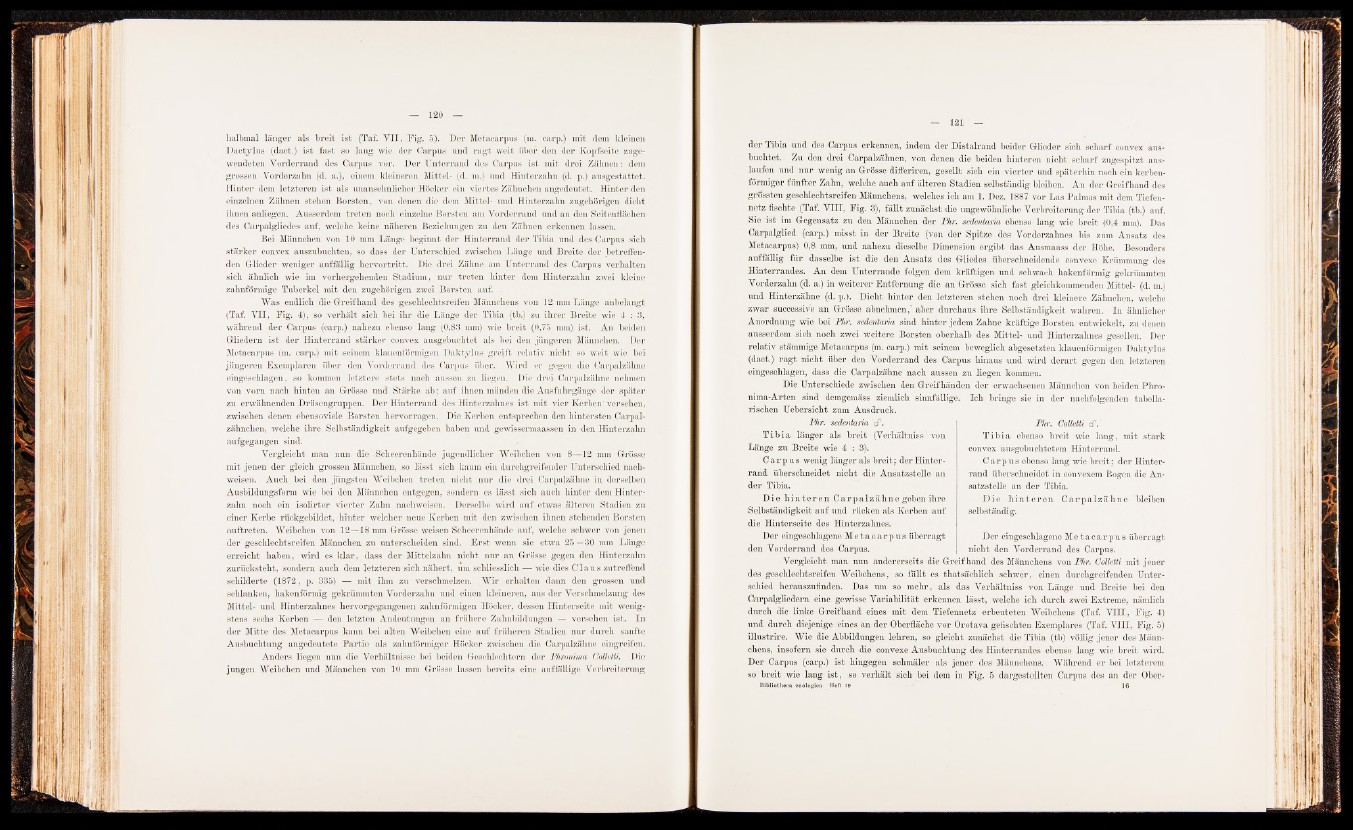
halbmal länger als breit ist (Taf. VII, Fig. 5). Der Metacarpus (m. carp.) mit dem kleinen
Dactylns (dact.) ist fast so lang wie der Carpus und ragt weit über den der Kopfseite zugewendeten
Vorderrand des Carpus vor. Der Unterrand des Carpus ist mit drei Zähnen: dem
grossen Vorderzakn (d. a.), einem kleineren Mittel- (d. m.) und Hinterzabn (d. p.) ausgestattet.
Hinter dem letzteren ist als unansebnlicker Höcker ein viertes Zäkncben angedeutet. Hinter den
einzelnen Zähnen stehen Borsten, von denen die dem Mittel- und Hinterzahn zugehörigen dicht
ihnen anliegen. Ausserdem treten noch einzelne Borsten am Vorderrand und an den Seitenflächen
des Carpalgliedes auf, welche keine näheren Beziehungen zu den Zähnen erkennen lassen.
Bei Männchen von 10 mm Länge beginnt der Hinterrand der Tibia und des Carpus sich
stärker convex auszubuchten, so dass der Unterschied zwischen Länge und Breite der betreffenden
Glieder weniger auffällig hervortritt. Die drei Zähne am Unterrand des Carpus verhalten
sich ähnlich wie im vorhergehenden Stadium, nur treten hinter dem Hinterzahn zwei kleine
zahnförmige Tuberkel mit den zugehörigen zwei Borsten auf. .
Was endlich die Greifhand des geschlechtsreifen Männchens von 12 mm Länge anbdangfc
(Taf. VII, Fig. 4), so verhält sich bei ihr die Länge der Tibia (tb.) zu ihrer Breite wie 4 : 3,
während der Carpus (carp.) nahezu ebenso lang (0,83 mm) wie breit (0,75 mm) ist. An beiden
Gliedern ist der Hinterrand stärker convex ausgebuchtet als bei den jüngeren Männchen. Der
Metacarpus (m. carp.) mit seinem klauenförmigen Daktylus greift relativ nicht so weit wie bei
jüngeren Exemplaren über den Vorderrand des Carpus über. Wird er gegen die Carpalzähne
eingeschlagen, so kommen letztere stets nach aussen zu liegen. Die drei Carpalzähne nehmen
von vorn nach hinten an Grösse und Stärke ab; auf ihnen münden die Ausfuhrgänge der später
zu erwähnenden Drüsengruppen. Der Hinterrand des Hinterzahnes ist mit vier Kerben' versehen,
zwischen denen ebensoviele Borsten hervorragen. Die Kerben entsprechen den hintersten Carpal-
zähnchen, welche ihre Selbständigkeit aufgegeben haben und gewissermaassen in den Hinterzahn
aufgegangen sind.
Vergleicht man nun die -Scheerenhände jugendlicher Weibchen von Sfh?rl2 mm Grösse
mit jenen der gleich grossen Männchen, so lässt sich kaum ein durchgreifender Unterschied nach-
weisen. Auch bei den jüngsten Weibchen treten nicht nur die drei Carpalzähne in derselben
Ausbildungsform wie bei den Männchen entgegen, sondern es lässt sich auch hinter dem Hinterzahn
noch ein isolirter vierter Zahn nachweisen. Derselbe wird auf etwas älteren Stadien zu
einer Kerbe rückgebildet, hinter welcher neue Kerben mit den zwischen ihnen stehenden Borsten
auftreten. Weibchen von 12—18 mm Grösse weisen Scheerenhände auf, welche schwer von jenen
der geschlechtsreifen Männchen zu unterscheiden sind. Erst wenn sie etwa 25 —30 mm Länge
erreicht haben, wird es klar, dass der Mittelzahn nicht nur an Grösse gegen den Hinterzahn
zurücksteht, sondern auch dem letzteren sich nähert, um schliesslich — wie dies C la u s zutreffend
schilderte (1872, p. 335) — mit ihm zu verschmelzen. Wir erhalten dann den grossen und
schlanken, hakenförmig gekrümmten Vorderzahn und einen kleineren, aus der Verschmelzung des
Mittel- und Hinterzahnes hervorgegangenen zahnförmigen Höcker, dessen Hinterseite mit wenigstens
sechs Kerben — den letzten Andeutungen an frühere Zahnbildungen — versehen ist. In
der Mitte des Metacarpus kann bei alten Weibchen eine auf früheren Stadien nur durch sanfte
Ausbuchtung angedeutete Partie als zahnförmiger Höcker zwischen die Carpalzähne eingreifen.
Anders liegen nun die Verhältnisse bei beiden Geschlechtern der Phronima GolletH. Die
jungen Weibchen und Männchen von 10 mm Grösse lassen bereits eine auffällige Verbreiterung
der Tibia und des Carpus erkennen, indem der Distalrand beider Glieder sich scharf convex ausbuchtet.
Zu den drei Carpalzähnen, von denen die beiden hinteren nicht scharf zugespitzt aus-*
laufen und nur wenig an Grösse differiren, gesellt sich ein vierter und späterhin noch ein kerbenförmiger
fünfter Zahn, welche auch auf älteren Stadien selbständig bleiben. An der Greifhand des
grössten geschlechtsreifen Männchens, welches ich am 1. Dez. 1887 vor Las Palmas mit dem Tiefennetz
fischte (Taf. VIII, Fig. 3), fällt zunächst die ungewöhnliche Verbreiterung der Tibia (tb.) auf.
Sie ist im Gegensatz zu den Männchen der Phr. sedentaria ebenso lang wie breit (0,4 mm). Das
Carpalglied (carp.) misst in der Breite (von der Spitze des Vorderzahnes bis zum Ansatz des
Metacarpus) 0,8 mm, und nahezu dieselbe Dimension ergibt das Ausmaass der Höhe. Besonders
auffällig für dasselbe ist die den Ansatz des Gliedes überschneidende convexe Krümmung des
Hinterrandes. An dem Unterrande folgen dem kräftigen und schwach hakenförmig gekrümmten
Vorderzahn (d. a.) in weiterer Entfernung die an Grösse sich fast gleichkommenden Mittel- (d. m.)
und Hinterzähne (d. p.). Dicht hinter den letzteren stehen noch drei kleinere Zähnchen, welche
zwar successive an Grösse abnehmen,' aber durchaus ihre Selbständigkeit wahren. In ähnlicher
Anordnung wie bei Phr. sedentaria sind hinter jedem Zahne kräftige Borsten entwickelt, zu denen
ausserdem sich noch zwei weitere Borsten oberhalb des Mittel- und Hinterzahnes gesellen. Der
relativ stämmige Metacarpus (m. carp.) mit seinem beweglich abgesetzten klauenförmigen Daktylus
(dact.) ragt nicht über den Vorderrand des Carpus hinaus und wird derart gegen den letzteren
eingeschlagen, dass die Carpalzähne nach aussen zu liegen kommen.
Die Unterschiede zwischen den Greifhänden der erwachsenen Männchen von beiden Phro-
nima-Arten sind demgemäss ziemlich sinnfällige. Ich bringe sie in der nachfolgenden tabellarischen
Uebersicht zum Ausdruck.
Phr. sedentaria cf.
T ib ia länger als breit (Verhältniss1 von
Länge zu Breite wie 4 : 3).
C a rp u s wenig länger als breit; der Hinterrand
überschneidet nicht die Ansatzstelle an
der Tibia.
Die h in t e r e n C a rp a lz ä h n e geben ihre
Selbständigkeit auf und rücken als Kerben auf
die Hinterseite des Hinterzahnes.
Der eingeschlagene M e ta c a rp u s überragt
den Vorderrand des Carpus.
Phr. GoUetH cf.
T ib ia ebenso breit wie lang, mit stark
convex ausgebuchtetem Hinterrand.
C a rp u s ebenso lang wie breit; der Hinterrand
überschneidet in convexem Bogen die Ansatzstelle
an der Tibia.
Die h in t e r e n C a rp a lz ä h n e bleiben
selbständig.
Der eingeschlagene M e ta c a rp u s überragt
-flicht den Vorderrand des Carpus.
Vergleicht man nun andererseits die Greif hand des Männchens -von Phr. GolletH mit jener
des geschlechtsreifen Weibchens, so fällt es thatsächlich schwer, einen durchgreifenden Unterschied
herauszufinden. Das um so mehr, als das Verhältniss von Länge und Breite bei den
Carpalgliedern eine gewisse Variabilität erkennen lässt, welche ich durch zwei Extreme, nämlich
durch die linke Greifhand eines mit dem Tiefennetz erbeuteten Weibchens (Taf. VIII, Fig. 4)
und durch diejenige eines an der Oberfläche vor Orotava gefischten Exemplares (Taf. VIII, Fig. 5)
illustrire. Wie die Abbildungen lehren, so gleicht zunächst die Tibia (tb) völlig jener des Männchens,
insofern sie durch die convexe Ausbuchtung des Hinterrandes ebenso lang wie breit wird.
Der Carpus (carp.) ist hingegen schmäler als jener des Männchens.. Während er bei letzterem
so breit wie lang ist, so verhält sich bei dem in Fig. 5 dargestellten Carpus des an der Ober-
Bibliotheca zoologica. lie ft 19 ' 16