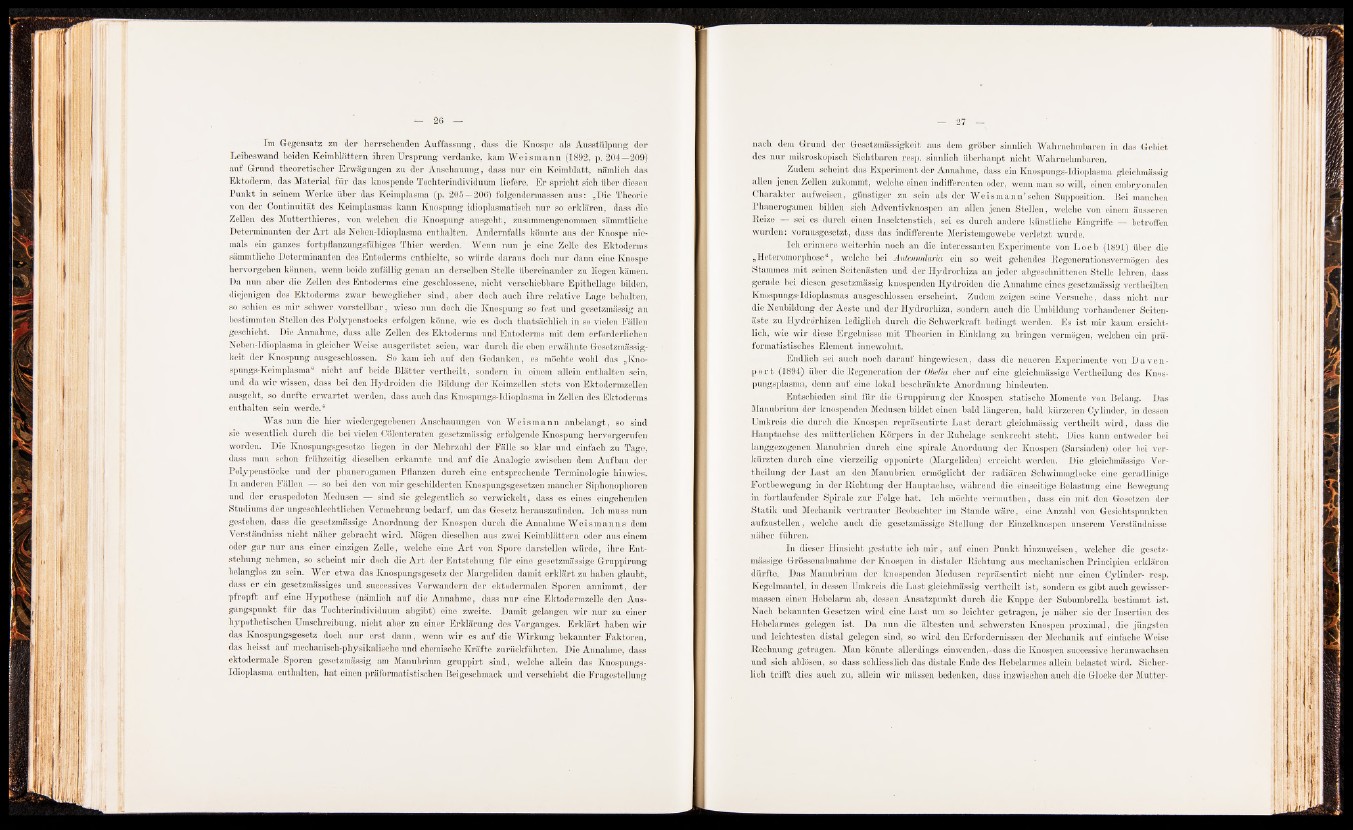
Im Gegensatz zu der herrschenden Auffassung, dass die Knospe als Ausstülpung der
Leibeswand beiden Keimblättern ihren Ursprung verdanke, kam W e ism an n (1892, p. 204—209)
auf Grund theoretischer Erwägungen zu der Anschauung, dass nur ein Keimblatt, nämlich das
Ektoderm, das Material für das knospende Tochterindividuum liefere. Er spricht sich über diesen
Punkt in seinem Werke über das Keimplasma (p. 205 — 206) folgendermassen aus: „Die Theorie
von der Continuität des Keimplasmas kann Knospung idioplasmatisch nur so erklären, dass die
Zellen des Mutterthieres, von welchen die Knospung ausgeht, zusammengenommen sämmtliche
Determinanten der Art als Neben-Idioplasma enthalten. Andernfalls könnte aus der Knospe niemals
ein ganzes fortpflanzungsfähiges Thier werden. Wenn nun je eine Zelle des Ektoderms
sämmtliche Determinanten des Entoderms enthielte, so würde daraus doch nur dann eine Knospe
hervorgehen können, wenn beide zufällig genau an derselben Stelle übereinander zu liegen kämen.
Da nun aber die Zellen des Entoderms eine geschlossene, nicht verschiebbare Epithellage bilden,
diejenigen des Ektoderms zwar beweglicher sind, aber doch auch ihre relative Lage behalten,
so schien es mir schwer vorstellbar, wieso nun doch die Knospung so fest und gesetzmässig an
bestimmten Stellen des Polypenstocks erfolgen könne, wie es doch thatsächlich in so vielen Fällen
geschieht. Die Annahme, dass alle Zellen des Ektoderms und Entoderms mit dem erforderlichen
Neben-Idioplasma in gleicher Weise ausgerüstet seien, war durch die eben erwähnte Gesetzmässigkeit
der Knospung ausgeschlossen. So kam ich auf den Gedanken, es möchte wohl das „Knospungs
Keimplasma“ nicht auf beide Blätter vertheilt, sondern in einem allein enthalten sein,
und da wir wissen, dass bei den Hydroiden die Bildung der Keimzellen stets von Ektodermzellen
ausgeht, so durfte erwartet werden, dass auch das Knospungs-Idioplasma in Zellen des Ektoderms
enthalten sein werde.“
Was nun die hier wiedergegebenen Anschauungen von Weis mann anbelangt, so sind
sie wesentlich durch die bei vielen Cölenteraten gesetzmässig erfolgende Knospung hervorgerufen
worden. Die Knospungsgesetze liegen in der Mehrzahl der Fälle so klar und einfach zu Tage,
dass man schon frühzeitig dieselben erkannte und auf die Analogie zwischen dem Aufbau der
Polypenstöcke und der phanerogamen Pflanzen durch eine entsprechende Terminologie hinwies.
In anderen Fällen — so bei den von mir geschilderten Knospungsgesetzen mancher Siphonophoren
und der craspedoten Medusen — sind sie gelegentlich so verwickelt, dass es eines eingehenden
Studiums der ungeschlechtlichen Vermehrung bedarf, um das Gesetz herauszufinden. Ich muss nun
gestehen, dass die gesetzmässige Anordnung der Knospen durch die Annahme W e ism an n s dem
Verständniss nicht näher gebracht wird. Mögen dieselben aus zwei Keimblättern oder aus einem
oder gar nur aus einer einzigen Zelle, welche eine Art von Spore darstellen würde, ihre Entstehung
nehmen, so scheint mir doch die Art der Entstehung für eine gesetzmässige Gruppirung
belanglos zu sein. Wer etwa das Knospungsgesetz der Margeliden damit erklärt zu haben glaubt,
dass er ein gesetzmässiges und successives Vorwandern der ektodermalen Sporen annimmt, der
pfropft auf eine Hypothese (nämlich auf die Annahme, dass nur eine Ektodermzelle den Ausgangspunkt
für das Tochterindividuum abgibt) eine zweite. Damit gelangen wir nur zu einer
hypothetischen Umschreibung, nicht aber zu einer Erklärung des Vorganges. Erklärt haben wir
das Knospungsgesetz doch nur erst dann, wenn wir es auf die Wirkung bekannter Faktoren,
das heisst auf mechanisch-physikalische und chemische Kräfte zurückführten. Die Annahme, dass
ektodermale Sporen gesetzmässig am Manubrium gruppirt sind, welche allein das Knospungs-
Idioplasma enthalten, hat einen präformatistischen Beigeschmack und verschiebt die Fragestellung
nach dem Grund der Gesetzmässigkeit aus dem gröber sinnlich Wahrnehmbaren in das Gebiet
des nur mikroskopisch Sichtbaren resp. sinnlich überhaupt nicht Wahrnehmbaren.
Zudem scheint das Experiment der Annahme, dass ein Knospungs-Idioplasma gleichmässig
allen jenen Zellen zukommt, welche einen indifferenten oder, wenn man so will, einen embryonalen
Charakter aufweisen, günstiger zu sein als der Wei sm a n n ’sehen Supposition. Bei manchen
Phanerogamen bilden sich Adventivknospen an allen jenen Stellen, welche von einem äusseren
Reize — sei es durch einen Insektenstich, sei es durch andere künstliche Eingriffe — betroffen
wurden: vorausgesetzt, dass das indifferente Meristemgewebe verletzt wurde.
Ich erinnere weiterhin noch an die interessanten Experimente von Loeb (1891) über die
„Heteromorphose“ , welche bei Antennularia ein so weit gehendes Regenerationsvermögen des
Stammes mit seinen Seitenästen und der Hydrorhiza an jeder abgeschnittenen Stelle lehren, dass
gerade bei diesen gesetzmässig knospenden Hydroiden die Annahme eines gesetzmässig vertheilten
Knospungs-Idioplasmas ausgeschlossen erscheint. Zudem zeigen seine Versuche, dass nicht nur
die Neubildung der Aeste und der Hydrorhiza, sondern auch die Umbildung vorhandener Seitenäste
zu Hydrörhizen lediglich durch die Schwerkraft bedingt werden. Es ist mir kaum ersichtlich,
wie wir diese Ergebnisse mit Theorien in Einklang zu bringen vermögen, welchen ein prä-
formatistisches Element innewohnt.
Endlich sei auch noch darauf hingewiesen, dass die neueren Experimente von Da v e n -
p o r t (1894) über die Regeneration der Obelia eher auf eine gleichmässige Vertheilung des Knospungsplasma,
denn auf eine lokal beschränkte Anordnung hindeuten.
Entschieden sind für die Gruppirung der Knospen statische Momente von Belang. Das
Manubrium der knospenden Medusen bildet einen bald längeren, bald kürzeren Cylinder, indessen
Umkreis die durch die Knospen repräsentirte Last derart gleichmässig vertheilt wird, dass die
Hauptachse des mütterlichen Körpers in der Ruhelage senkrecht steht. Dies kann entweder bei
langgezogenen Manubrien durch eine spirale Anordnung der Knospen (Sarsiaden) oder bei verkürzten
durch eine vierzeilig opponirte (Margeliden) erreicht werden. Die gleichmässige Vertheilung
der Last an den Manubrien ermöglicht der radiären Schwimmglocke eine geradlinige
Fortbewegung in der Richtung der Hauptachse, während die einseitige Belastung eine Bewegung
in fortlaufender Spirale zur Folge hat. Ich möchte vermuthen, dass ein mit den Gesetzen der
Statik und Mechanik vertrauter Beobachter i m Stande wäre, eine Anzahl von Gesichtspunkten
aufzustellen, welche auch die gesetzmässige Stellung der Einzolknospen unserem Verständnisse
näher führen.
In dieser Hinsicht gestatte ich mir, auf einen Punkt hinzuweisen, welcher die gesetzmässige
Grössenabnahme der Knospen in distaler Richtung aus mechanischen Principien erklären
dürfte. Das Manubrium der knospenden Medusen repräsentirt nicht nur einen Cylinder- resp.
Kegelmantel, in dessen Umkreis die Last gleichmässig vertheilt ist, sondern es gibt auch gewisser-
massen einen Hebelarm ab, dessen Ansatzpunkt durch die Kuppe der Subumbrella bestimmt ist.
Nach bekannten Gesetzen wird eine Last um so leichter getragen, je näher sie der Insertion des
Hebelarmes gelegen ist. Da nun die ältesten und schwersten Knospen proximal, die jüngsten
und leichtesten distal gelegen sind, so wird den Erfordernissen der Mechanik auf einfache Weise
Rechnung getragen. Man könnte allerdings einwenden,* dass die Knospen successive heranwachsen
und sich ablösen, so dass schliesslich das distale Ende des Hebelarmes allein belastet wird. Sicherlich
trifft dies auch zu, allein wir müssen bedenken, dass inzwischen auch die Glocke der Mutter