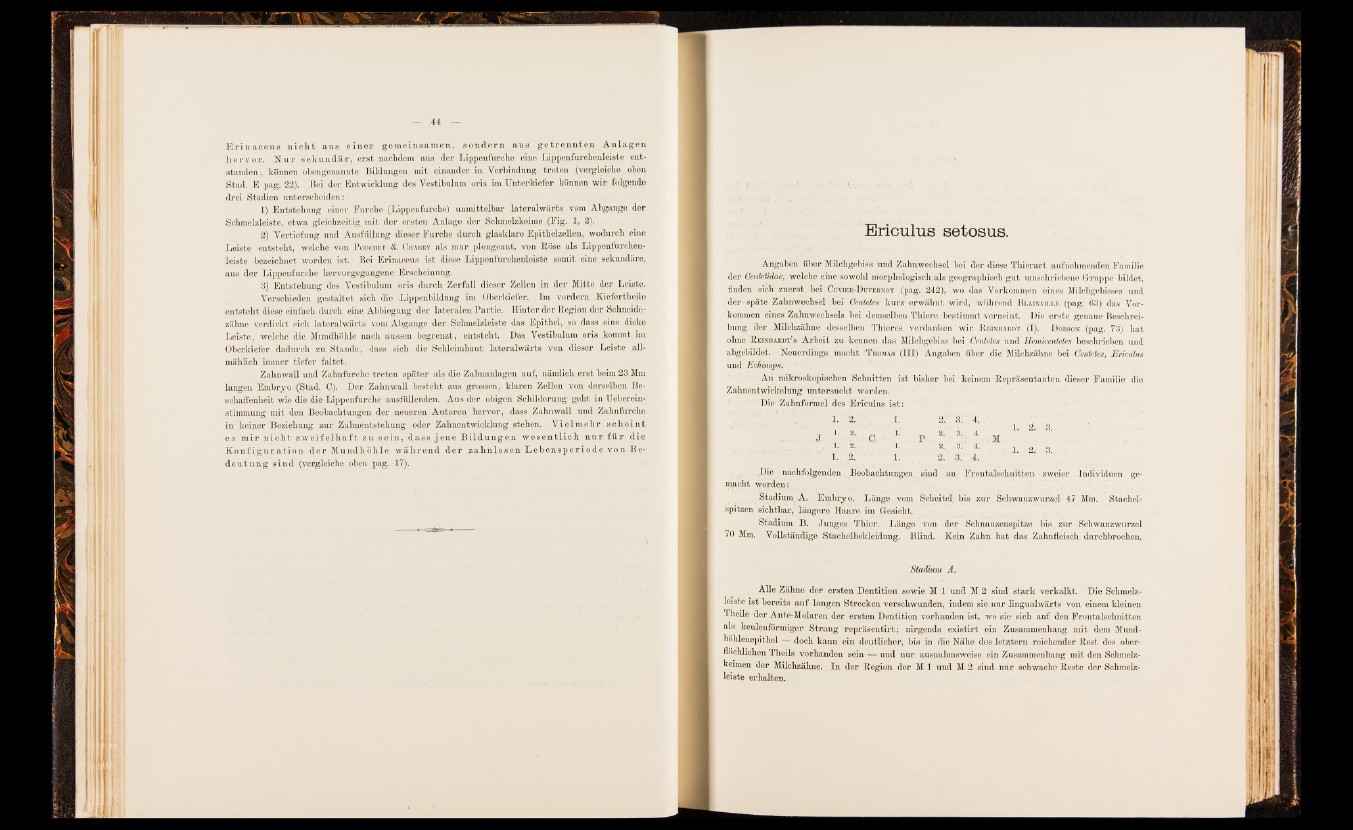
E r in a c e u s n i c h t an s e in e r g em e in s am en , s o n d e rn au s g e tr e n n te n A n la g e n
h e rv o r . N u r s e k u n d ä r , erst nachdem aus der Lippenfurche eine Lippenfurchenleiste entstanden
, können obengenannte Bildungen mit einander in Verbindung treten (vergleiche. oben
Stad. E pag. 22). Bei der Entwicklung des Vestibulum oris im Unterkiefer können wir folgende
drei Stadien unterscheiden:
1) Entstehung einer Furche (Lippenfurche) unmittelbar lateralwärts vom Abgange der
Schmelzleiste, etwa gleichzeitig mit der ersten Anlage der Schmelzkeime (Fig. 1, 2).
2) Vertiefung und Ausfüllung dieser Furche durch glasklare Epithelzellen, wodurch eine
Leiste entsteht, welche von P ouchet & Chabry als mur plongeant, von Böse als .Lippenfurchenleiste
bezeichnet worden ist. Bei Erinaceus ist diese Lippenfurchenleiste somit eine sekundäre,
aus der Lippenfurche hervorgegangene Erscheinung.
3) Entstehung des Vestibulum oris durch Zerfall dieser Zellen in der Mitte der Leiste.
Verschieden gestaltet sich die Lippenbildung im Oberkiefer. Im vordem Kiefertheile
entsteht diese einfach durch eine Abbiegung der lateralen Partie. Hinter der Region der Schneidezähne
verdickt sich lateralwärts vom Abgange der Schmelzleiste das Epithel, so dass eine dicke
Leiste, welche die Mundhöhle nach aussen begrenzt, entsteht. Das Vestibulum oris kommt im
Oberkiefer dadurch zu Stande, dass sich die Schleimhaut lateralwärts von dieser Leiste allmählich
immer tiefer faltet.
Zahnwall und Zahnfurche treten später als die Zahnanlagen auf, nämlich erst beim 23 Mm
langen Embryo (Stad. C). Der Zahnwall besteht aus grossen, klaren Zellen von derselben Beschaffenheit
wie die die Lippenfurche ausfüllenden. Aus der obigen Schilderung geht in Ueberein-
stimmung mit den Beobachtungen der neueren Autoren hervor, dass Zahnwall und Zahnfurche
in keiner Beziehung zur Zahnentstehung oder Zahnentwicklung stehen. V ie lm e h r sc h e in t,
es m ir n ic h t zw e i f e lh a f t zu s e in , d a s s je n e B ild u n g e n w e s e n tlic h n u r f ü r d ie
K o n f ig u r a t io n d e r M u n d h ö h le w ä h re n d d e r z a h n lo s e n L e b e n s p e r io d e von Bed
e u tu n g s in d (vergleiche oben pag. 17).
Ericulus setosus.
Angaben über Milchgebiss und Zahnwechsel bei der diese Thierart aufnehmenden Familie
der Genfetidae, welche eine sowohl morphologisch als geographisch gut umschriebene Gruppe bildet,
finden sich zuerst bei C uvier-D üvernoy (pag. 242), wo das Vorkommen eines Milchgebisses und
der-späte Zahnwechsel bei Gentetes kurz erwähnt wird, während B lainville (pag. 63) das Vorkommen
eines Zahnwechsels bei demselben Thiere bestimmt verneint. Die erste genaue Beschreibung
der Milchzähne desselben Thieres verdanken wir R einhardt (I). D obson (pag. 73) hat
ohne R einhardt’s Arbeit zu kennen das Milchgebiss bei Gentetes und Ilemicentetes beschrieben und
abgebildet. Neuerdings macht 'T homas (III) Angaben über die Milchzähne' bei Gentetes, Ericulus
und Eckinops. ■
An mikroskopischen Schnitten ist bisher bei keinem Repräsentanten dieser Familie die
Zahnentwickelung untersucht worden.
Die Zahnformel des Ericulus ist:
1. 2. . 1. ‘ 2.' 3. 4,
1. ■ c, 1 1. 1. , 2., 1. 1 ,D 2., m3. 1' 44.-.
1. ü 1. o m H
Die nachfolgenden Beobachtungen, sind an- Frontalschnitten zweier Individuen gemacht
worden:
Stadium A. Embryo. Länge vom Scheitel bis zur Schwanzwurzel 47 Mm. Stachelspitzen
sichtbar, längere Haare im Gesicht.
Stadium B. Junges Thier. Länge von der Schnauzenspitze bis zur Schwanzwurzel
70 Mm. Vollständige Stachelbekleidung. Blind. Kein Zahn hat das Zahnfleisch durchbrochen.
Stadium A.
Alle Zähne der ersten Dentition sowie M 1 und M 2 sind stark verkalkt. Die Schmelzleiste
ist bereits auf langen Strecken verschwunden, indem sie nur lingualwärts von einem kleinen
Theile der Ante-Molaren der ersten Dentition vorhanden ist, wo sie sich auf den Frontalschnitten
als keulenförmiger Strang repräsentirt; nirgends existirt ein Zusammenhang mit dem Mundhöhlenepithel
— doch kann ein deutlicher, bis in die Nähe des letztem reichender Rest des oberflächlichen
Theils vorhanden sein — und nur ausnahmsweise ein Zusammenhang mit den Schmelzkeimen
der Milchzähne. In der Region der M 1 und M 2 sind nur schwache Reste der Schmelzleiste
erhalten.