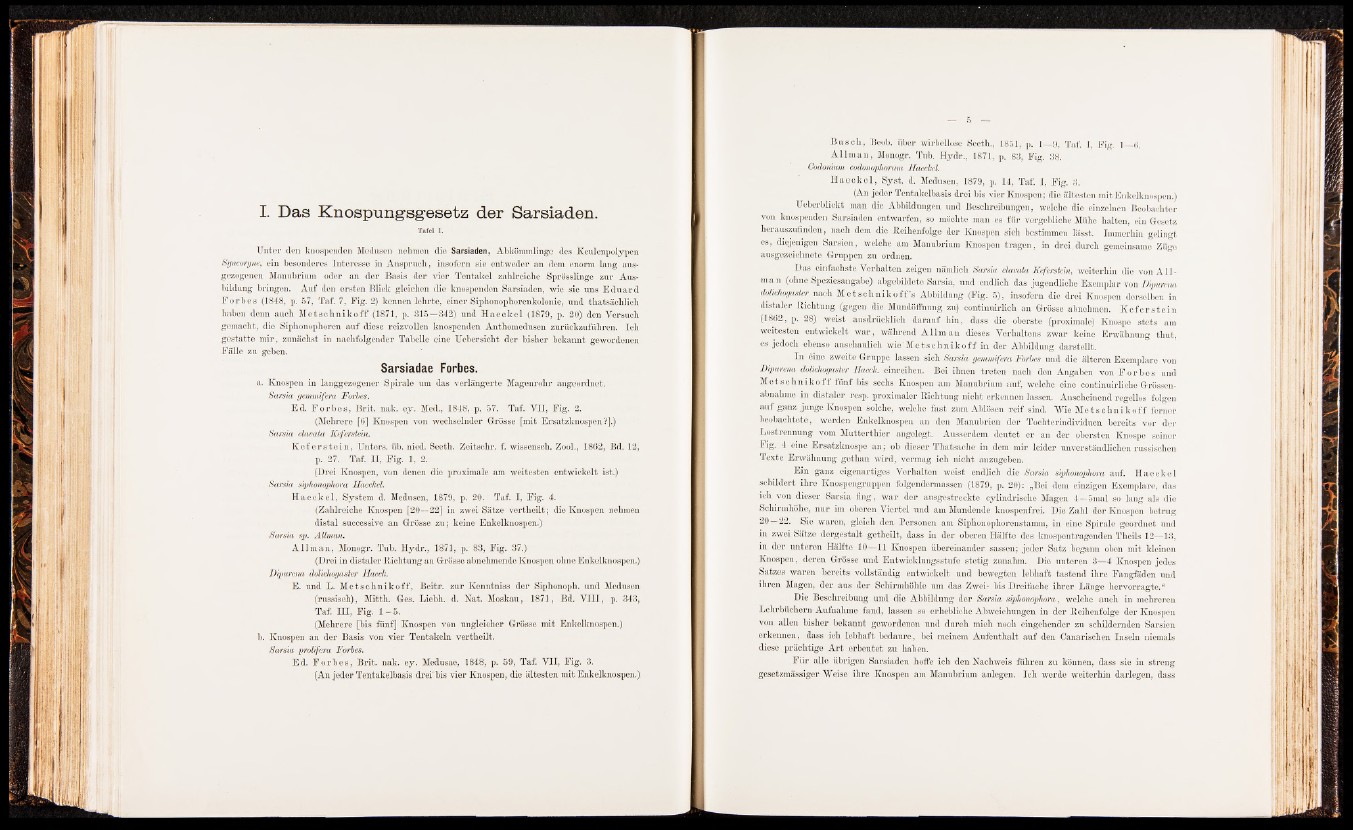
I. Das Knospungsgesetz der Sarsiaden.
Tafel I.
Unter den knospenden Medusen nehmen die Sarsiaden, Abkömmlinge des Keulenpolypen
Syncoryne, ein besonderes Interesse in Anspruch, insofern sie entweder an dem enorm lang ausgezogenen
Manubrium oder an der Basis der vier Tentakel zahlreiche Sprösslinge zur Ausbildung
bringen. Auf den ersten Blick gleichen die knospenden Sarsiaden, wie sie uns E d u a rd
F o rb e s (1848, p. 57, Taf. 7, Fig. 2) kennen lehrte, einer Siphonophorenkolonie, und thatsächlich
haben denn auch M e ts c h n ik o f f (1871, p. 315—342) und H a eo k e l (1879, p. 20) den Versuch
gemacht, die Siphonophoren auf diese reizvollen knospenden Anthomedusen zurückzuführen. Ich
gestatte mir, zunächst in nachfolgender Tabelle eine Uebersicht der bisher bekannt gewordenen
Fälle zu geben.
Sarsiadae Forbes.
a. Knospen in langgezogener Spirale um das verlängerte Magenrohr angeordnet.
Sarsia gemniifera Forbes.
Ed. F o rb e s , Brit. nak. ey. Med., 1848, p. 57. Taf. VII, Fig. 2.
(Mehrere [6] Knospen von wechselnder Grösse [mit Ersatzknospen?].)
Sarsia clavata Keferstein.
K e f e r s t e in , Unters, üb.mied. Seeth. Zeitschr. f. wissensch. Zool., 1862, Bd. 12,
p. 27. Taf. II, Fig. 1, 2.
(Drei Knospen, von denen die proximale am weitesten entwickelt ist.)
Sarsia siplionophora Haeckel.
H a e e k e l, System d. Medusen, 1879, p. 20. Taf. I, Fig. 4.
(Zahlreiche Knospen [20—22] in zweiSätze vertheilt; die Knospen nehmen
distal successive an Grösse zu; keine Enkelknospen.)
Sarsia sp. Allman.
A llm a n , Monogr. Tub. Hydr., 1871, p. 83, Fig. 37.)
(Drei in distaler Richtung an Grösse abnehmende Knospen ohne Enkelknospen.)
Dipurena dolichogaster Haech.
E. und L. M e ts c h n ik o f f, Beitr. zur Kenntniss der Siphonoph. und Medusen
(russisch), Mitth. Ges. Liebh. d. Nat. Moskau, 1871, Bd. VIII, p. 343,
Taf. m , Fig. 1 -5 .
(Mehrere [bis fünf] Knospen von ungleicher Grösse mit Enkelknospen.).
b. Knospen an der Basis von vier Tentakeln vertheilt.
Sarsia prolifera Forbes.
Ed. F o rb e s , Brit. nak. ey. Medusae, 1848, p. 59, Taf. VII, Fig. 3.
(An jeder Tentakelbasis drei' bis vier Knospen, die ältesten mit Enkelknospen.)
B u s c h , Beob. über wirbellose Seeth, 1851, p. 1—9, Taf. I, Fig. 1 6.
A llm a n , Monogr. Tub. Hydr., 1871, p. 83, Fig. 38.
Godonium codonophorum Ilaechel.
H a e c k e l, Syst. d. Medusen, 1879, p. 14, Taf. I, Fig. 3.
(An jeder Tentakelbasis drei bis vier Knospen; die ältesten mit Enkelknospen.)
Ueberblickt man die Abbildungen und Beschreibungen, welche die einzelnen Beobachter
von knospenden Sarsiaden entwarfen, so möchte man . es für vergebliche Mühe halten, ein Gesetz
herauszufinden, nach dem die Reihenfolge der Knospen sich bestimmen lässt. Immerhin gelingt
es, diejenigen Sarsien, welche am Manubrium Knospen tragen, in drei .durch gemeinsame Züge
ausgezeichnete Gruppen zu ordnen.
Das einfachste Verhalten zeigen nämlich Sarsia clavata Keferstein, weiterhin die von A llman
(ohne Speziesangabe) abgebildete Sarsia, und endlich das jugendliche Exemplar von Dipurena
dolichogaster nach M e ts e h n ik o f f ’s Abbildung (Fig. 5), insofern die drei Knospen derselben in
distaler Richtung (gegen die Mundöffnung zu) continuirlich an Grösse abnehmen. K e f e r s te in
(1862, p. 28) weist ausdrücklich darauf hin, dass die oberste (proximale) Knospe stets am
weitesten entwickelt war, während A llm a n dieses Verhaltens zwar keine Erwähnung thut,
es jedoch ebenso anschaulich wie M e ts c h n ik o f f in der Abbildung darstellt.
In eine zweite Gruppe lassen sich Sarsia gemmifera Forbes und die älteren Exemplare von
Dipurena dolichogaster Haech. einreihen. Bei ihnen treten nach den Angaben von F o rb e s und
M e ts c h n ik o f f fünf bis sechs Knospen am Manubrium auf, welche eine continuirliche Grössenabnahme
in distaler resp. proximaler Richtung nicht erkennen lassen. Anscheinend regellos folgen
auf ganz junge Knospen solche, welche fast zum Ablösen reif sind. Wie M e ts c h n ik o f f ferner
beobachtete, werden Enkelknospen an den Manubrien der Tochterindividuen bereits vor der
Lostrennung vom Mutterthier angelegt. Ausserdem deutet er an der obersten Knospe seiner
Flg. 4 eine Ersatzknospe an; ob dieser Thatsache in dem mir leider unverständlichen russischen
Texte Erwähnung gethan wird, vermag ich nicht anzugeben.
Ein ganz eigenartiges Verhalten weist endlich die Sarsia siplionophora auf. H a e c k e l
schildert ihre Knospengruppen folgendermassen (1879, p. 20): „Bei dem einzigen Exemplare, das
ich von dieser Sarsia fing, war der ausgestreckte cylindrische Magen 4—5mal so lang als die
Schirmhöhe, nur im oberen Viertel und am Mundende knospenfrei. Die Zahl der Knospen betrug
20 22. Sie waren, gleich den Personen am Siphonophorenstamm, in eine Spirale geordnet und
in zwei Sätze dergestalt getheilt, dass in der oberen Hälfte des knospentragenden Theils 12—13,
in der unteren Hälfte 10—11 Knospen übereinander, sassen; jeder Satz begann oben mit kleinen
Knospen, deren Grösse und Entwicklungsstufe stetig zunahm. Die unteren 3—4 Knospen jedes
Satzes waren bereits vollständig entwickelt und bewegten lebhaft tastend ihre Fangfäden und
ihren Magen, der aus der Schirmhöhle um das Zwei- bis Dreifache ihrer Länge hervorragte.“
Die Beschreibung und die Abbildung der Sarsia siplionophora, welche auch in mehreren
Lehrbüchern Aufnahme fand, lassen so erhebliche Abweichungen in der Reihenfolge der Knospen
von allen bisher bekannt gewordenen und durch mich noch eingehender zu schildernden Sarsien
erkennen, dass ich lebhaft bedaure, bei meinem Aufenthalt auf den Canarischen Inseln niemals
diese prächtige Ajrt erbeutet zu haben.
Für alle übrigen Sarsiaden hoffe ich den Nachweis führen zu können, dass sie in streng
gesetzmassiger Weise ihre Knospen am Manubrium anlegen. Ich werde weiterhin darlegen, dass