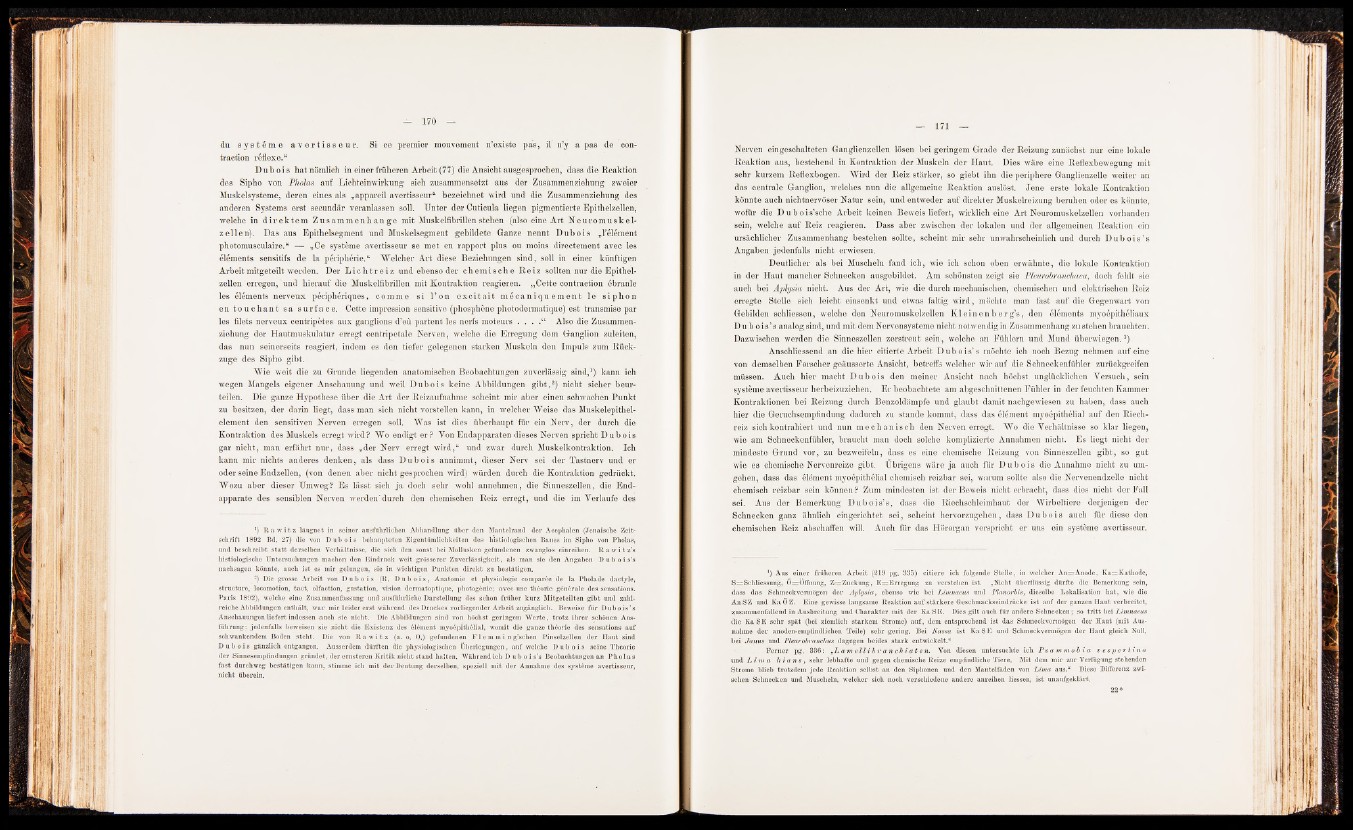
du s y s t èm e a v e r t i s s e u r . Si ce premier mouvement n’existe pas, il n’y a pas de contraction
réflexe.“
D ubois hat nämlich in einer früheren Arbeit (77) die Ansicht ausgesprochen, dass die Reaktion
des Sipho von Pilólas auf Lichteinwirkung sich zusammensetzt aus der Zusammenziehung zweier
Muskelsysteme, deren eines als „appareil avertisseur“ bezeichnet wird und die Zusammenziehung des
anderen Systems erst secundar veranlassen soll. Unter der Cuticula liegen pigmentierte Epithelzellen,
welche in d ire k tem Z usammen h än g e mit Muskelfibrillen stehen (also eine Art Neuromuske.1-
zeilen). Das aus Epithelsegment und Muskelsegment gebildete Ganze nennt Dubois „l’élément
photomusculaire.“ — „Ce système avertisseur se met en rapport plus ou moins directement avec les
éléments sensitifs de la périphérie.“ Welcher Art diese Beziehungen sind, soll in einer künftigen
Arbeit mitgeteilt werden. Der L i c h 11* e i z und ebenso der chemische Reiz sollten nur die Epithelzellen
erregen, und hierauf die Muskelfibrillen mit Kontraktion reagieren. „Cette contraction ébranle
les éléments nerveux périphériques, comme si l ’on e x c ita it m é c a n iq u em e n t le sip h o n
en to u c h a n t sa su rfa c e . Cette impression sensitive (phosphène photodermatique) est transmise par
les filets nerveux centripètes aux ganglions d’où partent les nerfs moteurs . . . .“ Also die Zusammenziehung
der Hautmuskulatur erregt centripetale Nerven, welche die Erregung dem G-anglion zuleiten,
das nun seinerseits reagiert, indem es den tiefer gelegenen starken Muskeln den Impuls zum Rückzüge
des Sipho gibt.
Wie weit die zu Grunde liegenden anatomischen Beobachtungen zuverlässig sind,1) kann ich
wegen Mangels eigener Anschauung und weil Dubois keine Abbildungen gibt,2) nicht Sicher beurteilen.
Die ganze Hypothese über die Art der Reizaufnahme scheint mir aber einen schwachen Punkt
zu besitzen, der darin liegt, dass man sich nicht vorstellen kann, in welcher Weise das Muskelepithelelement
den sensitiven Nerven erregen soll. Was ist dies überhaupt für ein Nerv, der durch die
Kontraktion des Muskels erregt wird? Wo endigt er? Yon Endapparaten dieses Nerven spricht Dubois
gar nicht, man erfährt nur, dass „der Nerv erregt wird,“ und zwar durch Muskelkontraktion. Ich
kann mir nichts anderes denken, als dass D ubois annimmt, dieser Nerv sei der Tastnerv und er
oder seine Endzeilen, (von denen aber nicht gesprochen wird) würden durch die Kontraktion gedrückt.
Wozu aber dieser Umweg? Es lässt sich ja doch sehr wohl annehmen, die Sinneszellen, die Endapparate
des sensiblen Nerven werden’durch den chemischen Reiz erregt, und die im Verlaufe des
’) ß a w i t z läugnct in seiner ausführlichen Abhandlung über den Mantelrand der Aceplialen (Jenaiscbe Zeitschrift
1892 Bd. 27) die von D u b o i s behaupteten Eigentümlichkeiten des histiologisclien Baues im Sipho von Pholas,
und beschreibt statt derselben Yerhältnisse, die sich den sonst hei Mollusken gefundenen zwanglos einreihen, ß a w i t z ’s
histiologischc Untersuchungen machen den Eindruck weit grösserer Zuverlässigkeit, als man sie den Angaben D u b o i s ’s
nachsagen könnte, auch ist es mir .gelungen, sie in wichtigen Punkten direkt zu bestätigen.
2) Die grosse Arbeit von D u b o i s (ß. D u b o i s , Anatomie et physiologie comparée de la Pholade dactyle,
structure, locomotion, tact, olfaction, gustation, vision dermatoptique, photogénie; avec une théorie générale des sensations.
Paris 1892), welche eine Zusammenfassung und ausführliche Darstellung des schon früher kurz Mitgeteilten gibt und zahlreiche
Abbildungen enthält, war mir leider erst während des Druckes vorliegender Arbeit zugänglich. Beweise für Duhoi s ’s
Anschauungen liefert indessen auch sie nicht. Die Abbildungen sind von höchst geringem Werte, trotz ihrer schönen Ausführung;
jedenfalls beweisen sie nicht die Existenz des élément myoépithélial, womit die ganze théorie des sensations auf
schwankendem Boden steht. Die von ß a w i t z (a. o. 0 .) gefundenen F l em m i n g ’schen Pinselzellen der Haut sind
D u b o i s gänzlich entgangen. Ausserdem dürften die physiologischen Überlegungen, auf welche D u b o i s seine Theorie
der Sinnesempfindungen gründet, der ernsteren Kritik nicht stand halten. Während ich D ub o i s’s Beobachtungen an Pholas
fast durchweg bestätigen kann, stimme ich mit der Deutung derselben, speziell mit der Annahme des système avertisseur,
nicht überein.
Nerven eingeschalteten Ganglienzellen lösen bei geringem Grade der Reizung zunächst nur eine lokale
Reaktion aus, bestehend in Kontraktion der Muskeln der Haut. Dies wäre eine Reflexbewegung mit
sehr kurzem Reflexbogen. Wird der Reiz stärker, so giebt ihn die periphere Ganglienzelle weiter an
das centrale Ganglion, welches nun die allgemeine Reaktion auslöst. Jene erste lokale Kontraktion
könnte auch nichtnervöser Natur sein, und entweder auf direkter Muskelreizung beruhen oder es könnte,
wofür die D u b o is’sche Arbeit keinen Beweis liefert, wirklich eine Art Neuro muskelzellen vorhanden
sein, welche auf Reiz reagieren. Dass aber zwischen der lokalen und der allgemeinen Reaktion ein
ursächlicher Zusammenhang bestehen sollte, scheint mir sehr unwahrscheinlich und durch D u b o is ’s
Angaben jedenfalls nicht erwiesen.
Deutlicher als bei Muscheln fand ich, wie ich schon oben erwähnte, die lokale Kontraktion
in der Haut mancher Schnecken ausgebildet. Am schönsten zeigt sie Pleurobranchaea, doch fehlt sie
auch bei Aplysia nicht. Aus der Art, wie die durch mechanischen, chemischen und elektrischen Reiz
erregte Stelle sich leicht einsenkt und etwas faltig wird, möchte man fast auf die Gegenwart von
Gebilden schliessen, welche den Neuromuskelzellen K le in e n b e rg ’s, den éléments myoépithéliaux
D u b o is’s analog sind, und mit dem Nervensysteme nicht notwendig in Zusammenhang zu stehen brauchten.
Dazwischen werden die Sinneszellen zerstreut sein, welche an Fühlern und Mund überwiegen. *)
Anschliessend an die hier citierte Arbeit Dubois’s möchte ich noch Bezug nehmen auf eine
von demselben Forscher geäusserte Ansicht, betreffs welcher wir auf die Schneckenfühler zurückgreifen
müssen. Auch hier macht Dubois den meiner Ansicht nach höchst unglücklichen Versuch, sein
système avertisseur herbeizuziehen. Er beobachtete am abgeschnittenen Fühler in der feuchten Kammer
Kontraktionen bei Reizung durch Benzoldämpfe und glaubt damit nachgewiesen zu haben, dass auch
hier die Geruchsempfindung dadurch zu stande kommt, dass das élément myoépithélial auf den Riechreiz
sich kontrahiert und nun m e chanisch den Nerven erregt. Wo die Verhältnisse so klar liegen,
wie am Schneckenfühler, braucht man doch solche komplizierte Annahmen nicht. Es liegt nicht der
mindeste Grund vor, zu bezweifeln, dass es eine chemische Reizung von Sinneszellen gibt, so gut
wie es chemische Nervenreize gibt, übrigens wäre ja auch für D u b o is die Annahme nicht zu umgehen,
dass das élément myoépithélial chemisch reizbar sei, warum sollte also die Nervenendzelle nicht
chemisch reizbar sein können ? Zum mindesten ist der Beweis nicht erbracht, dass dies nicht der Fall
sei. Aus der Bemerkung Dubois’s, dass die Riechschleirahaut der Wirbeltiere derjenigen der
Schnecken ganz ähnlich eingerichtet sei, scheint hervorzugehen, dass Dubois auch für diese den
chemischen Reiz abschaffen will. Auch für das Hörorgan verspricht er uns ein système avertisseur.
*) Aus einer früheren Arbeit (219 pg. 335) citiere ick folgende Stelle, in welcher An=Anode, Ka=Kathode,
S=Schliessungj Ö=Öffnung, Z=Zuckung, E=Erregung zu verstehen ist. „Nicht überflüssig dürfte die Bemerkung sein,
dass das Schmeckvermögen der Aplysia, ebenso wie bei Limnaeus und Planorbis, dieselbe Lokalisation hat, wie die
An S Z und Ka 0 Z. Eine gewisse langsame ßeaktion auf stärkere Geschmackseindrücke ist auf der ganzen Haut verbreitet,
zusammenfallend in Ausbreitung und Charakter mit der KaSE. Dies gilt auch für andere Schnecken; so tritt bei Limnaeus
die KaSE sehr spät (bei ziemlich starkem Strome) auf, dem entsprechend ist das Schmeckvermögen der Haut (mit Ausnahme
der anoden-empfindlichen Teile) sehr gering. Bei Nassa ist Ka SE und Schmeckvermögen der Haut gleich Null,
bei Janus und Pleurobranclius dagegen beides stark entwickelt.“
Ferner pg. 336: „L am e l l i b r a n c h i a t e n . Von diesen untersuchte ich P s a m m o b i a v e s p e r t i n a
und L i m a J i i a n s , sehr lebhafte und gegen chemische Keize empfindliche Tiere. Mit dem mir zur Verfügung stehenden
Strome blieb trotzdem jede ßeaktion selbst an den Siphonen und den Mantelfäden von Lima aus.“ Diese Differenz zwischen
Schnecken und Muscheln, welcher sich noch verschiedene andere anreihen liessen, ist unaufgeklärt.