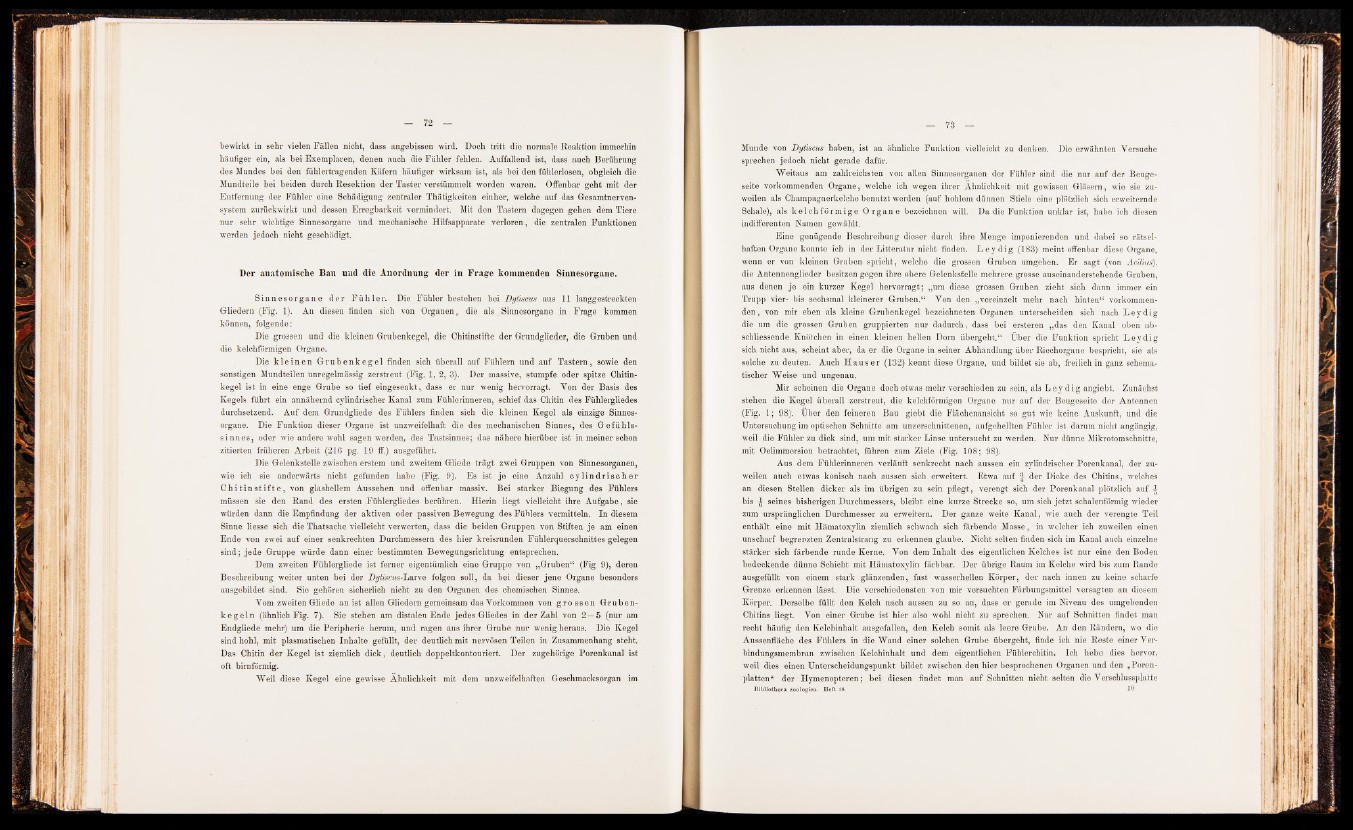
— 72 m
bewirkt in sehr vielen Fällen nicht, dass angebissen wird. Doch tritt die normale Reaktion immerhin
häufiger ein, als bei Exemplaren, denen auch die Fühler fehlen. Auffallend ist, dass auch Berührung
des Mundes bei den fühlertragenden Käfern häufiger wirksam ist, als bei den fühlerlosen, obgleich die
Mundteile bei beiden durch Resektion der Taster verstümmelt worden waren. Offenbar geht mit der
Entfernung der Fühler eine Schädigung zentraler Thätigkeiten einher, welche auf das Gesamtnervensystem
zurückwirkt und dessen Erregbarkeit vermindert. Mit den Tastern dagegen gehen dem Tiere
nur sehr wichtige Sinnesorgane und mechanische Hilfsapparate verloren, die zentralen Funktionen
werden jedoch nicht geschädigt.
Der anatomische Bau und die Anordnung der in Frage kommenden Sinnesorgane.
Sin n e so rg an e der F ü h le r. Die Fühler bestehen bei Dytiscus aus 11 langgestreckten
Gliedern (Fig. 1). An diesen finden sich von Organen, die als Sinnesorgane in Frage kommen
können, folgende:
Die grossen und die kleinen Grubenkegel, die Chitinstifte der Grundglieder, die Gruben und
die kelchförmigen Organe.
Die k le in e n G ru b e n k e g e l finden sich überall auf Fühlern und auf Tastern, sowie den
sonstigen Mundteilen unregelmässig zerstreut (Fig. 1, 2, 3). Der massive, stumpfe oder spitze Chitinkegel
ist in eine enge Grube so tief eingesenkt, dass er nur wenig hervorragt. Von der Basis des
Kegels führt ein annähernd cylindrischer Kanal zum Fühlerinneren, schief das Chitin des Fühlergliedes
durchsetzend. Auf dem Grundgliede des Fühlers finden sich die kleinen Kegel als einzige Sinnesorgane.
Die Funktion dieser Organe ist unzweifelhaft die des mechanischen Sinnes, des Gefühlssinnes,
oder wie andere wohl sagen werden, des Tastsinnes; das nähere hierüber ist in meiner schon
zitierten früheren Arbeit (216 pg. 19 ff.) ausgeführt.
Die Gelenkstelle zwischen erstem und zweitem Gliede trägt zwei Gruppen von Sinnesorganen,
wie ich sie anderwärts nicht gefunden habe (Fig. 9). Es ist je eine Anzahl c y lin d r is c h e r
C h itin s tif te , von glashellem Aussehen und offenbar massiv. Bei starker Biegung des Fühlers
müssen sie den Rand des ersten Fühlergliedes berühren. Hierin liegt vielleicht ihre Aufgabe, sie
würden dann die Empfindung der aktiven oder passiven Bewegung des Fühlers vermitteln. In diesem
Sinne liesse sich die Thatsache vielleicht verwerten, dass die beiden Gruppen von Stiften je am einen
Ende von zwei auf einer senkrechten Durchmessern des hier kreisrunden Fühlerquerschnittes gelegen
sind; jede Gruppe würde dann einer bestimmten Bewegungsrichtung entsprechen.
Dem zweiten Fühlergliede ist ferner eigentümlich eine Gruppe von „Gruben“ (Fig 9), deren
Beschreibung weiter unten bei der Dytiscus-heurve folgen soll, da bei dieser jene Organe besonders
ausgebildet sind. Sie gehören sicherlich nicht zu den Organen des chemischen Sinnes.
Vom zweiten Gliede an ist allen Gliedern gemeinsam das Vorkommen von g ro ss en Grubenk
e g e ln (ähnlich Fig. 7). Sie stehen am distalen Ende jedes Gliedes in der Zahl von 2—5 (nur am
Endgliede mehr) um die Peripherie herum, und ragen aus ihrer Grube nur wenig heraus. Die Kegel
sind hohl, mit plasmatischen Inhalte gefüllt, der deutlich mit nervösen Teilen in Zusammenhang steht.
Das Chitin der Kegel ist ziemlich dick, deutlich doppeltkontouriert. Der zugehörige Porenkanal ist
oft bimförmig.
Weil diese Kegel eine gewisse Ähnlichkeit mit dem unzweifelhaften Geschmacksorgan im
Munde von Dytiscus haben, ist an ähnliche Funktion vielleicht zu denken. Die erwähnten Versuche
sprechen jedoch nicht gerade dafür.
Weitaus am zahlreichsten von allen Sinnesorganen der Fühler sind die nur auf der Beugeseite
vorkommenden Organe, welche ich wegen ihrer Ähnlichkeit mit gewissen Gläsern, wie sie zuweilen
als Champagnerkelche benutzt werden (auf hohlem dünnen Stiele eine plötzlich sich erweiternde
Schale), als k e lch fö rm ig e O rg an e bezeichnen will. Da die Funktion unklar ist, habe ich diesen
indifferenten Namen gewählt.
Eine genügende Beschreibung dieser durch ihre Menge imponierenden und dabei so rätselhaften
Organe konnte ich in der Litteratur nicht finden. L ey dig (183) meint offenbar diese Organe,
wenn er von kleinen Gruben spricht, welche die grossen Gruben umgeben. Er sagt (von Acilius),
die Antennenglieder besitzen gegen ihre obere Gelenksfelle mehrere grosse auseinanderstehende Gruben,
aus denen je ein kurzer Kegel hervorragt; „um diese grossen Gruben zieht sich dann immer ein
Trupp vier- bis sechsmal kleinerer Gruben.“ Von den „vereinzelt mehr nach hinten“ vorkommenden,
von mir eben als kleine Grubenkegel bezeichneten Organen unterscheiden sich nach Ley dig
die um die grossen Gruben gruppierten nur dadurch, dass bei ersteren „das den Kanal oben abschliessende
Knötchen in einen kleinen hellen Dorn übergeht.“ Über die Funktion spricht Ley dig
sich nicht aus, scheint aber, da er die Organe in seiner Abhandlung über Riechorgane bespricht, sie als
solche zu deuten. Auch H au s e r (132) kennt diese Organe, und bildet sie ab, freilich in ganz schematischer
Weise und ungenau.
Mir scheinen die Organe doch etwas mehr verschieden zu sein, als Ley dig angiebt. Zunächst
stehen die Kegel überall zerstreut, die kelchförmigen Organe nur auf der Beugeseite der Antennen
(Fig. 1; 98). Über den feineren Bau giebt die Flächenansicht so gut wie keine Auskunft, und die
Untersuchung im optischen Schnitte am unzerschnittenen, aufgehellten Fühler ist darum nicht angängig,
weil die Fühler zu dick sind, um mit starker Linse untersucht zu werden. Nur dünne Mikrotomschnitte,
mit Oelimmersion betrachtet, führen zum Ziele (Fig. 108; 98).
Aus dem Fühlerinneren verläuft senkrecht nach aussen ein zylindrischer Porenkanal, der zuweilen
auch etwas konisch nach aussen sich erweitert. Etwa auf | der Dicke des Chitins, welches
an diesen Stellen dicker als im übrigen zu sein pflegt, verengt sich der Porenkanal plötzlich auf ^
bis ^ seines bisherigen Durchmessers, bleibt eine kurze Strecke so, um sich jetzt schalenförmig wieder
zum ursprünglichen Durchmesser zu erweitern. Der ganze weite Kanal, wie auch der verengte Teil
enthält eine mit Hämatoxylin ziemlich schwach sich färbende Masse, in welcher ich zuweilen einen
unscharf begrenzten Zentralstrang zu erkennen glaube. Nicht selten finden sich im Kanal auch einzelne
stärker sich färbende runde Kerne. Von dem Inhalt des eigentlichen Kelches ist nur eine den Boden
bedeckende dünne Schicht mit Hämatoxylin färbbar. Der übrige Raum im Kelche wird bis zum Rande
ausgefüllt von einem stark glänzenden, fast wasserhellen Körper, der nach innen zu keine scharfe
Grenze erkennen lässt. Die verschiedensten von mir versuchten Färbungsmittel versagten an diesem
Körper. Derselbe füllt den Kelch nach aussen zu so an, dass er gerade im Niveau des umgebenden
Chitins liegt. Von einer Grube ist hier also wohl nicht zu sprechen. Nur auf Schnitten findet man
recht häufig den Kelchinbalt ausgefallen, den Kelch somit als leere Grube. An den Rändern, wo die
Aussenfläche des Fühlers in die Wand einer solchen Grube übergeht, finde ich nie Reste einer Verbindungsmembran
zwischen Kelchinhalt und dem eigentlichen Fühlerchitin. Ich hebe dies hervor,
weil dies einen Unterscheidungspunkt bildet zwischen den hier besprochenen Organen und den „Porenplatten“
der Hymenopteren; bei diesen findet man auf Schnitten nicht selten die Verschlussplatte
Bibliotheca zoologica. Heft 18. 10