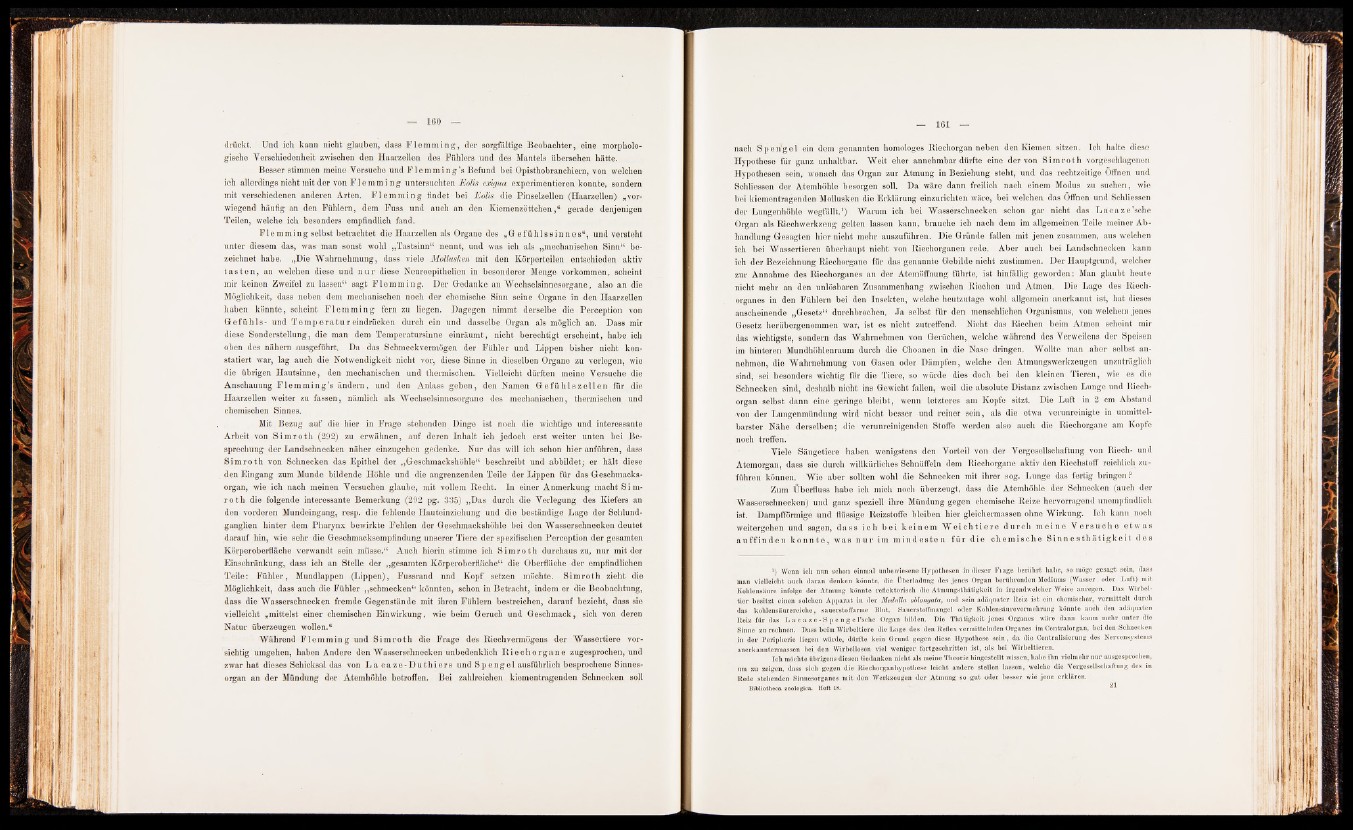
dfückt. Und ich kann nicht glauben, dass F lemming, der sorgfältige Beobachter, eine morphologische
Verschiedenheit zwischen den Haarzellen des Fühlers und des Mantels übersehen hätte.
Besser stimmen meine Versuche und F lem m in g ’s Befund bei Opisthobranchiern, von welchen
ich allerdings nicht mit der von F lem m in g untersuchten Eolis exigua experimentieren konnte, sondern
mit verschiedenen anderen Arten. F lemming findet bei Eolis die Pinselzellen (Haarzellen) »vorwiegend
häufig an den Fühlern, dem Fuss und auch an den Kiemenzöttchen,“ gerade denjenigen
Teilen, welche ich besonders empfindlich fand.
Flemming selbst betrachtet die Haarzellen als Organe des »G e fü h lss in n e s“, und versteht
unter diesem das, was man sonst wohl „Tastsinn“ nennt, und was ich als „mechanischen Sinn“ bezeichnet
habe. „Die Wahrnehmung, dass viele Mollusken mit den Körperteilen entschieden aktiv
ta s te n , an welchen diese und n u r diese Neuroepithelien in besonderer Menge Vorkommen, scheint
mir keinen Zweifel zu lassen“ sagt Flemming. Der Gedanke an Wechselsinnesorgane, also an die
Möglichkeit, dass neben dem mechanischen noch der chemische Sinn seine Organe in den Haarzellen
haben könnte, scheint Flemming fern zu liegen. Dagegen nimmt derselbe die Perception von
Gefühls- und Temperatureindrücken durch ein und dasselbe Organ als möglich an. Dass mir
diese Sonderstellung, die man dem Temperatursinne einräumt, nicht berechtigt erscheint, habe ich
oben des nähern ausgeführt. Da das Schmeckvermögen der Fühler und Lippen bisher nicht konstatiert
war, lag auch die Notwendigkeit nicht vor, diese Sinne in dieselben Organe zu verlegen, wie
die übrigen Hautsinne, den mechanischen und thermischen. Vielleicht dürften meine Versuche die
Anschauung F lemming’s ändern, und den Anlass geben, den Namen G e fü h ls z e llen für die
Haarzellen weiter zu fassen, nämlich als Wechselsinnosorgane des mechanischen, thermischen und
chemischen Sinnes.
Mit Bezug auf die hier in Frage stehenden Dinge ist noch die wichtige und interessante
Arbeit von S im ro th (292) zu erwähnen, auf deren Inhalt ich jedoch erst weiter unten bei Besprechung
der Landschnecken näher einzugehen gedenke. Nur das will ich schon hier anführen, dass
Simroth von Schnecken das Epithel der „Geschmackshöhle“ beschreibt und abbildet; er hält diese
den Eingang zum Munde bildende Höhle und die angrenzenden Teile der Lippen für das Geschmacksorgan,
wie ich nach meinen Versuchen glaube, mit vollem Recht. In einer Anmerkung macht Simro
th die folgende interessante Bemerkung (292 pg. 335) „Das durch die Verlegung des Kiefers an
den vorderen Mundeingang, resp. die fehlende Hauteinziehung und die beständige Lage der Schlundganglien
hinter dem Pharynx bewirkte Fehlen der Geschmackshöhle bei den Wasserschnecken deutet
darauf hin, wie sehr die Geschmacksempfindung unserer Tiere der spezifischen Perception der gesamten
Körperoberfläche verwandt sein müsse.“ Auch hierin stimme ich Simroth durchaus zu, nur mit der
Einschränkung, dass ich an Stelle der „gesamten Körperoberfläche“ die Oberfläche der empfindlichen
Teile: Fühler, Mundlappen (Lippen), Fussrand nnd Kopf setzen möchte. Simroth zieht die
Möglichkeit, dass auch die Fühler „schmecken“ könnten, schon in Betracht, indem er die Beobachtung,
dass die Wasserschnecken fremde Gegenstände mit ihren Fühlern bestreichen, darauf bezieht, dass sie
vielleicht »mittelst einer chemischen Einwirkung, wie beim Geruch und Geschmack, sich von deren
Natur überzeugen wollen.“
Während Flemming und Simroth die Frage des Riechvermögens der Wassertiere vorsichtig
umgehen, haben Andere d'en Wasserschnecken unbedenklich R ie c h o rg an e zugesprochen, und
zwar hat dieses Schicksal das von L a c a z e -D u th ie rs und S p en g e l ausführlich besprochene Sinnesorgan
an der Mündung der Atemhöhle betroffen. Bei zahlreichen kiementragenden Schnecken soll
nach Spen’gel ein dem genannten homologes Riechorgan neben den Kiemen sitzen. Ich halte diese
Hypothese für ganz unhaltbar. Weit eher annehmbar dürfte eine der von Simroth vorgeschlagenen
Hypothesen sein, wonach das Organ zur Atmung in Beziehung steht, und das rechtzeitige Offnen und
Schliessen der Atemhöhle besorgen soll. Da wäre dann freilich nach einem Modus zu suchen, wie
bei kiementragenden Mollusken die Erklärung einzurichten wäre, bei welchen, das Offnen und Schliessen
der Lungenhöhle wegfällt.1) Warum ich bei Wasserschnecken schon gar nicht das L ä c a z e ’sche
Organ als Riechwerkzeug gelten lassen kann, brauche ich nach dem im allgemeinen Teile meiner Abhandlung
Gesagten hier nicht mehr auszuführen. Die Gründe fallen mit jenen zusammen, aus welchen
ich bei Wassertieren überhaupt nicht von Riechorganen rede. Aber auch bei Landschnecken kann
ich der Bezeichnung Riechorgane für das genannte Gebilde nicht zustimmen. Der Hauptgrund, welcher
zur Annahme des Riechorganes an der Atemöffnung führte, ist hinfällig geworden: Mail glaubt heute
nicht mehr an den unlösbaren Zusammenhang zwischen Riechen und Atmen. Die Lage des Riechorganes
in den Fühlern bei den Insekten, welche heutzutage wohl allgemein anerkannt ist* hat dieses
anscheinende „Gesetz“ durchbrochen. Ja selbst für den menschlichen Organismus, von welchem jenes
Gesetz herüborgenommen war, ist es nicht zutreffend. Nicht das Riechen beim Atmen scheint mir
das wichtigste, sondern das Wahrnehmen von Gerüchen, welche während des Verweilens der Speisen
im hinteren Mundhöhlenraum durch die Choanen in die Nase dringen. Wollte man .aber selbst annehmen,
die Wahrnehmung von Gasen oder Dämpfen, welche den Atmungswerkzeugen unzuträglich
sind, sei besonders wichtig für die Tiere, so würde dies doch bei den kleinen Tieren, wie es die
Schnecken sind, deshalb nicht ins Gewicht fallen, weil die absolute Distanz zwischen Lunge und Riechorgan
■ selbst dann eine geringe bleibt, wenn letzteres am Kopfe sitzt. Die Luft in 2 cm Abstand
von der Lungenmündung wird nicht besser und reiner sein, als die etwa verunreinigte in unmittelbarster
Nähe derselben; die verunreinigenden Stoffe werden also auch die Riechorgane am Kopfe
noch treffen.
Viele Säugetiere haben wenigstens den Vorteil von der Vergesellschaftung von Riech- und
Atemorgan, dass sie durch willkürliches Schnüffeln dem Riechorgane aktiv den Riechstoff reichlich zuführen
können. Wie aber sollten wohl die Schnecken mit ihrer sog. Lunge das fertig bringen?
Zum Überfluss habe ich mich noch überzeugt, dass die Atemhöhle der Schnecken (auch der
Wasserschnecken) und ganz speziell ihre Mündung gegen chemische Reize hervorragend unempfindlich
ist. Dampfförmige und flüssige Reizstoffe bleiben hier gleichermassen ohne Wirkung. Ich kann. noch
weitergehen und sagen, dass ich bei keinem W e ic h tie re durch me in e V e rsu c h e etw a s
a u ffin d e n k o n n te , was n u r im m in d e ste n für die chemische S in n e s th ä tig k e it des
') Wenn icli nun schon einmal unbewiesene Hypothesen in dieser Fiage berührt habe, so möge gesagt sein, dass
man vielleicht auch daran denken könnte, die Überladung des jenes Organ berührenden Mediums (Wasser oder Luft) mit
Kohlensäure infolge der Atmung könnte reflektorisch die Atmungsthätigkeit in irgendwelcher Weise anregen. Das Wirbeltier
besitzt einen solchen Apparat in der Medulla oblongata, und sein adäquater Heiz ist ein chemischer, vermittelt durch
das kohlensäurereiche, sauerstoffarme Blut. Sauerstoffmangel oder Kohlensäiirevermehrung könnte auch den adäquaten
Reiz für das L a c a z e - S p e n g e Psche Organ bilden. Die Thätigkeit jenes Organes wäre dann kaum mehr unter die
Sinne zu rechnen. Dass beim Wirbeltiere die Lage des den Reflex vermittelnden Organes im Centralorgan, bei den Schnecken
in der Peripherie liegen würde, dürfte kein Grund gegen diese Hypothese sein, da die Centralisierung des Nervensystems
anerkanntermassen bei den Wirbellosen viel weniger fortgeschritten ist, als bei Wirbeltieren. .
Ich möchte übrigens diesen Gedanken nicht als meine Theorie hingestellt wissen, habe ihn vielmehr nur ausgesprochen,
um zu zeigen, dass sich gegen die Riechorganhypothese leicht andere stellen lassen, welche die Vergesellschaftung des in
Rede stehenden Sinnesorganes mit den Werkzeugen der Atmung so gut öder besser wie jene erklären.
Bibliotheca zoologica. Heft 18.