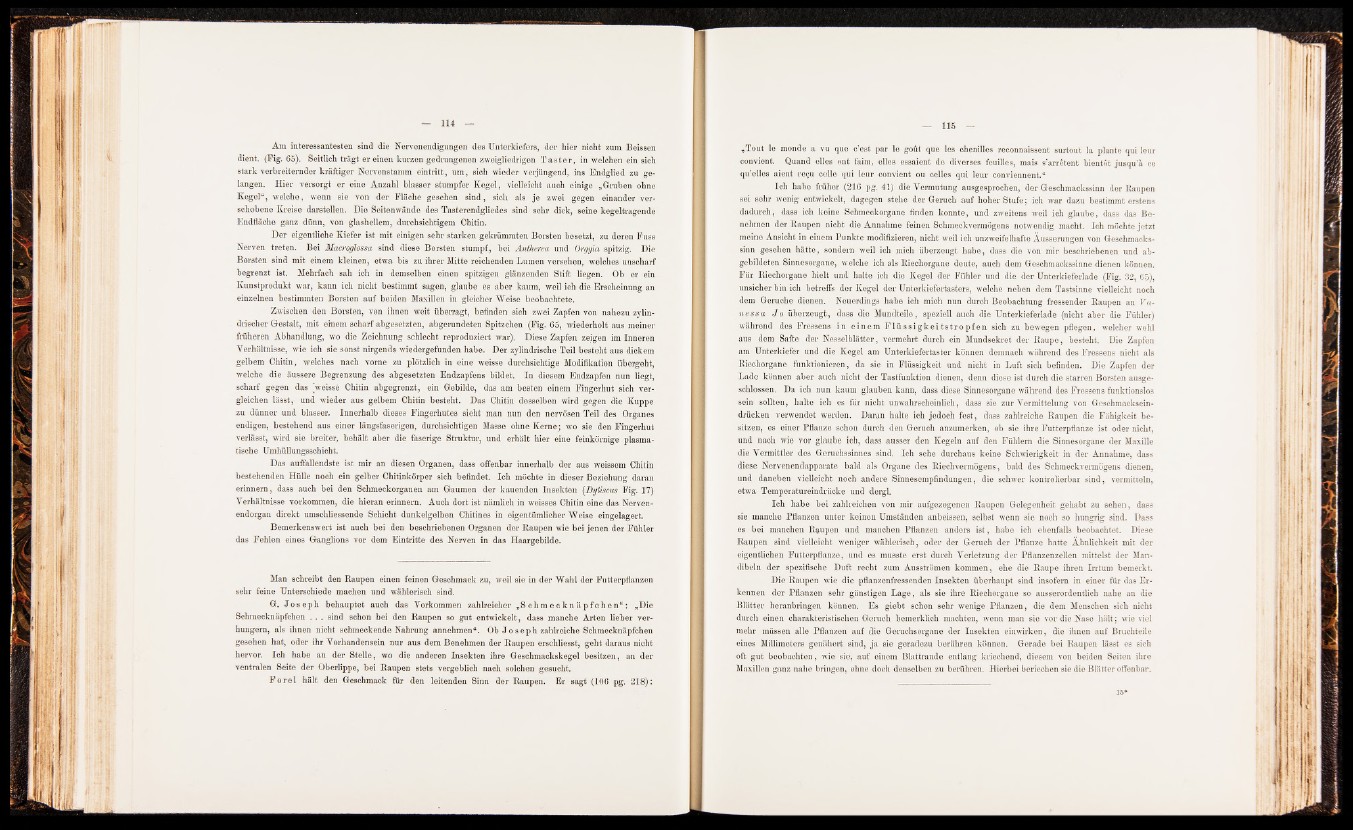
Am interessantesten sind die Nervenendigungen des Unterkiefers, der hier nicht zum Beissen
dient. (Fig. 65). Seitlich trägt er einen kurzen gedrungenen zweigliedrigen T a ste r, in welchen ein sich
stark verbreiternder kräftiger Nervenstamm eintritt, um, sich wieder verjüngend, ins Endglied zu gelangen.
Hier versorgt er eine Anzahl blasser stumpfer Kegel, vielleicht auch einige „Gruben ohne
Kegel“, welche, wenn sie von der Fläche gesehen sind, sich als je zwei gegen einander verschobene
Kreise darstellen. Die Seitenwände des Tasterendgliedes sind sehr dick, seine kegeltragende
Endfläche ganz dünn, von glashellem, durchsichtigem Chitin.
Der eigentliche Kiefer ist mit einigen sehr starken gekrümmten Borsten besetzt, zu deren Fuss
Nerven treten. Bei Macroglossa sind diese Borsten stumpf, bei Antherea und Orgyia spitzig. Die
Borsten sind mit einem kleinen, etwa bis zu ihrer Mitte reichenden Lumen versehen, welches unscharf
begrenzt ist. Mehrfach sah ich in demselben einen spitzigen glänzenden Stift liegen. Ob er ein
Kunstprodukt war, kann ich nicht bestimmt sagen, glaube es aber kaum, weil ich die Erscheinung an
einzelnen bestimmten Borsten auf beiden Maxillen in gleicher Weise beobachtete.
Zwischen den Borsten, von ihnen weit überragt, befinden sich zwei Zapfen von nahezu zylindrischer
Gestalt, mit einem scharf abgesetzten, abgerundeten Spitzchen (Fig. 65, wiederholt aus meiner
früheren Abhandlung, wo die Zeichnung schlecht reproduziert war). Diese Zapfen zeigen im Inneren
Verhältnisse, wie ich sie sonst nirgends wiedergefunden habe. Der zylindrische Teil besteht aus dickem
gelbem Chitin, welches nach vorne zu plötzlich in eine weisse durchsichtige Modifikation übergeht,
welche die äussere Begrenzung des abgesetzten Endzapfens bildet. In diesem Endzapfen nun liegt,
scharf gegen das [weissö Chitin abgegrenzt, ein Gebilde, das am besten einem Fingerhut sich vergleichen
lässt, und wieder aus gelbem Chitin besteht. Das Chitin desselben wird gegen die Kuppe
zu dünner und blasser. Innerhalb dieses Fingerhutes sieht man nun den nervösen Teil des Organes
endigen, bestehend aus einer längsfaserigen, durchsichtigen Masse ohne Kerne; wo sie den Fingerhut
verlässt, wird sie breiter, behält aber die faserige Struktur, und erhält hier eine feinkörnige plasmatische
Umhüllungsschicht.
Das auffallendste ist mir an diesen Organen, dass offenbar innerhalb der aus weissem Chitin
bestehenden Hülle noch ein gelber Chitinkörper sich befindet. Ich möchte in dieser Beziehung daran
erinnern, dass auch bei den Schmeckorganen am Gaumen der kauenden Insekten (Dytiscus Fig. 17)
Verhältnisse Vorkommen, die hieran erinnern. Auch dort ist nämlich in weisses Chitin eine das Nerven-
endorgan direkt umschliessende Schicht dunkelgelben Chitines in eigentümlicher Weise eingelagert.
Bemerkenswert ist auch bei den beschriebenen Organen der Raupen wie bei jenen der Fühler
das Fehlen eines Ganglions vor dem Eintritte des Nerven in das Haargebilde.
Man schreibt den Raupen einen feinen Geschmack zu, weil sie in der Wahl der Futterpflanzen
sehr feine Unterschiede machen und wählerisch sind.
G. Jo s e p h behauptet auch das Vorkommen zahlreicher „ S c hm e c k n ä p f c h e n “ : „Die
Schmecknäpfchen . . . sind schon bei den Raupen so gut entwickelt, dass manche Arten lieber verhungern,
als ihnen nicht schmeckende Nahrung annehmen“. Ob Jo s e p h zahlreiche Schmecknäpfchen
gesehen hat, oder ihr Vorhandensein nur aus dem Benehmen der Raupen erschliesst, geht daraus nicht
hervor. Ich habe an der Stelle, wo die anderen Insekten ihre Geschmackskegel besitzen, an der
ventralen Seite der Oberlippe, bei Raupen stets vergeblich nach solchen gesucht.
F o re l hält den Geschmack für den leitenden Sinn der Raupen. Er sagt (106 pg. 218):
„Tout le monde a vu que c’est par le goût que les chenilles reconnaissent surtout la plante qui leur
convient. Quand elles ont faim, elles essaient de diverses feuilles, mais s’arrêtent bientôt jusqu’à ce
qu’elles aient reçu celle qui leur convient ou celles qui leur conviennent.“
Ich habe früher (216 pg. 41) die Vermutung ausgesprochen, der Geschmackssinn der Raupen
sei sehr wenig entwickelt, dagegen stehe der Geruch auf hoher Stufe; ich war dazu bestimmt erstens
dadurch, dass ich keine Schmeckorgane finden konnte, und zweitens weil ich glaube, dass das Benehmen
der Raupen nicht die Annahme feinen Schmeckvermögens notwendig macht. Ich möchte jetzt
meine Ansicht in einem Punkte modifizieren, nicht weil ich unzweifelhafte Äusserungen von Geschmackssinn
gesehen hätte, sondern weil ich mich überzeugt habe, dass die von mir beschriebenen und abgebildeten
Sinnesorgane, welche ich als Riech organe deute, auch dem Geschmackssinne dienen können.
Für Riechorgane hielt und halte ich die Kegel der Fühler und die der Unterkieferlade (Fig. 32, 65),
unsicher bin ich betreffs der Kegel der Unterkiefertasters, welche neben dem Tastsinne vielleicht noch
dem Gerüche dienen. Neuerdings habe ich mich nun durch Beobachtung fressender Raupen an Vanessa
Jo überzeugt, dass die Mundteile, speziell auch die Unterkieferlade (nicht aber die Fühler)
während des Fressens in einem F lü s s ig k e its tro p fe n sich zu bewegen pflegen, welcher wohl
aus dem Safte der Nesselblätter, vermehrt durch ein Mundsekret der Raupe, besteht. Die Zapfen
am Unterkiefer und die Kegel am Unterkiefertaster können demnach während des Fressens nicht als
Riechorgane funktionieren, da sie in Flüssigkeit und nicht in Luft sich befinden. Die Zapfen der
Lade können aber auch nicht der Tastfunktion dienen, denn diese ist durch die starren Borsten ausgeschlossen.
Da ich nun kaum glauben kann, dass diese Sinnesorgane während des Fressens funktionslos
sein sollten, halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass sie zur Vermittelung von Geschmackseindrücken
verwendet werden. Daran halte ich jedoch fest, dass zahlreiche Raupen die Fähigkeit besitzen,
es einer Pflanze schon durch den Geruch anzumerken, ob sie ihre Futterpflanze ist oder nicht,
und nach wie vor glaube ich, dass ausser den Kegeln auf den Fühlern die Sinnesorgane der Maxille
die Vermittler des Geruchssinnes sind. Ich sehe durchaus keine Schwierigkeit in der Annahme, dass
diese Nervenendapparate bald als Organe des Riechvermögens, bald des Schmeckvermögens dienen,
und daneben vielleicht noch andere Sinnesempfindungen, die schwer kontrolierbar sind, vermitteln,
etwa Temperatureindrücke und dergl.
Ich habe bei zahlreichen von mir aufgezogenen Raupen Gelegenheit gehabt zu sehen, dass
sie manche Pflanzen unter keinen Umständen anbeissen, selbst wenn sie noch so hungrig sind. Dass
es bei manchen Raupen und manchen Pflanzen anders ist, habe ich ebenfalls beobachtet. Diese
Raupen sind vielleicht weniger wählerisch, oder der Geruch der Pflanze hatte Ähnlichkeit mit der
eigentlichen Futterpflanze, und es musste erst durch Verletzung der Pflanzenzellen mittelst der Man-
dibeln der spezifische Duft recht zum Ausströmen kommen, ehe die Raupe ihren Irrtum bemerkt.
Die Raupen wie die pflanzenfressenden Insekten überhaupt sind insofern in einer für das Erkennen
der Pflanzen sehr günstigen Lage, als sie ihre Riechorgane so ausserordentlich nahe an die
Blätter heranbringen können. Es giebt schon sehr wenige Pflanzen, die dem Menschen sich nicht
durch einen charakteristischen Geruch bemerklich machten, wenn man sie vor die Nase hält; wie viel
mehr müssen alle Pflanzen auf die Geruchsorgane der Insekten einwirken, die ihnen auf Bruchteile
eines Millimeters genähert sind, ja sie geradezu berühren können. Gerade bei Raupen lässt es sich
oft gut beobachten, wie sie, auf einem Blattrande entlang kriechend, diesem von beiden Seiten ihre
Maxillen ganz nahe bringen, ohne doch denselben zu berühren. Hierbei beriechen sie die Blätter offenbar.