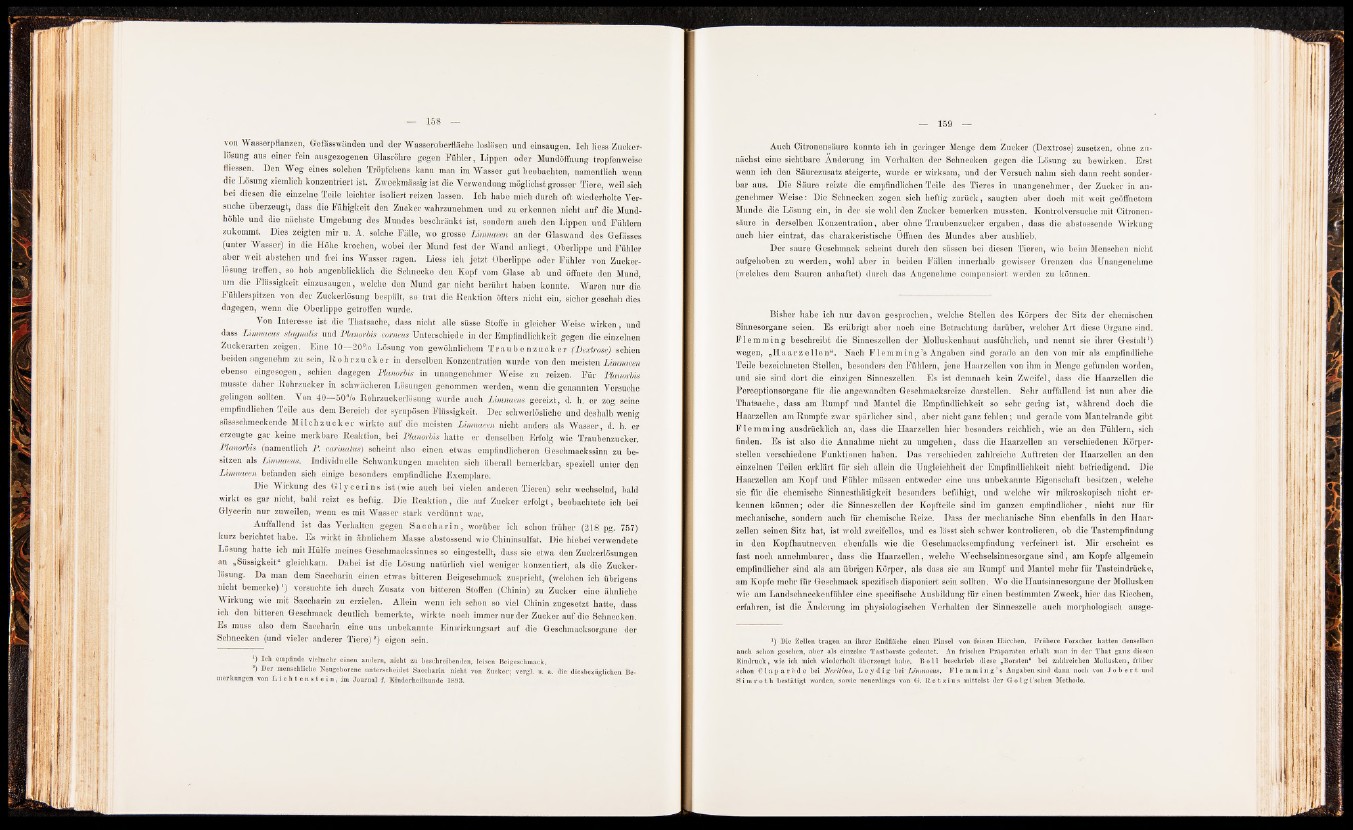
von Wasserpflanzen, Gefässwänden und der Wasseroberfläche loslösea und einsaugen. loh liess Zuokerlösung
aus einer fein ausgezogenen Glasröhre gegen Fühler, Lippen oder .Mundöffnung tropfenweise
fliessen. Den Weg eines solchen Tröpfchens kann man im Wasser gut beobachten, namentlich Wenn
die Lösung ziemlich konzentriert ist. Zweckmässig ist die Verwendung möglichst grösser Tiere, weil sich
bei diesen die einzelne Teile leichter isoliert reizen lassen. Ich habe mich durch oft wiederholte Versuche
überzeugt, dass die Fähigkeit den Zuoker wahrzunehmen und zu erkennen nicht auf die Mundhöhle
und die nächste Umgebung des Mundes beschränkt ist, sondern auch den Lippen und Fühlern
zukommt. Dies zeigten mir u. A. solche Fälle, wo grosse Limnaeen an der Glaswand des Gefässes
(unter Wasser) in die Höhe krochen, wobei der Mund fest der Wand anliegt, Oberlippe und Fühler
aber weit abstehen und frei ins Wasser ragen. Liess ich jetzt Oberlippe oder Fühler von Zuckerlösung
treffen, so hob augenblicklich die Schnecke den Kopf vom Glase ab und öffnete den Mund,
um die Flüssigkeit einzusaugen, welche den Mund gar. nicht berührt haben konnte. Waren nur die
Fühlerspitzen von der Zuckerlösung bespült, so. trat die Reaktion öfters nicht ein, sioher geschah dies
dagegen, wenn die Oberlippe getroffen wurde.
Von Interesse ist die Thatsache, dass nicht alle süsse Stoffe in gleicher Weise wirken, und
dass Linmaeus stagnalis und Planorbis corneus Unterschiede in der Empfindlichkeit gegen die einzelnen
Zuckerarten zeigen. Eine 10—20°/o Lösung von gewöhnlichem T ra u b e n z u c k e r (Dextrose) schien
beiden angenehm zu sein, R o h rz u c k e r in derselben Konzentration wurde von den meisten Limnaeen
ebenso eingesogen, schien dagegen Planorbis in unangenehmer Weise zu reizen. Für Planorbis
musste daher Rohrzucker in schwächeren Lösungen genommen werden, wenn die genannten Versuche
gelingen sollten. Von 40 50°/o Rohrzuckerlösung wurde auch Limnaeus gereizt, d. h. er zog seine
empfindlichen Teile aus dem Bereich der syrupösen Flüssigkeit. Der schwerlösliche und deshalb wenig
süssschmeckende Milch zu ck e r wirkte auf die meisten Limnaeen nicht anders als Wasser, d. h. er
erzeugte gar keine merkbare Reaktion, bei Planorbis hatte er denselben Erfolg wie Traubenzucker.
Planorbis (namentlich P. carinatus) scheint also einen etwas empfindlicheren Geschmackssinn zu besitzen
als Limnaeus. Individuelle Schwankungen machten sich überall bemerkbar, speziell unter den
Limnaeen befanden sich einige besonders empfindliche Exemplare.
Die Wirkung des G ly c e rin s ist (wie auch bei vielen anderen Tieren) sehr wechselnd, bald
wirkt es gar nicht, bald reizt es heftig. Die Reaktion, die auf Zucker erfolgt, beobachtete ich bei
Glycerin nur zuweilen, wenn es mit Wasser stark verdünnt war.
Auffallend ist das Verhalten gegen S a c c h a rin , worüber ich schon früher (218 pg. 757)
kurz berichtet habe. Es wirkt in ähnlichem Masse abstossend wie Chininsulfat. Die hiebei verwendete
Lösung hatte ich mit Hülfe meines Geschmackssinnes so eingestellt, dass sie etwa den Zuckerlösungen
an „Süssigkeit“ gleichkam. Dabei ist die Lösung natürlich viel weniger konzentiert, als die Zuckerlösung.
Da man dem Saccharin einen etwas bitteren Beigeschmack zuspricht, (welchen ich übrigens
nicht bemerke)') versuchte ich durch Zusatz von bitteren Stoffen (Chinin) zu Zucker eine ähnliche
Wirkung wie mit Saccharin zu erzielen. Allein wenn ich schon so viel Chinin zugesetzt hatte, dass
ich den bitteren Geschmack deutlich bemerkte, wirkte noch immer nur der Zucker auf die Schnecken.
Es muss also dem Saccharin eine uns unbekannte Einwirkungsart auf die Geschmacksorgane der
Schnecken (und vieler anderer Tiere)2) eigen sein.
x) Ich empfinde vielmehr einen ändern, nicht zu beschreibenden, leisen Beigeschmack.
*) Der menschliche Neugeborene unterscheidet Saccharin nicht von Zucker; vergl. u. a. die diesbezüglichen Bemerkungen
von L i c h t e n s t e i n , im Journal f. Kinderheilkunde 1893.
Auch Citronensäure konnte ich in geringer Menge dem Zucker (Dextrose) zusetzen, ohne zunächst
eine sichtbare Änderung im Verhalten der Schnecken gegen die Lösung zu bewirken. Erst
wenn ich den Säurezusatz steigerte, wurde er wirksam, und der Versuch nahm sich dann recht sonderbar
aus. Die Säure reizte die empfindlichen Teile des Tieres in unangenehmer, der Zucker in angenehmer
Weise: Die Schnecken zogen sich heftig zurück, saugten aber doch mit weit geöffnetem
Munde die Lösung ein, in der sie wohl den Zucker bemerken mussten. Kontrolversuche mit Citronensäure
in derselben Konzentration, aber ohne Traubenzucker ergaben, dass die abstossende Wirkung
auch hier eintrat, das charakeristische Offnen des Mundes aber ausblieb.
Der saure Geschmack scheint durch den süssen bei diesen Tieren, wie beim Menschen nicht
aufgehoben zu werden, wohl aber in beiden Fällen innerhalb gewisser Grenzen das Unangenehme
(welches dem Sauren anhaftet) durch das Angenehme compensiert werden zu können.
Bisher habe ich nur davon gesprochen, welche Stellen des Körpers der Sitz der chemischen
Sinnesorgane seien. Es erübrigt aber noch eine Betrachtung darüber, welcher Art diese Organe sind.
F lemmin g beschreibt die Sinneszellen der Molluskenhaut ausführlich, und nennt sie ihrer Gestalt1)
wegen, „H a a rz e ile n “. Nach F 1 emming’s Angaben sind gerade an den von mir als empfindliche
Teile bezeichneten Stellen, besonders den Fühlern, jene Haarzellen von ihm in Menge gefunden worden,
und sie sind dort die einzigen Sinneszellen. Es ist demnach kein Zweifel, dass die Haarzellen die
Perceptionsorgane für die angewandten Geschmacksreize darstellen. Sehr auffallend ist nun aber die
Thatsache, dass am Rumpf und Mantel die Empfindlichkeit so sehr gering ist, während doch die
Haarzellen am Rumpfe zwar spärlicher sind, aber nicht ganz fehlen; und gerade vom Mantelrande gibt
Flemming ausdrücklich an, dass die Haarzellen hier besonders reichlich, wie an den Fühlern, sich
finden. Es ist also die Annahme nicht zu umgehen, dass die Haarzellen an verschiedenen Körperstellen
verschiedene Funktionen haben. Das verschieden zahlreiche Auftreten der Haarzellen an den
einzelnen Teilen erklärt für sich allein die Ungleichheit der Empfindlichkeit nicht befriedigend. Die
Haarzellen am Kopf und Fühler müssen entweder eine uns unbekannte Eigenschaft besitzen, welche
sie für die chemische Sinnesthätigkeit besonders befähigt, und welche wir mikroskopisch nicht erkennen
können j oder die Sinneszellen der Kopfteile sind im ganzen empfindlicher, nicht nur für
mechanische, sondern auch für chemische Reize. Dass der mechanische Sinn ebenfalls in den Haarzellen
seinen Sitz hat, ist wohl zweifellos, und es lässt sich schwer kontrolieren, ob die Tastempfindung
in den Kopfhautnerven ebenfalls wie die Geschmacksempfindung verfeinert ist. Mir erscheint es
fast noch annehmbarer, dass die Haarzellen, welche Wechselsinnesorgane sind, am Kopfe allgemein
empfindlicher sind als am übrigen Körper, als dass sie am Rumpf und Mantel mehr für Tasteindrücke,
am Kopfe mehr für Geschmack spezifisch disponiert sein sollten. Wo die Hautsinnesorgane der Mollusken
wie am Landschneckenfühler eine specifische Ausbildung für einen bestimmten Zweck, hier das Riechen,
erfahren, ist die Änderung im physiologischen Verhalten der Sinneszelle auch morphologisch ausge-
*) Die Zellen tragen an ihrer Endfläche einen Pinsel von feinen Härchen. Frühere Forscher hatten denselben
auch schon gesehen, aber als einzelne Tasthorste gedeutet. An frischen Präparaten erhält man in der That ganz diesen
Eindruck, wie ich mich wiederholt überzeugt habe. B o 11 beschrieb diese „Borsten8 hei zahlreichen Mollusken, früher
schon C l a p a r ö d e hei Neritina, L e y d i g hei' JJmnaeus. F l e m m i n g ’ s Angaben sind dann noch von J o b e r t und
S i m r o t l i bestätigt worden, sowie neuerdings von G. R e t z i u s mittelst der Go 1 g i ’schen Methode.