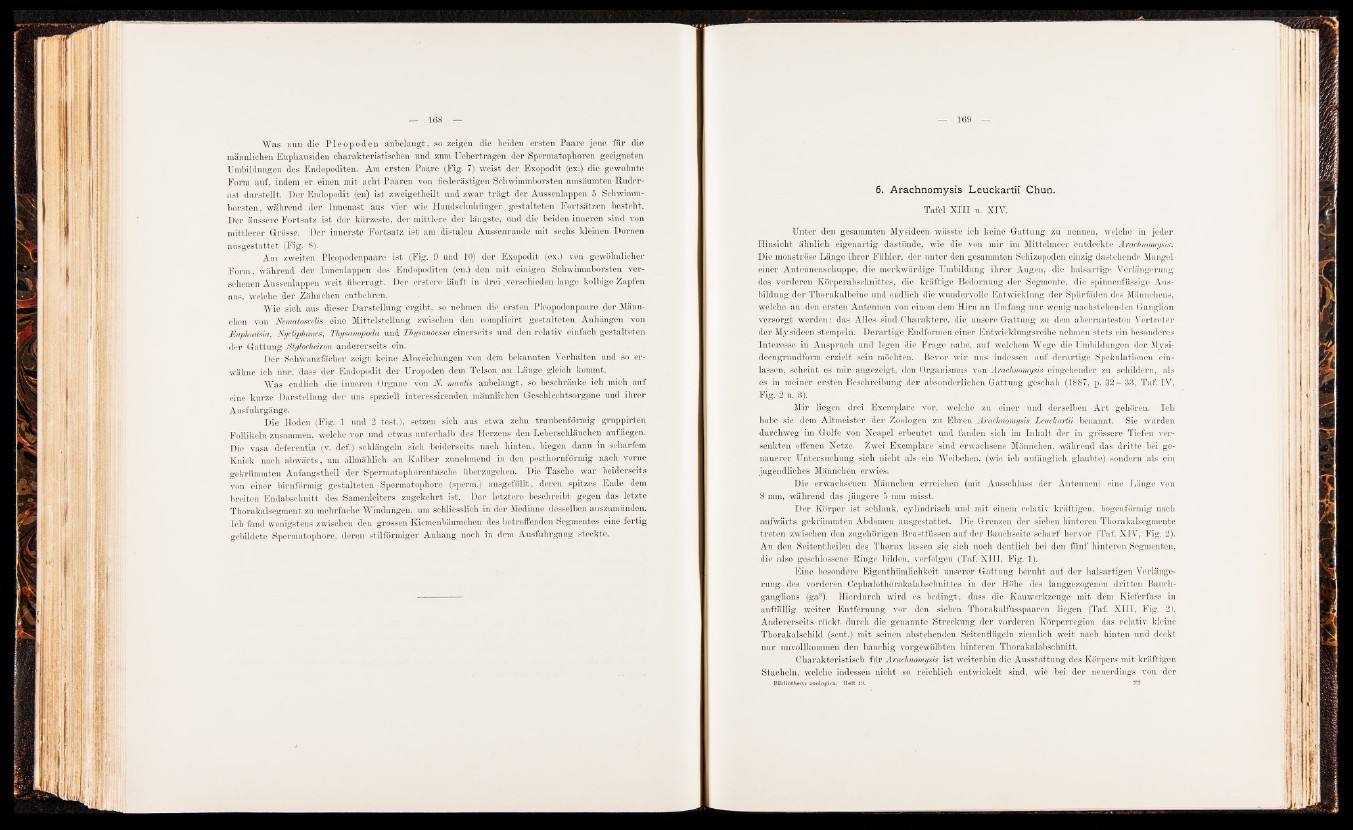
Was nun die P le o p o d e n anbelangt, so zeigen die beiden ersten Paare jene für die
männlichen Eupliausiden charakteristischen und zum Uebertragen der Spermatophoren geeigneten
Umbildungen des Endopoditen. Am ersten Paare (Fig. 7) weist der Exopodit (ex.) die gewohnte
Form auf, indem er einen mit acht Paaren von fiederästigen Schwimmborsten umsäumten Ruderast
darstellt. Der Endopodit (en) ist zweigetheilt und zwar trägt der Aussenlappen 5 Schwimmborsten,
während der Innenast aus vier wie Handschuhfinger gestalteten Fortsätzen besteht.
Der äussere Fortsatz ist der kürzeste, der mittlere der längste, und die beiden inneren sind von
mittlerer Grösse. Der innerste Fortsatz ist am distalen Aussenrande mit sechs kleinen Dornen
ausgestattet (Fig.- 8).
Am zweiten Pleopodenpaare ist (Fig. 9 und 10) der Exopodit (ex.) von gewöhnlicher
Form, während der Innenlappen des Endopoditen (en.) den mit einigen Schwimmborsten versehenen
Aussenlappen weit überragt. Der erstere läuft in drei verschieden lange kolbige Zapfen
aus, welche der Zähnchen entbehren.
Wie sich aus dieser Darstellung ergibt, so nehmen die ersten Pleopodenpaare der Männchen
von Nematoscelis eine Mittelstellung zwischen den complicirt gestalteten Anhängen von
Enphausia, Nyctiphanes, Thysanopocla und Thysanoessa einerseits und den relativ einfach gestalteten
der Gattung Stylocheiron andererseits ein.
Der Schwanzfächer zeigt keine Abweichungen von dem bekannten Verhalten und so erwähne
ich nur, dass der Endopodit der Uropoden dem Telson an Länge gleich kommt.
Was endlich die inneren Organe von K mantis anbelangt, so beschränke ich mich auf
eine kurze Darstellung der uns speziell interessirenden männlichen Geschlechtsorgane und ihrer
Ausfuhrgänge.
Die Hoden (Fig. 1 und 2 test.), setzen sich aus etwa zehn traubenförmig gruppirten
Follikeln zusammen, welche vor und etwas unterhalb des Herzens den Leberschläuchen aufliegen.
Die vasa deferentia (v. def.) schlängeln sich beiderseits nach hinten, biegen dann in scharfem
Knick nach abwärts, um allmählich an Kaliber zunehmend in den posthornförmig nach vorne
gekrümmten Anfangstheil der Spermatophorentasche überzugehen. Die Tasche war beiderseits
von einer birnförmig gestalteten Spermatophore (sperm.) ausgefüllt, deren spitzes Ende dem
breiten Endabschnitt des Samenleiters zugekehrt ist. Der letztere beschreibt gegen das letzte
Thorakalsegment zu mehrfache Windungen, um schliesslich in der Mediane desselben auszumünden.
Ich fand wenigstens zwischen den grossen Kiemenbäumchen des betreffenden Segmentes eine fertig-
gebildete Spermatophore, deren stilförmiger Anhang noch in dem Ausfuhrgang steckte.
6. Arachnomysis Leuckartii Chun.
Tafel XIII u. XIV.
Unter den gesammten Mysideen wüsste ich keine Gattung zu nennen, welche in jeder
Hinsicht ähnlich eigenartig dastünde, wie die von mir im Mittelmeer entdeckte Arachnomysis.
Die monströse Länge ihrer Fühler, der unter den gesammten Schizopoden einzig dastehende Mangel
einer Antennenschuppe, die merkwürdige Umbildung ihrer Augen, die halsartige Verlängerung
des vorderen Körperabschnittes, die kräftige Bedornung der Segmente, die spinnenfüssige Ausbildung
der Thorakalbeine und endlich die wundervolle Entwicklung der Spiirfäden des Männchens,
welche an den ersten Antennen von einem dem Hirn an Umfang nur wenig nachstehenden Ganglion
versorgt werden: das Alles sind Charaktere, die unäere Gattung zu dem aberrantesten Vertreter
der Mysideen stempeln. Derartige Endformen einer Entwicklungsreihe nehmen stets ein besonderes
Interesse in Anspruch und legen die Frage nahe, auf welchem Wege die Umbildungen der Mysi-
deengrundform erzielt sein möchten. Bevor wir uns indessen auf derartige Spekulationen einlassen,
scheint es mir angezeigt, den Organismus von Arachnomysis eingehender zu schildern, als
es in meiner ersten Beschreibung der absonderlichen Gattung geschah (1887, p. 32 — 33, Taf. IV,
Fig. 2 u. 3).
Mir liegen drei Exemplare vor, welche zu einer und derselben Art gehören. Ich
habe sie dem Altmeister der Zoologen zu Ehren Arachnomysis Leuckartii benannt. Sie wurden
durchweg im Golfe von Neapel erbeutet und fanden sich im Inhalt der in grössere Tiefen versenkten
offenen Netze. Zwei Exemplare sind erwachsene Männchen, während das dritte bei genauerer
Untersuchung sich nicht als ein Weibchen, (wie ich anfänglich glaubte) sondern als ein
jugendliches Männchen erwies:
Die erwachsenen Männchen erreichen (mit Ausschluss der Antennen) eine Länge von
8 mm, während das jüngere 5 mm misst.
Der Körper ist schlank, cylindrisch und mit einem relativ kräftigen, bogenförmig nach
aufwärts gekrümmten Abdomen ausgestattet. Die Grenzen der sieben hinteren Thorakalsegmente
treten zwischen den zugehörigen Brustfüssen auf der Bauchseite scharf hervor (Taf. XIV, Fig. 2).
An den Seitentheilen des Thorax lassen sie sich noch deutlich bei den fünf hinteren Segmenten,
die also geschlossene Ringe bilden, verfolgen (Taf. XIII, Fig. 1).
Eine besondere Eigenthümlichkeit unserer Gattung beruht auf der halsartigen Verlängerung
des vorderen Cephalothorakalabschnittes in der Höhe des langgezogenen dx-itten Bauchganglions
(ga8). Hierdurch wird es bedingt, dass die Kauwerkzeuge mit dem Kieferfuss in
auffällig weiter Entfernung vor den sieben Thorakalfusspaaren liegen (Taf. XIII, Fig. 2).
Andererseits rückt durch die genannte Streckung der vorderen Körperregion das relativ kleine
Thorakalschild (scut.) mit seinen abstehenden Seitenflügeln ziemlich weit nach hinten und deckt
nur unvollkommen den bauchig vorgewölbten hinteren Thorakalabschnitt.
Charakteristisch für Arachnomysis ist weiterhin die Ausstattung des Körpers mit kräftigen
Stacheln, welche indessen nicht so reichlich entwickelt sind, wie bei der neuerdings von der
Bibliotheca zoologica. Heft 19. 22