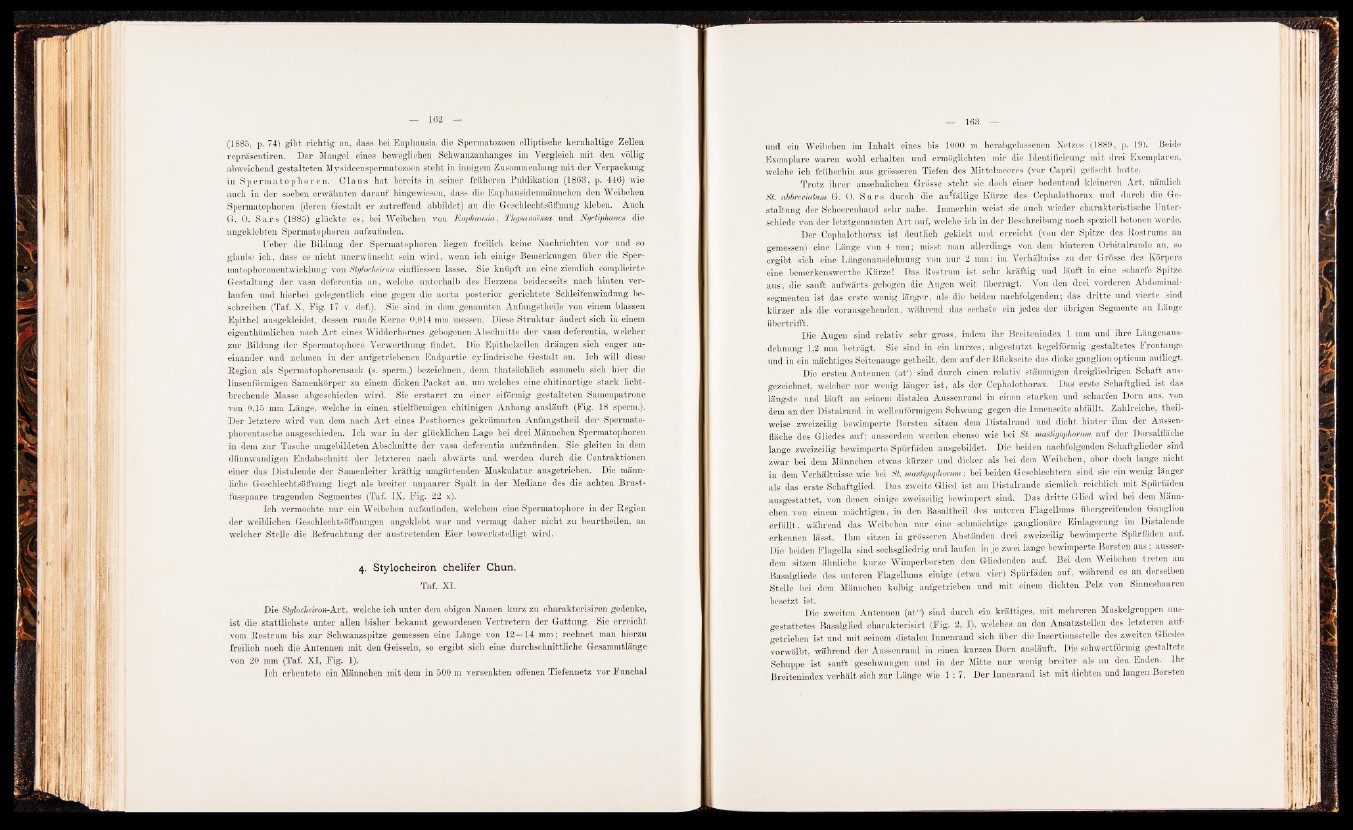
(1885, p. 74) gibt richtig an, dass bei Euphausia die Spermatozoen elliptische kernhaltige Zellen
repräsentiren. Der Mangel eines beweglichen Schwanzanhanges im Vergleich mit den völlig
abweichend gestalteten Mysideenspermatozoen steht in innigem Zusammenhang mit der Verpackung
in S p e rm a to p lio re n . C lau s hat bereits in seiner früheren Publikation (1863, p. 446) wie
auch in der soeben erwähnten darauf hingewiesen, dass die Euphausidenmännchen den Weibchen
Spermatophoren (deren Gestalt er zutreffend abbildet) an die Geschlechtsöffnung kleben. Auch
G. 0. S a r s (1885) glückte es, bei Weibchen von Euphausia, Thysanoessa und Nyctiphanes die
angeklebten Spermatophoren aufzufinden.
Ueber die Bildung der Spermatophoren liegen freilich keine Nachrichten vor und so
glaube ich, dass es nicht unerwünscht sein wird, wenn ich einige Bemerkungen über die Spermatophorenentwicklung
von Stylocheiron einfliessen lasse. Sie knüpft an eine ziemlich complicirte
Gestaltung der vasa deferentia an, welche unterhalb' des Herzens beiderseits nach hinten verlaufen
und hierbei gelegentlich eine gegen die aorta posterior gerichtete Schleifenwindung beschreiben
(Taf. X, Fig. 17 v. def.). Sie sind in dem genannten Anfangstheile von einem blassen
Epithel ausgekleidet, dessen runde Kerne 0,014 mm messen. Diese Struktur ändert sich in einem
eigenthümlichen nach Art eines Widderhornes gebogenen Abschnitte der vasa deferentia, welcher
zur Bildung der Spermatophore Verwerthung findet. Die Epithelzellen drängen sich enger aneinander
und nehmen in der aufgetriebenen Endpartie cylindrische Gestalt an. Ich will diese
Region als Spermatophorensack (s. sperm.) bezeichnen, denn thatsächlich sammeln sich hier die
linsenförmigen Samenkörper zu einem dicken Packet an, um welches eine chitinartige stark lichtbrechende
Masse abgeschieden wird. Sie erstarrt zu einer eiförmig gestalteten Samenpatrone
von 0,15 mm Länge, welche in einen stielförmigen chitinigen Anhang ausläuft (Fig. 18 sperm.).
Der letztere wird von dem nach Art eines Posthornes gekrümmten Anfangstheil der Spermatophorentasche
ausgeschieden. Ich war in der glücklichen Lage bei drei Männchen Spermatophoren
in dem zur Tasche umgebildeten Abschnitte der vasa deferentia aufzufinden. Sie gleiten in dem
dünnwandigen Endabschnitt der letzteren nach abwärts und werden durch die Contraktionen
einer das Distalende der Samenleiter kräftig umgiirtenden Muskulatur ausgetrieben. Die männliche
Geschlechtsöffriung liegt als breiter unpaarer Spalt in der Mediane des die achten Brust-
fusspaare tragenden Segmentes (Taf. IX, Fig. 22 x).
Ich vermochte nur ein Weibchen aufzufinden, welchem eine Spermatophore in der Region
der weiblichen Geschlechtsöffnungen angeklebt war und vermag daher nicht zu beurtheilen, an
welcher Stelle die Befruchtung der austretenden Eier bewerkstelligt wird.
4. Stylocheiron chelifer Chun.
Taf. XI.
Die Stylocheiron-Art, welche ich unter dem obigen Namen kurz zu charakterisiren gedenke,
ist die stattlichste unter allen bisher bekannt gewordenen Vertretern der Gattung. Sie erreicht
vom Rostrum bis zur Schwanzspitze gemessen eine Länge von 12—14 mm; rechnet man hierzu
freilich noch die Antennen mit den Geissein, so ergibt sich eine durchschnittliche Gesammtlänge
von 20 mm (Taf. XI, Fig. 1).
Ich erbeutete ein Männchen mit dem in 500 m versenkten offenen Tiefennetz vor Funchal
und ein Weibchen im Inhalt eines bis 1000 m herabgelassenen Netzes (1889, p. 19). Beide
Exemplare waren wohl erhalten und ermöglichten mir die Identificirung mit drei Exemplaren,
welche ich früherhin aus grösseren Tiefen des Mittelmeeres (vor Capri) gefischt hatte.
Trotz ihrer ansehnlichen Grösse steht sie doch einer bedeutend kleineren Art, nämlich
St. abbreviatum G. O. S a r s durch die auffällige Kürze des Cephalothorax und durch die Gestaltung
der Scheerenhand sehr nahe. Immerhin weist sie auch wieder charakteristische Unterschiede
von der letztgenannten A rt auf, welche ich in der Beschreibung noch speziell betonen werde.
Der Cephalothorax ist deutlich gekielt und erreicht (von der Spitze des Rostrums an
gemessen) eine Länge von 4 mm; misst man allerdings von dem hinteren Orbitalrande an, so
ergibt sich eine Längenausdehnung von nur 2 mm: im Verhältniss zu der Grösse des Körpers
eine bemerkenswerthe Kürze! Das Rostrum ist sehr kräftig und läuft in eine scharfe Spitze
aus, die sanft aufwärts gebogen die Augen weit überragt. Von den drei vorderen Abdominalsegmenten
ist das- erste wenig länger, als die beiden nachfolgenden; das dritte und vierte sind
kürzer als die vorausgehenden, während das sechste ein jedes der übrigen Segmente an Länge
übertrifft.
Die Augen sind relativ sehr gross, indem ihr Breitenindex 1 mm und ihre Längenausdehnung
1,2 mm beträgt. Sie sind in ein kurzes, abgestutzt kegelförmig gestaltetes Frontauge
und in ein mächtiges Seitenauge getheilt, dem auf der Rückseite das dicke ganglion opticum aufliegt.
Die ersten Antennen (at') sind durch einen relativ stämmigen dreigliedrigen Schaft ausgezeichnet,
welcher nur wenig länger ist, als der Cephalothorax. Das erste Schaftglied ist das
längste und läuft an seinem distalen Aussenrand in einen starken und scharfen Dorn aus, von
dem an der Distalrand in wellenförmigem Schwung gegen die Innenseite abfällt. Zahlreiche, theil-
weise zweizeilig bewimperte Borsten sitzen dem Distalrand und dicht hinter ihm der Aussen-
fläche des Gliedes auf; ausserdem werden ebenso wie bei St. mastigophorum auf der Dorsalfläche
lange zweizeilig bewimperte Spürfäden ausgebildet. Die beiden nachfolgenden Schaftglieder sind
zwar bei dem Männchen etwas kürzer und dicker als bei dem Weibchen, aber doch lange nicht
in dem Verhältnisse wie bei St. mastigophorum; bei beiden Geschlechtern sind sie ein wenig länger
als das erste Schaftglied. Das zweite Glied ist am Distalrande ziemlich reichlich mit Spürfäden
ausgestattet, von denen einige zweizeilig bewimpert sind. Das dritte Glied wird bei dem Männchen
von einem mächtigen, in den Basaltheil des unteren Flageilums übergreifenden Ganglion
erfüllt, während das Weibchen nur eine schmächtige ganglionäre Einlagerung im Distalende
erkennen lässt. Ihm sitzen in grösseren Abständen drei zweizeilig bewimperte Spürfäden auf.
Die beiden Flagella sind sechsgliedrig und laufen in je zwei lange bewimperte Borsten aus; ausserdem
sitzen ähnliche kurze Wimperborsten den Gliedenden auf. Bei dem Weibchen treten am
Basalgliede des unteren Flagellums einige (etwa vier) Spürfäden auf, während es an derselben
Stelle bei dem Männchen kolbig aufgetrieben und mit einem dichten Pelz von Sinneshaaren
besetzt ist.
Die zweiten Antennen (at") sind durch ein kräftiges, mit mehreren Muskelgruppen ausgestattetes
Basalglied charakterisirt (Fig. 2, I), welches an den Ansatzstellen des letzteren aufgetrieben
ist und mit seinem distalen Innenrand sich über die Insertionsstelle des zweiten Gliedes
vorwölbt, während der Aussenrand in einen kurzen Dorn ausläuft. Die schwertförmig gestaltete
Schuppe ist sanft geschwungen und in der Mitte nur wenig breiter als an den Enden. Ihr
Breitenindex verhält sich zur Länge wie 1 : 7. Der Innenrand ist mit dichten und langen Borsten