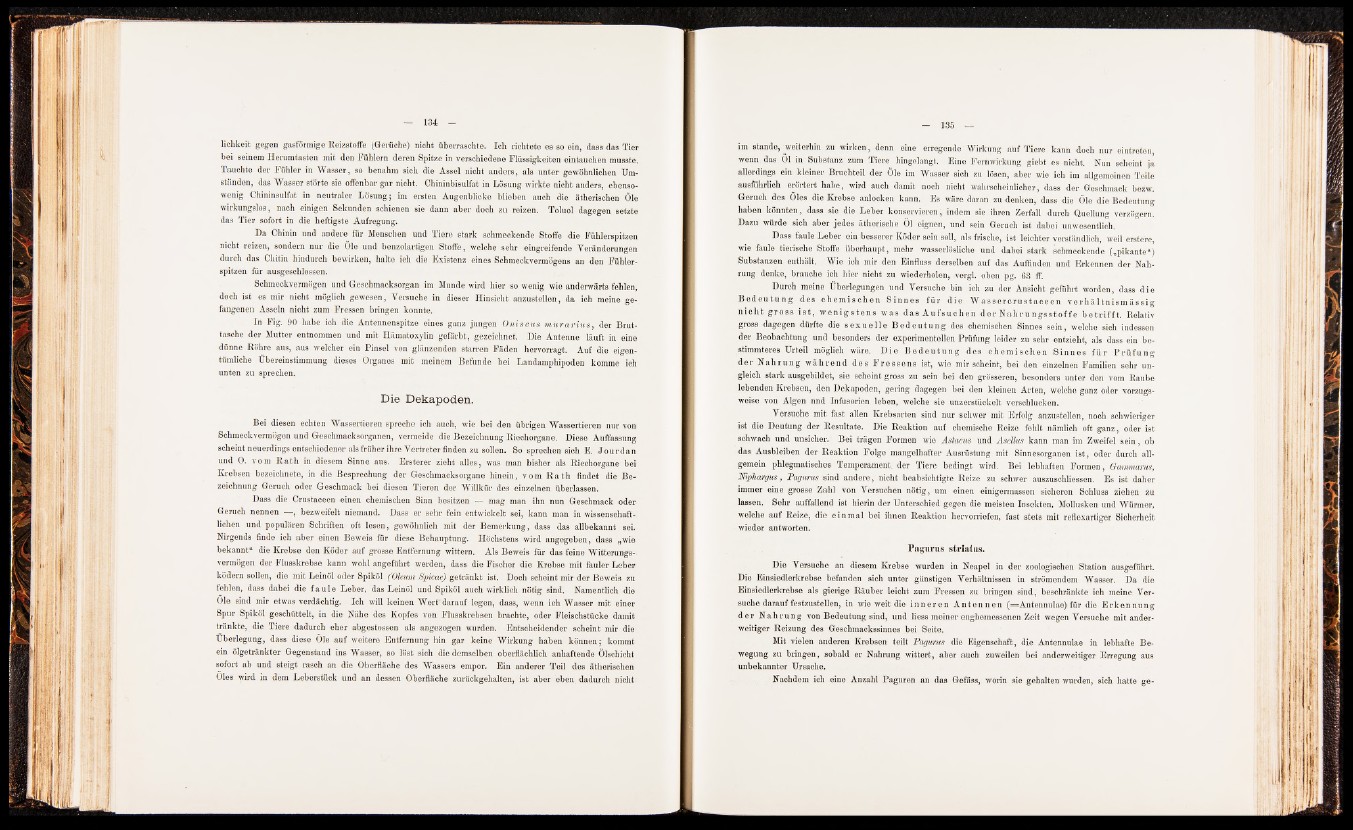
lichkeit gegen gasförmige Reizstoffe (Gerüche) nicht überraschte. Ich richtete es so ein, dass das Tier
bei seinem Herumtasten mit den Fühlern deren Spitze in verschiedene Flüssigkeiten eintauchen musste.
Tauchte der Fühler in Wasser, so benahm sich die Assel nicht anders, als unter gewöhnlichen Umständen,
das Wasser störte sie offenbar gar nicht. Chininbisulfat in Lösung wirkte nicht anders, ebenso-
wenig Chininsulfat in neutraler Lösung; im ersten Augenblicke blieben auch die ätherischen Öle
wirkungslos, nach einigen Sekunden schienen sie dann aber doch zu reizen. Toluol dagegen setzte
das Tier sofort in die heftigste Aufregung.
Da Chinin und andere für Menschen und Tiere stark schmeckende Stoffe die Fühlerspitzen
nicht reizen, sondern nur die Öle und benzolartigen Stoffe, welche sehr eingreifende Veränderungen
durch das Chitin hindurch bewirken, halte ich die Existenz eines Schmeckvermögens an den Fühlerspitzen
für ausgeschlossen.
Schmeckvermögen und Geschmacksorgan im Munde wird hier so wenig wie anderwärts fehlen,
doch ist es mir nicht möglich gewesen, Versuche in dieser Hinsicht anzustellen, da ich meine gefangenen
Asseln nicht zum Fressen bringen konnte.
In Fig. 90 habe ich die Antennenspitze eines ganz jungen Oniscus m ü r a r iu s , der Bruttasche
der Mutter entnommen und mit Hämatoxylin gefärbt, gezeichnet. Die Antenne läuft in eine
dünne Röhre aus, aus welcher ein Pinsel von glänzenden starren Fäden hervorragt. Auf die eigentümliche
Übereinstimmung dieses Organes mit meinem Befunde bei Landamphipoden komme ich
unten zu sprechen.
Die D ekapoden.
Bei diesen echten Wassertieren spreche ich auch, wie bei den übrigen Wassertieren nur von
Schmeckvermögen und Geschmacksorganen, vermeide die Bezeichnung Riechorgane. Diese Auffassung
scheint neuerdings entschiedener als früher ihre Vertreter finden zu sollen. So sprechen sich E. Jourdan
und 0. vom Ra th in diesem Sinne aus. Ersterer zieht alles, was man bisher als Riechorgane bei
Krebsen bezeichnete, in die Besprechung der Geschmacksorgane hinein, vom R a th findet die Bezeichnung
Geruch oder Geschmack bei diesen Tieren der Willkür des einzelnen überlassen.
Dass die Crustaceen einen chemischen Sinn besitzen — mag man ihn nun Geschmack oder-
Geruch nennen —, bezweifelt niemand. Dass er sehr fein entwickelt sei, kann man in wissenschaftlichen
und populären Schriften oft lesen, gewöhnlich mit der Bemerkung, dass das allbekannt sei.
Nirgends finde ich aber einen Beweis für diese Behauptung. Höchstens wird angegeben, dass »wie
bekannt“ die Krebse den Köder auf grosse Entfernung wittern. Als Beweis für das feine Witterungsvermögen
der Flusskrebse kann wohl angeführt werden, dass die Fischer die Krebse mit fauler Leber
ködern sollen, die mit Leinöl oder Spiköl (Oleum Spicae) getränkt ist. Doch scheint mir der Beweis zu
fehlen, dass dabei die fau le Leber, das Leinöl und Spiköl auch wirklich nötig sind. Namentlich die
Oie sind mir etwas verdächtig. Ich will keinen Wert* darauf legen, dass, wenn ich Wasser mit einer
Spur Spiköl geschüttelt, in die Nähe des Kopfes von Flusskrebsen brachte, oder Fleischstücke damit
tränkte, die Tiere dadurch eher abgestossen als angezogen wurden. Entscheidender scheint mir die
Überlegung, dass diese Öle auf weitere Entfernung hin gar keine Wirkung haben können; kommt
ein ölgetränkter Gegenstand ins Wasser, so löst sich die demselben oberflächlich anhaftende Ölschicht
sofort ab und steigt rasch an die Oberfläche des Wassers empor. Ein anderer Teil des ätherischen
Öles wird in dem Leberstück und an dessen Oberfläche zurückgehalten, ist aber eben, dadurch nicht
im Stande, weiterhin zu wirken, denn eine erregende Wirkung auf Tiere kann doch nur eintreten,
wenn das 01 in Substanz zum Tiere hingelangt. Eine Fernwirkung giebt es nicht; Nun scheint ja
allerdings ein kleiner Bruchteil der Öle im Wasser sich zu lösen, aber wie ich im allgemeinen Teile
ausführlich erörtert habe, wird auch damit noch nicht wahrscheinlicher, dass der Geschmack bezw.
Geruch des Öles die Krebse anlocken kann. Es wäre daran zu denken, dass die Öle die Bedeutung
haben könnten, dass sie die Leber konservieren, indem sie ihren Zerfall durch Quellung verzögern.
Dazu würde sich aber jedes ätherische Öl eignen, und sein Geruch ist dabei unwesentlich.
Dass faule Leber ein besserer Köder sein soll, als frische, ist leichter verständlich, weil erstere,
wie faule tierische Stoffe überhaupt, mehr wasserlösliche und dabei stark schmeckende („pikante“)
Substanzen enthält. Wie ich mir den Einfluss derselben auf das Auffinden und Erkennen der Nahrung
denke, brauche ich hier nicht zu wiederholen, .vergl. oben pg. 63 ff.
Durch meine Überlegungen und Versuche bin ich zu der Ansicht geführt worden, dass die
B e d e u tu n g des ch em isch en Sinnes für die W a s s e rc ru s ta c e e n v e rh ä ltn ism ä s s ig
n ic h t gross is t, w e n ig s te n s was das A u fsu ch en d e r N a h ru n g s s to ffe b e tr iff t. Relativ
gross dagegen dürfte die se x u e lle B ed eu tu n g des chemischen Sinnes sein, welche sich indessen
der Beobachtung und besonders der experimentellen Prüfung leider zu sehr entzieht, als dass ein bestimmteres
Urteil möglich wäre. Die B e d e u tu n g des ch em isch en Sinnes fü r P rü fu n g
der Nah ru n g während des F re ss e n s ist, wie mir scheint, bei den einzelnen Familien sehr ungleich
stark ausgebildet, sie scheint gross zu sein bei den grösseren, besonders unter den vom Raube
lebenden Krebsen, den Dekapoden, gering dagegen bei den kleinen Arten, welche ganz oder vorzugsweise
von Algen nnd Infusorien leben, welche sie unzerstückelt verschlucken.
Versuche mit fast allen Krebsarten sind nur schwer mit Erfolg anzustellen, noch schwieriger
ist die Deutung der Resultate. Die Reaktion auf chemische Reize fehlt nämlich oft ganz, oder ist
schwach und unsicher. Bei trägen Formen wie Astacus und Asellus kann man im Zweifel sein, ob
das Ausbleiben der Reaktion Folge mangelhafter Ausrüstung mit Sinnesorganen ist, oder durch allgemein
phlegmatisches Temperament, der Tiere bedingt wird. Bei lebhaften Formen, Gammarus,
Niphargus, Pagurus sind andere, nicht beabsichtigte Reize zu schwer auszuschliessen. Es ist daher
immer eine grosse Zahl von Versuchen nötig, um einen einigermassen sicheren Schluss ziehen zu
lassen. Sehr auffallend ist hierin der Unterschied gegen die meisten Insekten, Mollusken und Würmer,
welche auf Reize, die einmal bei ihnen Reaktion hervorriefen, fast stets mit reflexartiger Sicherheit
wieder antworten.
Pagurus striatus.
Die Versuche an diesem Krebse wurden in Neapel in der zoologischen Station ausgeführt.
Die Einsiedlerkrebse befanden sich unter günstigen Verhältnissen in strömendem Wasser. Da die
Einsiedlerkrebse als gierige Räuber leicht zum Fressen zu bringen sind, beschränkte ich meine Versuche
darauf festzustellen, in wie weit die in n e re n A n ten n en (==Antennulae) für die Erkennung
d e r Nahrung von Bedeutung sind, und liess meiner engbemessenen Zeit wegen Versuche mit anderweitiger
Reizung des Geschmackssinnes bei Seite.
Mit vielen anderen Krebsen teilt Pagurus die Eigenschaft, die Antennulae in lebhafte Bewegung
zu bringen, sobald er Nahrung wittert, aber auch zuweilen bei anderweitiger Erregung aus
unbekannter Ursache.
Nachdem ich eine Anzahl Paguren an das Gefäss, worin sie gehalten wurden, sich hatte ge