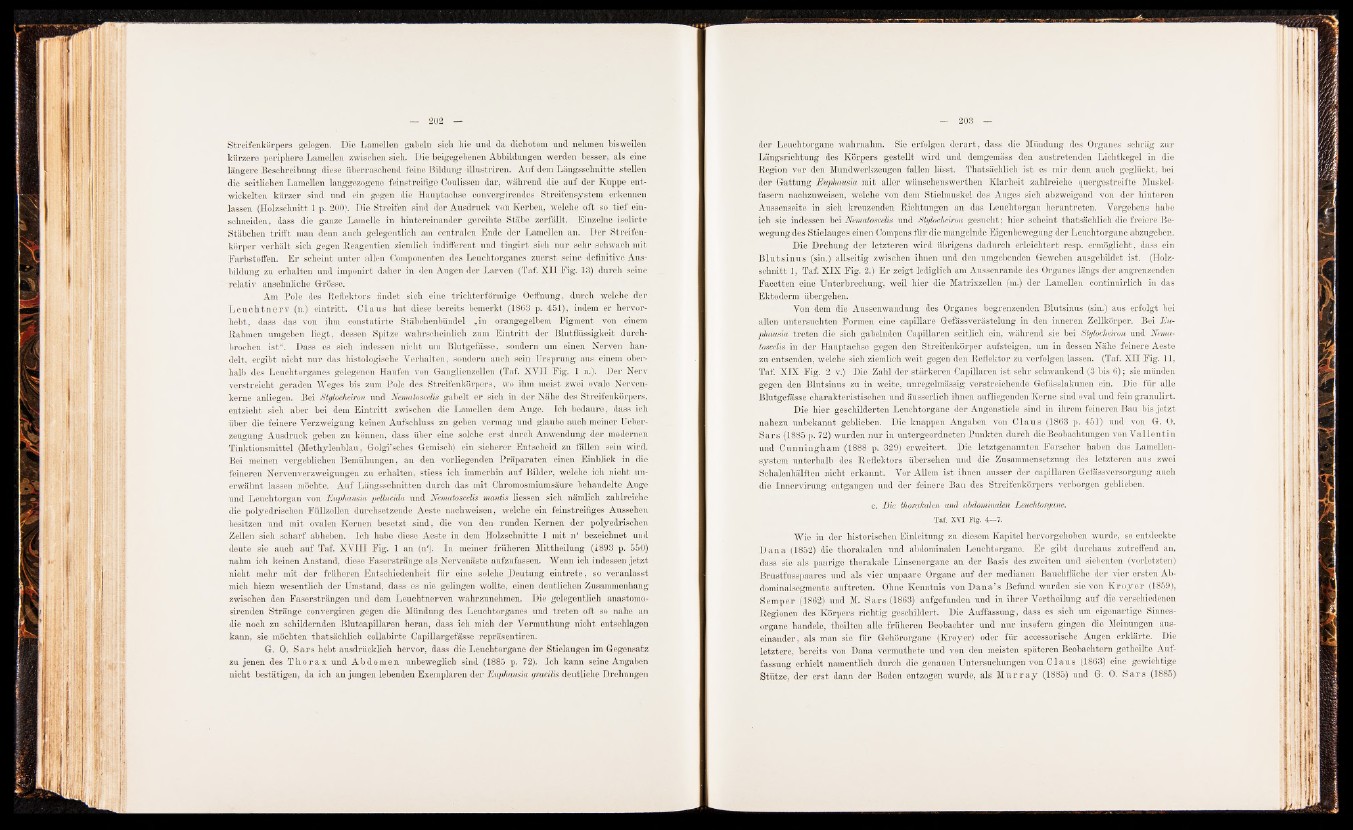
Streifenkörpers gelegen. Die Lamellen gabeln sich bie und da dichotom und nehmen bisweilen
kürzere periphere Lamellen zwischen sich. Die beigegebenen Abbildungen werden besser, als eine
längere Beschreibung diese überraschend feine Bildung dllustriren. Auf dem Längsschnitte stellen
die seitlichen Lamellen langgezogene feinstreifige Coulissen dar, während die auf der Kuppe entwickelten
kürzer sind und ein gegen die Hauptachse convergirendes Streifensystem erkennen
lassen (Holzschnitt 1 p. 200). Die Streifen sind der Ausdruck von Kerben, welche oft so tief einschneiden,
dass die ganze Lamelle in hintereinander gereihte Stäbe zerfällt. Einzelne isolirte
Stäbchen trifft man denn auch gelegentlich am centralen Ende der Lamellen an. Der Streifenkörper
verhält sich gegen Reagentien ziemlich indifferent und tingirt sich nur sehr schwach mit
Farbstoffen. Er scheint unter allen Componenten des Leuchtorganes zuerst seine definitive Ausbildung
zu erhalten und imponirt daher in den Augen der Larven (Taf. XII Fig. 13) durch seine
relativ ansehnliche Grösse.
Am Pole des Reflektors findet sich eine trichterförmige Oeffnung, durch welche der
L e u c h t n e rv (n.) eintritt. C la u s hat diese bereits bemerkt (1863 p. 451), indem er hervorhebt,
dass das von ihm eonstatirte Stäbchenbündel „in orangegelbem Pigment von einem
Rahmen umgeben liegt, dessen Spitze wahrscheinlich zum Eintritt der Blutflüssigkeit durchbrochen
ist“. Dass es sich indessen nicht um Blutgefässe, sondern um einen Nerven handelt,
ergibt nicht nur das histologische Verhalten, sondern auch sein Ursprung aus einem oberhalb
des Leuchtorganes gelegenen Haufen von Ganglienzellen (Taf. XVII Fig. 1 n.). Der Nerv
verstreicht geraden Weges bis zum Pole des Streifenkörpers, wo ihm meist zwei ovale Nervenkerne
anliegen. Bei Stylocheiron und Nematoscelis gabelt er sich in der Nähe des Streifenkörpers,
entzieht sich aber bei dem Eintritt zwischen die Lamellen dem Auge. Ich bedaure, dass ich
über die feinere Verzweigung keinen Aufschluss zu geben vermag und glaube auch meiner Ueber-
zeugung Ausdruck geben zu können, dass über eine solche erst durch Anwendung der modernen
Tinktionsmittel (Methylenblau, Golgi’sches Gemisch) ein sicherer Entscheid zu fällen sein wird.
Bei meinen vergeblichen Bemühungen, an den vorliegenden Präparaten einen Einblick in die
feineren Nervenverzweigungen zu erhalten, stiess ich immerhin auf Bilder, welche ich nicht unerwähnt
lassen möchte. Auf Längsschnitten durch das mit Chromosmiumsäure behandelte Auge
und Leuchtorgan von Euphausia pelluciäa und Nematoscelis mantis Hessen sich nänüich zahlreiche
die polyedrischen Füllzellen durchsetzende Aeste nachweisen, welche ein feinstreifiges Aussehen
besitzen und mit ovalen Kernen besetzt sind, die von den- runden Kernen der polyedrischen
Zellen sich scharf abheben. Ich habe diese Aeste in dem Holzschnitte 1 mit n' bezeichnet und
deute sie auch auf Taf. XVIH Fig. 1 an (n'). In meiner früheren Mittheilung (1893 p. 550)
nahm ich keinen Anstand, diese Faserstränge als Nervenäste aufzufassen. Wenn ich indessen jetzt
nicht mehr mit der früheren Entschiedenheit für eine solche ^Deutung eintrete, so veranlasst
mich hiezu wesentHch der Umstand, dass es nie geHngen wollte, einen deutlichen Zusammenhang
zwischen den Fasersträngen und dem Leuchtnerven wahrzunehmen. Die gelegentlich anastomo-
sirenden Stränge convergiren gegen die Mündung des Leuchtorganes und treten oft so nahe an
die noch zu schildernden Blutcapillaren heran, dass ich mich der Vermuthung nicht entschlagen
kann, sie möchten thatsächHch collabirte Capillargefässe repräsentiren.
G. 0. S a rs hebt ausdrücklich hervor, dass die Leuchtorgane der Stielaugen im Gegensatz
zu jenen des T h o r a x und Abdomen unbewegHch sind (1885 p. 72). Ich kann seine Angaben
nicht bestätigen, da ich an jungen lebenden Exemplaren der Euphausia gracilis deutliche Drehungen
der Leuchtorgane wahrnahm. Sie erfolgen derart, dass die Mündung des Organes schräg zur
Längsrichtung des Körpers gestellt wird und demgemäss den austretenden Lichtkegel in die
Region vor den Mundwerkzeugen fallen lässt. Thatsächlich ist es mir denn auch geglückt, bei
der Gattung Euphausia mit aller wiinschenswerthen Klarheit zahlreiche quergestreifte Muskelfasern
nachzuweisen, welche von dem Stielmuskel des Auges sich abzweigend von der hinteren
Aussenseite in sich kreuzenden Richtungen an das Leuchtorgan herantreten. Vergebens habe
ich sie indessen bei Nematoscelis und Stylocheiron gesucht; hier scheint thatsächlich die freiere Bewegung
des Stielauges einen Compens für die mangelnde Eigenbewegung der Leuchtorgane abzugeben.
Die Drehung der letzteren wird übrigens dadurch erleichtert resp. ermöglicht, dass ein
B lu ts in u s (sin.) allseitig zwischen ihnen und den umgebenden Geweben ausgebildet ist. (Holzschnitt
1, Taf. XTX Fig. 2.) Er zeigt lediglich am Aussenrande des Organes längs der angrenzenden
Facetten eine Unterbrechung, weil hier die Matrixzellen (m.) der Lamellen continuirHch in das
Ektoderm übergehen.
Von dem die Aussenwandung des Organes begrenzenden Blutsinus (sin.) aus erfolgt bei
allen untersuchten Formen eine capillare Gefässverästelung in den inneren Zellkörper. Bei Euphausia
treten die sich gabelnden Capillaren seitlich ein, während sie bei Stylocheiron und Nematoscelis
in der Hauptachse gegen den Streifenkörper aufsteigen, um in dessen Nähe feinere Aeste
zu entsenden, welche sich ziemlich weit gegen den Reflektor zu verfolgen lassen. (Taf. XII Fig. 11,
Taf. XIX Fig. 2 v.) Die Zahl der stärkeren Capillaren ist sehr schwankend (3 bis 6); sie münden
gegen den Blutsinus zu in weite, unregelmässig verstreichende Gefässlakunen ein. Die für alle
Blutgefässe charakteristischen und äusserlich ihnen aufHegenden Kerne sind oval und fein granuKrt.
Die hier geschilderten Leuchtorgane der Augenstiele sind in ihrem feineren Bau bis jetzt
nahezu unbekannt geblieben. Die knappen Angaben von C la u s (1863 p. 451) und von G. O.
Sa rs (1885 p. 72) wurden nur in untergeordneten Punkten durch die Beobachtungen von Vallen tin
und Cunningham (1888 p. 329) erweitert. Die letztgenannten Forscher haben das Lamellensystem
unterhalb des Reflektors übersehen und die Zusammensetzung des letzteren aus zwei
Schalenhälften nicht erkannt. Vor Allem ist ihnen ausser der capillaren GefässVersorgung auch
die Innervirung entgangen und der feinere Bau des Streifenkörpers verborgen geblieben.
c. Eie thorakalen unä abdominalen Leuchtorgane.
Taf. XYI Fig. 4—7.
Wie in der historischen Einleitung zu diesem Kapitel hervorgehoben wurde, so entdeckte
D an a (1852) die thorakalen und abdominalen Leuchtorgane. Er gibt durchaus zutreffend an,
dass sie als paarige thorakale Linsen organe an der Basis des zweiten und siebenten (vorletzten)
Brustfusspaares und als vier unpaare Organe auf der medianen Bauchfläche der vier ersten Abdominalsegmente
auftreten. Ohne Kenntnis von Dan a ’s Befund wurden sie von K ro y e r (1859),
Semper (1862) und M. S a rs (1863) aufgefunden und in ihrer Vertheilung auf die verschiedenen
Regionen des Körpers richtig geschildert. Die Auffassung, dass es sich um eigenartige Sinnesorgane
handele, theilten alle früheren Beobachter und mir insofern gingen die Meinungen auseinander,
als man sie für Gehörorgane (Kroyer) oder für accessorische Augen erklärte. Die
letztere, bereits von Dana vermuthete und von den meisten späteren Beobachtern getheilte Auffassung
erhielt namentKch durch die genauen Untersuchungen von C1 a u s (1863) eine gewichtige
Stütze, der erst dann der Böden entzogen wurde, als M u r r a y (1885) und G. 0. S a r s (1885)