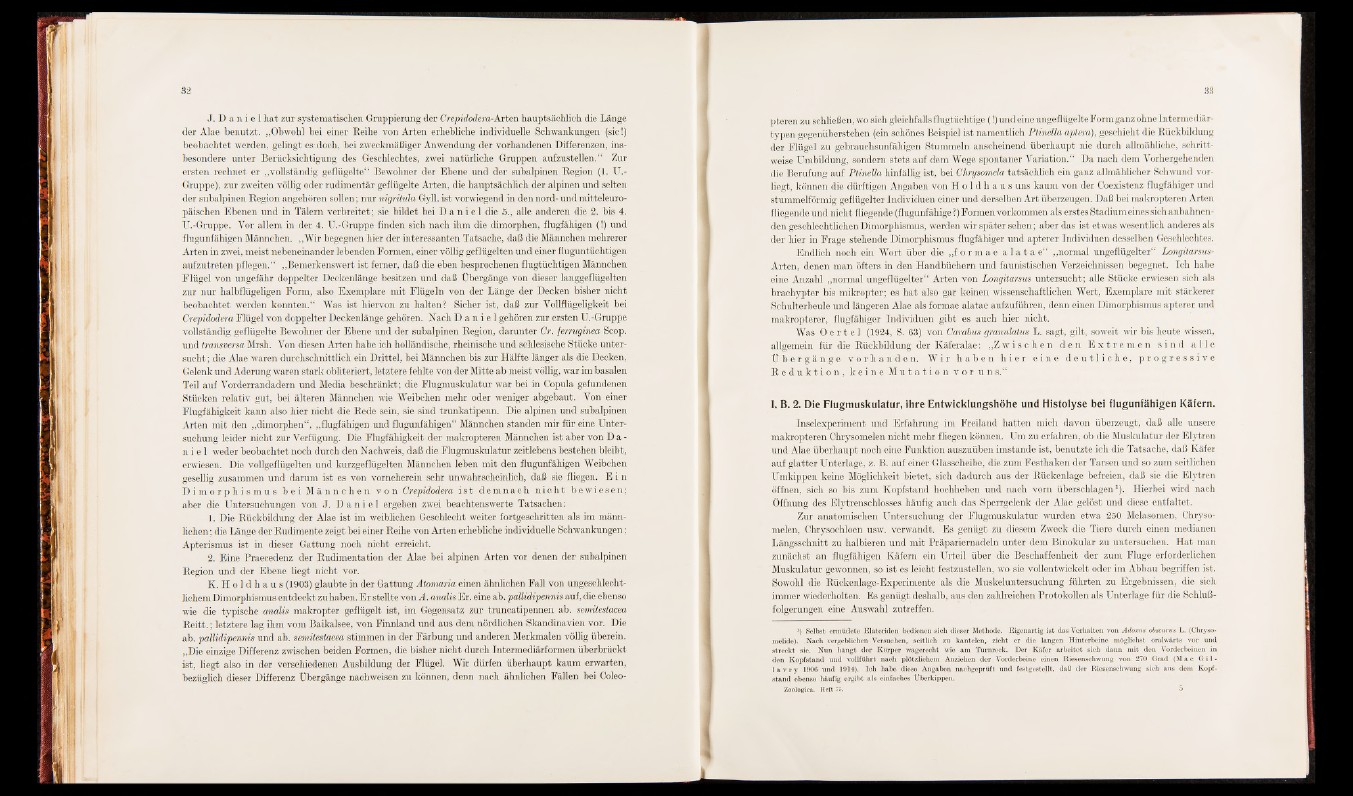
J. D a n i e 1 hat zur systematischen Gruppierung der Crepidodera-Arten hauptsächlich die Länge
der Alae benutzt. „Obwohl bei einer Reihe von Arten erhebliche individuelle Schwankungen (sic!)
beobachtet werden, gelingt es .doch, bei zweckmäßiger Anwendung der vorhandenen Differenzen, insbesondere
unter Berücksichtigung des Geschlechtes, zwei natürliche Gruppen aufzustellen.“ Zur
ersten rechnet er „vollständig geflügelte“ Bewohner der Ebene und der subalpinen Region (1. U.-
Gruppe), zur zweiten völlig oder rudimentär geflügelte Arten, die hauptsächlich der alpinen und selten
der subalpinen Region angehören sollen; nur nigritida Gyll. ist vorwiegend in dennord- und mitteleuropäischen
Ebenen und in Tälern verbreitet; sie bildet bei D a n i e l die 5., alle anderen die 2. bis 4.
U.-Gruppe. Vor allem in der 4. U.-Gruppe finden sich nach ihm die dimorphen, flugfähigen (!) und
flugunfähigen Männchen. „Wir begegnen hier der interessanten Tatsache, daß die Männchen mehrerer
Arten in zwei, meist nebeneinander lebenden Formen, einer völlig geflügelten und einer fluguntüchtigen
aufzutreten pflegen.“ „Bemerkenswert ist ferner, daß die eben besprochenen flugtüchtigen Männchen
Flügel von ungefähr doppelter Deckenlänge besitzen und daß "Übergänge von dieser langgeflügelten
zur nur halbflügeligen Form, also Exemplare mit Flügeln von der Länge der Decken bisher nicht
beobachtet werden konnten.“ Was ist hiervon zu halten? Sicher ist, daß zur Vollfiügeligkeit bei
Crepidodera Flügel von doppelter Deckenlänge gehören. Nach D a n i e l gehören zur ersten U.-Gruppe
vollständig geflügelte Bewohner der Ebene und der subalpinen Region, darunter Cr. ferruginea Scop.
und transversa Mrsh. Von diesen Arten habe ich holländische, rheinische und schlesische Stücke untersucht;
die Alae waren durchschnittlich ein Drittel, bei Männchen bis zur Hälfte länger als die Decken,
Gelenk und Äderung waren stark obliteriert, letztere fehlte von der Mitte ab meist völlig, war im basalen
Teil auf Vorderrandadern und Media beschränkt; die Flugmuskulatur war bei in Copula gefundenen
Stücken relativ gut, bei älteren Männchen wie Weibchen mehr oder weniger abgebaut. Von einer
Flugfähigkeit kann also hier nicht die Rede sein, sie sind trunkatipenn. Die alpinen und subalpinen
Arten mit den „dimorphen“, „flugfähigen und flugunfähigen“ Männchen standen mir für eine Untersuchung
leider nicht zur Verfügung. Die Flugfähigkeit der makropteren Männchen ist aber von D a n
i e l weder beobachtet noch durch den Nachweis, daß die Flugmuskulatur zeitlebens bestehen bleibt,
erwiesen. Die vollgeflügelten und kurzgeflügelten Männchen leben mit den flugunfähigen Weibchen
gesellig zusammen und darum ist es von vorneherein sehr unwahrscheinlich, daß sie fliegen. E i n
D i m o r p h i s m u s b e i M ä n n c h e n v o n Crepidodera i s t d e m n a c h n i c h t b ewi e s en;
aber die Untersuchungen von J. D a n i e l ergeben zwei beachtenswerte Tatsachen:
1. Die Rückbildung der Alae ist im weiblichen Geschlecht weiter fortgeschritten als im männlichen;
die Länge der Rudimente zeigt bei einer Reihe von Arten erhebliche individuelle Schwankungen;
Apterismus ist in dieser Gattung noch nicht erreicht.
2. Eine Praecedenz der Rudimentation der Alae bei alpinen Arten vor denen der subalpinen
Region und der Ebene liegt nicht vor.
K. H o l d h a u s (1903) glaubte in der Gattung Atomaria einen ähnlichen Fall von ungeschlechtlichem
Dimorphismus entdeckt zu haben. Er stellte von A. analis Er. eine ab. pallidipennis auf, die ebenso
wie die typische analis makropter geflügelt ist, im Gegensatz zur truncatipennen ab. semitestacea
R e itt.; letztere lag ihm vom Baikalsee, von Finnland und aus dem nördlichen Skandinavien vor. Die
ab. pallidipennis und ab. semitestacea stimmen in der Färbung und anderen Merkmalen völlig überein.
„Die einzige Differenz zwischen beiden Formen, die bisher nicht durch Intermediärformen überbrückt
ist, liegt also in der verschiedenen Ausbildung der Flügel. Wir dürfen überhaupt kaum erwarten,
bezüglich dieser Differenz Übergänge nachweisen zu können, denn nach ähnlichen Fällen bei Coleop
teren zu schließen, wo sich gleichfalls flugtüchtige (!) und eine ungeflügelte Form ganz ohne Intermediärtypen
gegenüberstehen (ein schönes Beispiel ist namentlich Ptinella aptera), geschieht die Rückbildung
der Flügel zu gebrauchsunfähigen Stummeln anscheinend überhaupt nie durch allmähliche, schrittweise
Umbildung, sondern stets auf dem Wege spontaner Variation.“ Da nach dem Vorhergehenden
die Berufung auf Ptinella hinfällig ist, bei Chrysomela tatsächlich ein ganz allmählicher Schwund vorhegt,
können die dürftigen Angaben von H o l d h a u s uns kaum von der Coexistenz flugfähiger und
stummelförmig geflügelter Individuen einer und derselben Art überzeugen. Daß bei makropteren Arten
fliegende und nicht fhegende (flugunfähige ?) Formen Vorkommen als erstes Stadium eines sich anbahnenden
geschlechtlichen Dimorphismus, werden wir später sehen; aber das ist etwas wesentlich anderes als
der hier in Frage stehende Dimorphismus flugfähiger und apterer Individuen desselben Geschlechtes.
Endlich noch ein Wort über die „ f o rm a e a 1 a t a e “ „normal ungeflügelter“ Longita/rsus-
Arten, denen man öfters in den Handbüchern und faunistischen Verzeichnissen begegnet. Ich habe
eine Anzahl „normal ungeflügelter“ Arten von Longitarsus untersucht; alle Stücke erwiesen sich als
brachypter bis mikropter; es hat also gar keinen wissenschaftlichen Wert, Exemplare mit stärkerer
Schulterbeule und längeren Alae als formae alatae aufzuführen, denn einen Dimorphismus apterer und
makropterer, flugfähiger Individuen gibt es auch hier nicht.
Was 0 e r t e 1 (1924, S. 63) von Cardbus granulatus L. sagt, gilt, soweit wir bis heute wissen,
allgemein für die Rückbildung der Käferalae: „ Z w i s c h e n d e n E x t r e m e n s i n d a l l e
Ü b e r g ä n g e v o r h a n d e n . Wi r h a b e n h i e r e i n e d e u t l i c h e , p r o g r e s s i v e
R e d u k t i o n , k e i n e M u t a t i o n v o r u n s . “
1, B. 2. Die Flugmuskulatur, ihre Entwicklungshöhe und Histolyse bei flugunfähigen Käfern.
Inselexperiment und Erfahrung im Freiland hatten mich davon überzeugt, daß alle unsere
makropteren Chrysomelen nicht mehr fliegen können. Um zu erfahren, ob die Muskulatur der Elytren
und Alae überhaupt noch eine Funktion auszuüben imstande ist, benutzte ich die Tatsache, daß Käfer
auf glatter Unterlage, z. B. auf einer Glasscheibe, die zum Festhaken der Tarsen und so zum seitlichen
Umkippen keine Möglichkeit bietet, sich dadurch aus der Rückenlage befreien, daß sie die Elytren
öffnen, sich so bis zum Kopfstand hochheben und nach vorn überschlagen1). Hierbei wird nach
Öffnung des Elytrenschlosses häufig auch das Sperrgelenk der Alae gelöst und diese entfaltet.
Zur anatomischen Untersuchung der Flugmuskulatur wurden etwa 250 Melasomen, Chrysomelen,
Chrysochloen usw. verwandt. Es genügt zu diesem Zweck die Tiere durch einen medianen
Längsschnitt zu halbieren und mit Präpariernadeln unter dem Binokular zu untersuchen. Hat man
zunächst an flugfähigen Käfern ein Urteil über die Beschaffenheit der zum Fluge erforderlichen
Muskulatur gewonnen, so ist es leicht festzustellen, wo sie vollentwickelt oder im Abbau begriffen ist.
Sowohl die Rückenlage-Experimente als die Muskeluntersuchung führten zu Ergebnissen, die sich
immer wiederholten. Es genügt deshalb, aus den zahlreichen Protokollen als Unterlage für die Schlußfolgerungen
eine Auswahl zutreffen.
i) Selbst ermüdete Elateriden bedienen sieb dieser Methode. Eigenartig ist das Verhalten von Adozus öbscicrus L. (Chryso-
melide). .Nach vergeblichen Versuchen, seitlich zu kantelen, zieht er die langen Hinterbeine möglichst oralwärts vor und
streckt sie. Nun hängt der Körper wagerecht wie am Turnreck. Der Käfer arbeitet sich dann mit den Vorderbeinen in
den Kopfstand und vollführt nach plötzlichem Anziehen der Vorderbeine einen Riesenschwung von. 2.70 Grad (Mac G i 1 -
1 a v r y 1906 und 1914). Ich habe diese Angaben nachgeprüft und festgestellt, daß der Riesenschwung sich aus dem Kopf-
stand ebenso häufig ergibt als einfaches Überkippen.
Zoologien. Heft 75. 5