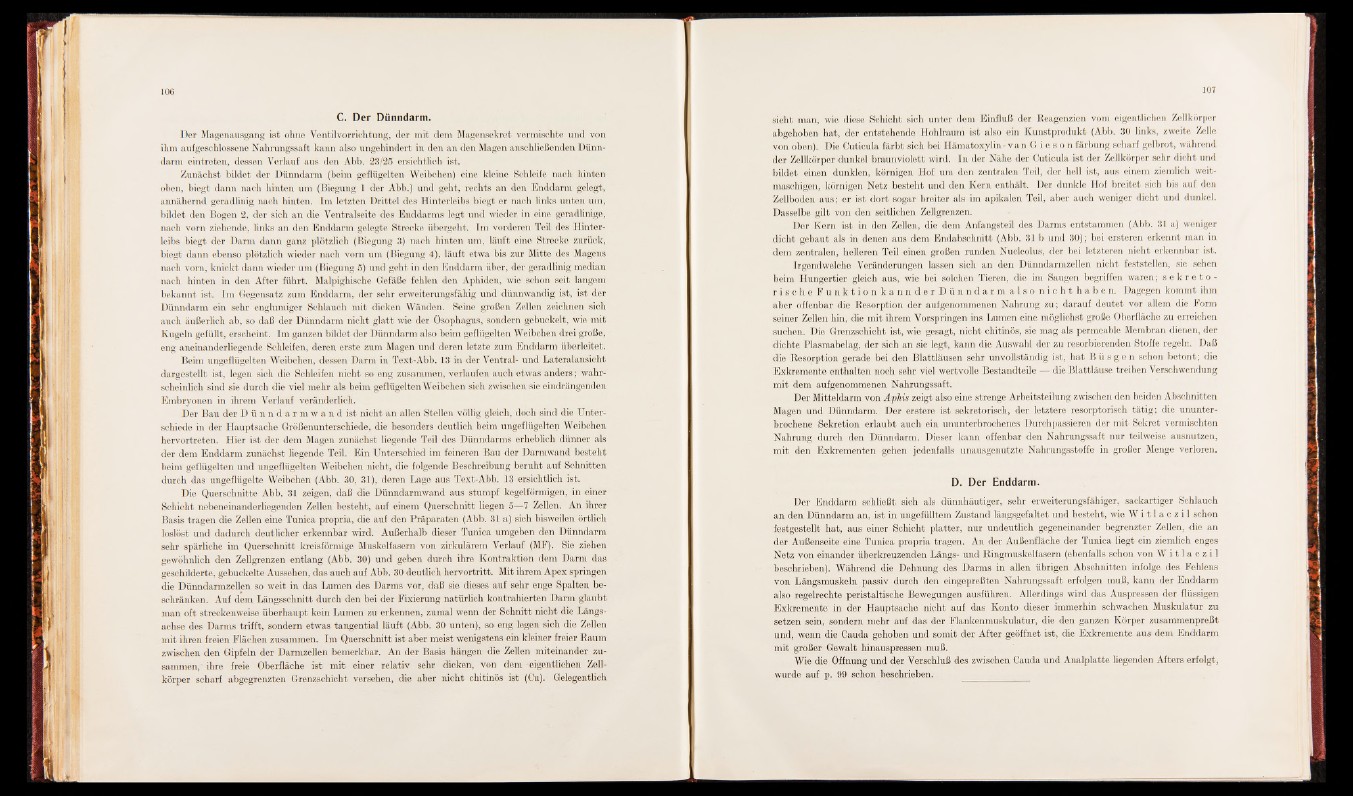
C. Der Dünndarm.
Der Magenausgang ist ohne Ventil Vorrichtung, der mit dem Magensekret vermischte und von
ihm aufgeschlossene Nahrungssaft kann also ungehindert in den an den Magen anschließenden Dünndarm
eintreten, dessen Verlauf aus den Abb. 23/25 ersichtlich ist.
Zunächst bildet der Dünndarm (beim geflügelten Weibchen) eine kleine Schleife nach hinten
oben, biegt dann nach hinten um (Biegung 1 der Abb.) und geht, rechts an den Enddarm gelegt,
annähernd geradlinig nach hinten. Im letzten Drittel des Hinterleibs biegt er nach links unten um,
bildet den Bogen 2, der sich an die Ventralseite des Enddarms legt und wieder in eine geradlinige,
nach vorn ziehende, links an den Enddarm gelegte Strecke übergeht. Im vorderen Teil des Hinterleibs
biegt der Darm dann ganz plötzlich (Biegung 3) nach hinten um, läuft eine Strecke zurück,
biegt dann ebenso plötzlich wieder nach vorn um (Biegung 4), läuft etwa bis zur Mitte des Magens
nach vorn, knickt dann wieder um (Biegung 5) und geht in den Enddarm über, der geradlinig median
nach hinten in den After führt. Malpighische Gefäße fehlen den Aphiden, wie schon seit langem
bekannt ist. Im Gegensatz zum Enddarm, der sehr erweiterungsfähig und dünnwandig ist, ist der
Dünndarm ein sehr englumiger Schlauch mit dicken Wänden. Seine großen Zellen zeichnen sich
auch äußerlich ab, so daß der Dünndarm nicht glatt wie der Ösophagus, sondern gebuckelt, wie mit
Kugeln gefüllt, erscheint. Im ganzen bildet der Dünndarm also beim geflügelten Weibchen drei große,
eng aneinanderliegende Schleifen, deren erste zum Magen und deren letzte zum Enddarm überleitet.
Beim ungeflügelten Weibchen, dessen Darm in Text-Abb. 13 in der Ventral- und Lateralansicht
dargestellt ist, legen sich die Schleifen nicht so eng zusammen, verlaufen auch etwas anders; wahrscheinlich
sind sie durch die viel mehr als beim geflügelten Weibchen sich zwischen sie eindrängenden
Embryonen in ihrem Verlauf veränderlich.
Der Bau der D ü n n d a r m w a n d ist nicht an allen Stellen völlig gleich, doch sind die Unterschiede
in der Hauptsache Größenunterschiede, die besonders deutlich beim ungeflügelten Weibchen
hervortreten. Hier ist der dem Magen zunächst liegende Teil des Dünndarms erheblich dünner als
der dem Enddarm zunächst liegende Teil. Ein Unterschied im feineren Bau der Darmwand besteht
beim geflügelten und ungeflügelten Weibchen nicht, die folgende Beschreibung beruht auf Schnitten
durch das ungeflügelte Weibchen (Abb. 30, 31), deren Lage aus Text-Abb. 13 ersichtlich ist.
Die Querschnitte Abb. 31 zeigen, daß die Dünndarmwand aus stumpf kegelförmigen, in einer
Schicht nebeneinanderliegenden Zellen besteht, auf einem Querschnitt liegen 5—7 Zellen. An ihrer
Basis tragen die Zellen eine Tunica propria, die auf den Präparaten (Abb. 31 a) sich bisweilen örtlich
loslöst und dadurch deutlicher erkennbar wird. Außerhalb dieser Tunica umgeben den Dünndarm
sehr spärliche im Querschnitt kreisförmige Muskelfasern von zirkulärem Verlauf (MF). Sie ziehen
gewöhnlich den Zellgrenzen entlang (Abb. 30) und geben durch ihre Kontraktion dem Darm das
geschilderte, gebuckelte Aussehen, das auch auf Abb. 30 deutlich hervortritt. Mit ihrem Apex springen
die Dünndarmzellen so weit in das Lumen des Darms vor, daß sie dieses auf sehr enge Spalten beschränken.
Auf dem Längsschnitt durch den bei der Fixierung natürlich kontrahierten Darm glaubt
man oft streckenweise überhaupt kein Lumen zu erkennen, zumal wenn der Schnitt nicht die Längsachse
des Darms trifft, sondern etwas tangential läuft (Abb. 30 unten), so eng legen sich die Zellen
mit ihren freien Flächen zusammen. Im Querschnitt ist aber meist wenigstens ein kleiner freier Raum
zwischen den Gipfeln der Darmzellen bemerkbar. An der Basis hängen die Zellen miteinander zusammen,
ihre freie Oberfläche ist mit einer relativ sehr dicken, von dem eigentlichen Zellkörper
scharf abgegrenzten Grenzschicht versehen, die aber nicht chitinös ist (Cu). Gelegentlich
sieht man, wie diese Schicht sich unter dem Einfluß der Reagenzien vom eigentlichen Zellkörper
abgehoben hat, der entstehende Hohlraum ist also ein Kunstprodukt (Abb. 30 links, zweite Zelle
von oben). Die Cuticula färbt sich bei Hämatoxylin-van G i e s o n färbung scharf gelbrot, während
der Zellkörper dunkel braunviolett wird. In der Nähe der Cuticula ist der Zellkörper sehr dicht und
bildet einen dunklen, körnigen Hof um den zentralen Teil, der hell ist, aus einem ziemlich weitmaschigen,
körnigen Netz besteht und den Kern enthält. Der dunkle Hof breitet sich bis auf den
Zellboden aus; er ist dort sogar breiter als im apikalen Teil, aber auch weniger dicht und dunkel.
Dasselbe gilt von den seitlichen Zellgrenzen.
Der Kern ist in den Zellen, die dem Anfangsteil des Darms entstammen (Abb. 31 a) weniger
dicht gebaut, als in denen aus dem Endabschnitt (Abb. 31 b und 30); bei ersteren erkennt man in
dem zentralen, helleren Teil einen großen runden Nucleolus, der bei letzteren nicht erkennbar ist.
Irgendwelche Veränderungen lassen sich an den Dünndarmzellen nicht feststellen, sie sehen
beim Hungertier gleich aus, wie bei solchen Tieren, die im Saugen begriffen waren; s e k r e t o r
i s c h e F u n k t i o n k a n n d e r D ü n n d a r m a l s o n i c h t h a b e n . Dagegen kommt ihm
aber offenbar die Resorption der aufgenommenen Nahrung zu; darauf deutet vor allem die Form
seiner Zellen hin, die mit ihrem Vorspringen ins Lumen eine möglichst große Oberfläche zu erreichen
suchen. Die Grenzschicht ist, wie gesagt, nicht chitinös, sie mag als permeable Membran dienen, der
dichte Plasmabelag, der sich an sie legt, kann die Auswahl der zu resorbierenden Stoffe regeln. Daß
die Resorption gerade bei den Blattläusen sehr unvollständig ist, hat B ü s g e n schon betont; die
Exkremente enthalten noch sehr viel wertvolle Bestandteile — die Blattläuse treiben Verschwendung
mit dem auf genommenen Nahrungssaft.
Der Mitteldarm von Aphis zeigt also eine strenge Arbeitsteilung zwischen den beiden Abschnitten
Magen und Dünndarm. Der erstere ist sekretorisch, der letztere resorptorisch tätig; die ununterbrochene
Sekretion erlaubt auch ein ununterbrochenes Durchpassieren der mit Sekret vermischten
Nahrung durch den Dünndarm. Dieser kann offenbar den Nahrungssaft nur teilweise ausnutzen,
mit den Exkrementen gehen jedenfalls unausgenutzte Nahrungsstoffe in großer Menge verloren.
D. Der Enddarm.
Der Enddarm schließt sich als dünnhäutiger, sehr erweiterungsfähiger, sackartiger Schlauch
an den Dünndarm an, ist in ungefülltem Zustand längsgefaltet und besteht, wie W i t l a c z i l schon
festgestellt hat, aus einer Schicht platter, nur undeutlich gegeneinander begrenzter Zellen, -die an
der Außenseite eine Tunica propria tragen. An der Außenfläche der Tunica liegt ein ziemlich enges
Netz von einander überkreuzenden Längs- und Ringmuskelfasern (ebenfalls schon von W i t l a c z i l
beschrieben). Während die Dehnung des Darms in allen übrigen Abschnitten infolge des Fehlens
von Längsmuskeln passiv durch den eingepreßten Nahrungssaft erfolgen muß, kann der Enddarm
also regelrechte peristaltische Bewegungen ausführen. Allerdings wird das Auspressen der flüssigen
Exkremente' in der Hauptsache nicht auf das Konto dieser immerhin schwachen Muskulatur zu
setzen sein, sondern mehr auf das der Flankenmuskulatur, die den ganzen Körper zusammenpreßt
und, wenn die Cauda gehoben und somit der After geöffnet ist, die Exkremente aus dem Enddarm
mit größer Gewalt hinauspressen muß.
Wie die Öffnung und der Verschluß des zwischen Cauda und Analplatte liegenden Afters erfolgt,
wurde auf p. 99 schon beschrieben.