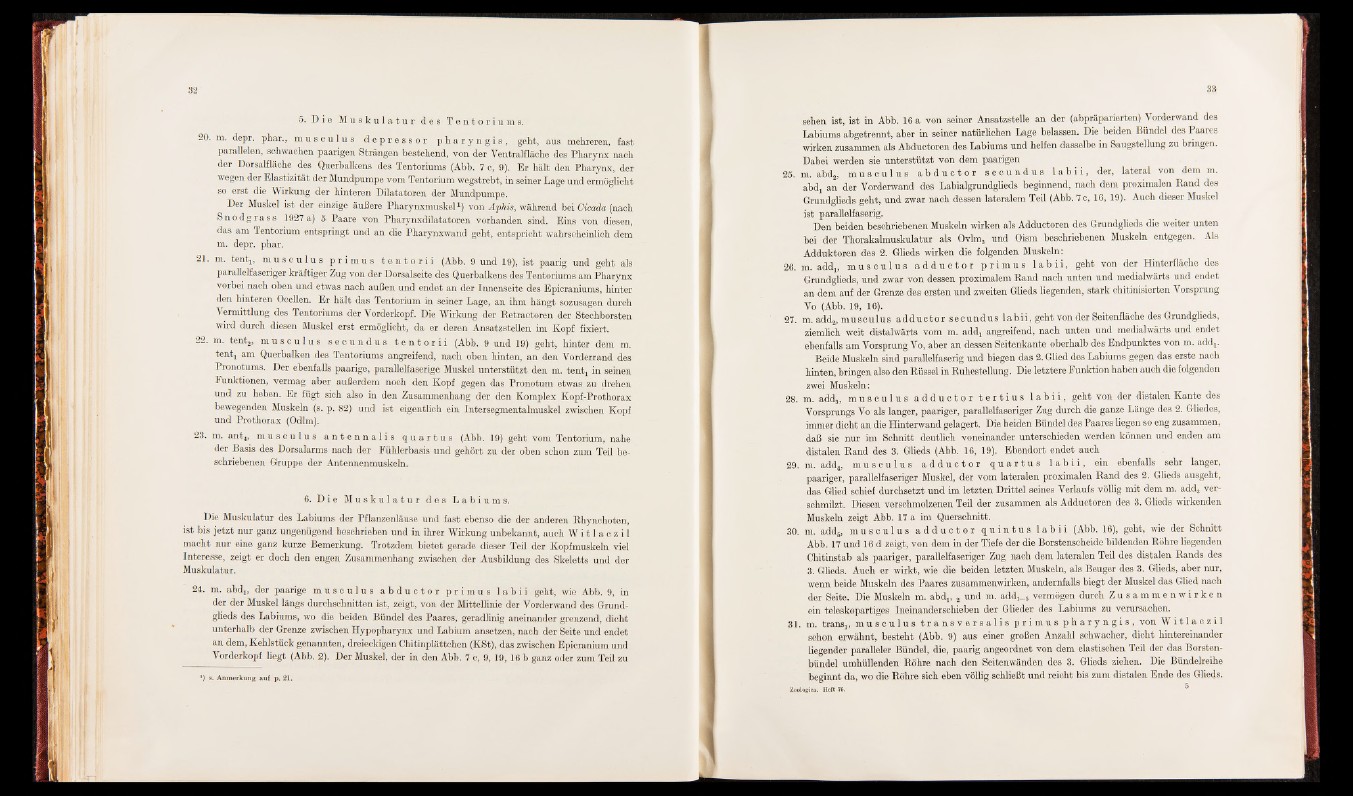
5. D i e M u s k u l a t u r d e s T e n t o r i u m s .
20. m. depr. phar., m u s c u l u s d e p r e s s o r p h a r y n g i s , geht, aus mehreren, fast
parallelen, schwachen paarigen Strängen bestehend, von der Yentralfläche des Pharynx nach
der Dorsalfläche des Querbalkens des Tentoriums (Abb. 7 c, 9). Er hält den Pharynx, der
wegen der Elastizität der Mundpumpe vom Tentorium wegstrebt, in seiner Lage und ermöglicht
so erst die Wirkung der hinteren Dilatatoren der Mundpumpe.
Der Muskel ist der einzige äußere Pharynxmuskel1) von Aphis, während bei Cicada (nach
S n o d g r a s s 1927 a) 5 Paare von Pharynxdilatatoren vorhanden sind. Eins von diesen,
das am Tentorium entspringt und an die Pharynxwand geht, entspricht wahrscheinlich dem
m. depr. phar.
21. m. tentj, m u s c u l u s p r i m u s t e n t o r i i (Abb. 9 und 19), ist paarig und geht als
parallelfaseriger kräftiger Zug von der Dorsalseite des Querbalkens des Tentoriums am Pharynx
vorbei nach oben und etwas nach außen und endet an der Innenseite des Epicraniums, hinter
den hinteren Ocellen. Er hält das Tentorium in seiner Lage, an ihm hängt sozusagen durch
Vermittlung des Tentoriums der Vorderkopf. Die Wirkung der Retractoren der Stechborsten
wird durch diesen Muskel erst ermöglicht, da er deren Ansatzstellen im Kopf fixiert.
22. m. tent2, m u s c u l u s s e c u n d u s t e n t o r i i (Abb. 9 und 19) geht, hinter dem m.
tentj am Querbalken des Tentoriums angreifend, nach oben hinten, an den Vorderrand des
Pronotums. Der ebenfalls paarige, parallelfaserige Muskel unterstützt den m. tent4 in seinen
Funktionen, vermag aber außerdem noch den Kopf gegen das Pronotum etwas zu drehen
und zu heben. Er fügt sich also in den Zusammenhang der den Komplex Kopf-Prothorax
bewegenden Muskeln (s. p. 82) und ist eigentlich ein Intersegmentalmuskel zwischen Kopf
und Prothorax (Odlm).
23. m. an t4, m u s c u l u s a n t e n n a l i s q u a r t u s (Abb. 19) geht vom Tentorium, nahe
der Basis des Dorsalarms nach der Fühlerbasis und gehört zu der oben schon zum Teil beschriebenen
Gruppe der Antennenmuskeln.
6. D i e M u s k u l a t u r d e s L a b i u m s .
Die Muskulatur des Labiums der Pflanzenläuse und fast ebenso die der anderen Rhynchoten,
ist bis jetzt nur ganz ungenügend beschrieben und in ihrer Wirkung unbekannt, auch W i t l a c z i l
macht nur eine ganz kurze Bemerkung. Trotzdem bietet gerade dieser Teil der Kopfmuskeln viel
Interesse, zeigt er doch den engen Zusammenhang zwischen der Ausbildung des Skeletts und der
Muskulatur.
24. m. abdj, der paarige m u s c u l u s a b d u c t o r p r i m u s l a b i i geht, wie Abb. 9, in
der der Muskel längs durchschnitten ist, zeigt, von der Mittellinie der Vorderwand des Grundglieds
des Labiums, wo die beiden Bündel des Paares, geradlinig aneinander grenzend, dicht
unterhalb der Grenze zwischen Hypopharynx und Labium ansetzen, nach der Seite und endet
an dem, Kehlstück genannten, dreieckigen Chitinplättchen (KSt), das zwischen Epicranium und
Vorderkopf liegt (Abb. 2). Der Muskel, der in den Abb. 7 c, 9, 19, 16 b ganz oder zum Teil zu
sehen ist, ist in Abb. 16 a von seiner Ansatzstelle an der (abpräparierten) Vorderwand des
Labiums abgetrennt, aber in seiner natürlichen Lage belassen. Die beiden Bündel des Paares
wirken zusammen als Abductoren des Labiums und helfen dasselbe in Saugstellung zu bringen.
Dabei werden sie unterstützt von dem paarigen
25. m. abd2, m u s c u l u s a b d u c t o r s e c u n d u s l a b i i , der, lateral von dem m.
abdx an der Vorderwand des Labialgrundglieds beginnend, nach dem proximalen Rand des
Grundglieds geht, und zwar nach dessen lateralem Teil (Abb. 7 c, 16, 19). Auch dieser Muskel
ist parallelfaserig.
Den beiden beschriebenen Muskeln wirken als Adductoren des Grundglieds die weiter unten
bei der Thorakalmuskulatur als Ovlm3 und Oism beschriebenen Muskeln entgegen. Als
Adduktoren des 2. Glieds wirken die folgenden Muskeln:
26. m. addx, m u s c u l u s a d d u c t o r p r i m u s l a b i i , geht von der Hinterfläche des
Grundglieds, und zwar von dessen proximalem Rand nach unten und medialwärts und endet
an dem auf der Grenze des ersten und zweiten Glieds liegenden, stark chitinisierten Vorsprung
Vo (Abb. 19, 16).
27. m. add2, m u s c u lu s a d d u c t o r s e cundus labi i , geht von der Seitenfläche des Grundglieds,
ziemlich weit distalwärts vom m. add4 angreifend, nach unten und medialwärts und endet
ebenfalls am Vorsprung Vo, aber an dessen Seitenkante oberhalb des Endpunktes von m. add4.
Beide Muskeln sind parallelfaserig und biegen das 2. Glied des Labiums gegen das erste nach
hinten, bringen also den Rüssel in Ruhestellung. Die letztere Funktion haben auch die folgenden
zwei Muskeln:
28. m. add3, m u s c u l u s a d d u c t o r t e r t i u s l a b i i , geht von der distalen Kante des
Vorsprungs Vo als langer, paariger, parallelfaseriger Zug durch die ganze Länge des 2. Gliedes,
immer dicht an die Hinterwand gelagert. Die beiden Bündel des Paares liegen so eng zusammen,
daß sie nur im Schnitt deutlich voneinander unterschieden werden können und enden am
distalen Rand des 3. Glieds (Abb. 16, 19). Ebendort endet auch
29. m. add4, m u s c u l u s a d d u c t o r q u a r t u s l a b i i , ein ebenfalls sehr langer,
paariger, parallelfaseriger Muskel, der vom lateralen proximalen Rand des 2. Glieds ausgeht,
das Glied schief durchsetzt und im letzten Drittel seines Verlaufs völlig mit dem m. add3 verschmilzt.
Diesen verschmolzenen Teil der zusammen als Adductoren des 3. Glieds wirkenden
Muskeln zeigt Abb. 17 a im Querschnitt.
30. m. add5, m u s c u l u s a d d u c t o r q u i n t u s l a b i i (Abb. 16), geht, wie der Schnitt
Abb. 17 und 16 d zeigt, von dem in der Tiefe der die Borstenscheide bildenden Röhre liegenden
Chitinstab als paariger, parallelfaseriger Zug nach dem lateralen Teil des distalen Rands des
3. Glieds. Auch er wirkt, wie die beiden letzten Muskeln, als Beuger des 3. Glieds, aber nur,
wenn beide Muskeln des Paares Zusammenwirken, andernfalls biegt der Muskel das Glied nach
der Seite. Die Muskeln m. abdl3 2 und m. addx_ 5 vermögen durch Z u s a m m e n w i r k e n
ein teleskopartiges Ineinanderschieben der Glieder des Labiums zu verursachen.
31. m. transj, m u s c u l u s t r a n s v e r s a l i s p r i m u s p h a r y n g i s , von W i t l a c z i l
schon erwähnt, besteht (Abb. 9) aus einer großen Anzahl schwacher, dicht hintereinander
liegender paralleler Bündel, die, paarig angeordnet von dem elastischen Teil der das Borstenbündel
umhüllenden Röhre nach den Seitenwänden des 3. Glieds ziehen. Die Bündelreihe
beginnt da, wo die Röhre sich eben völlig schließt und reicht bis zum distalen Ende des Glieds.
Zoologica. Heft 76.