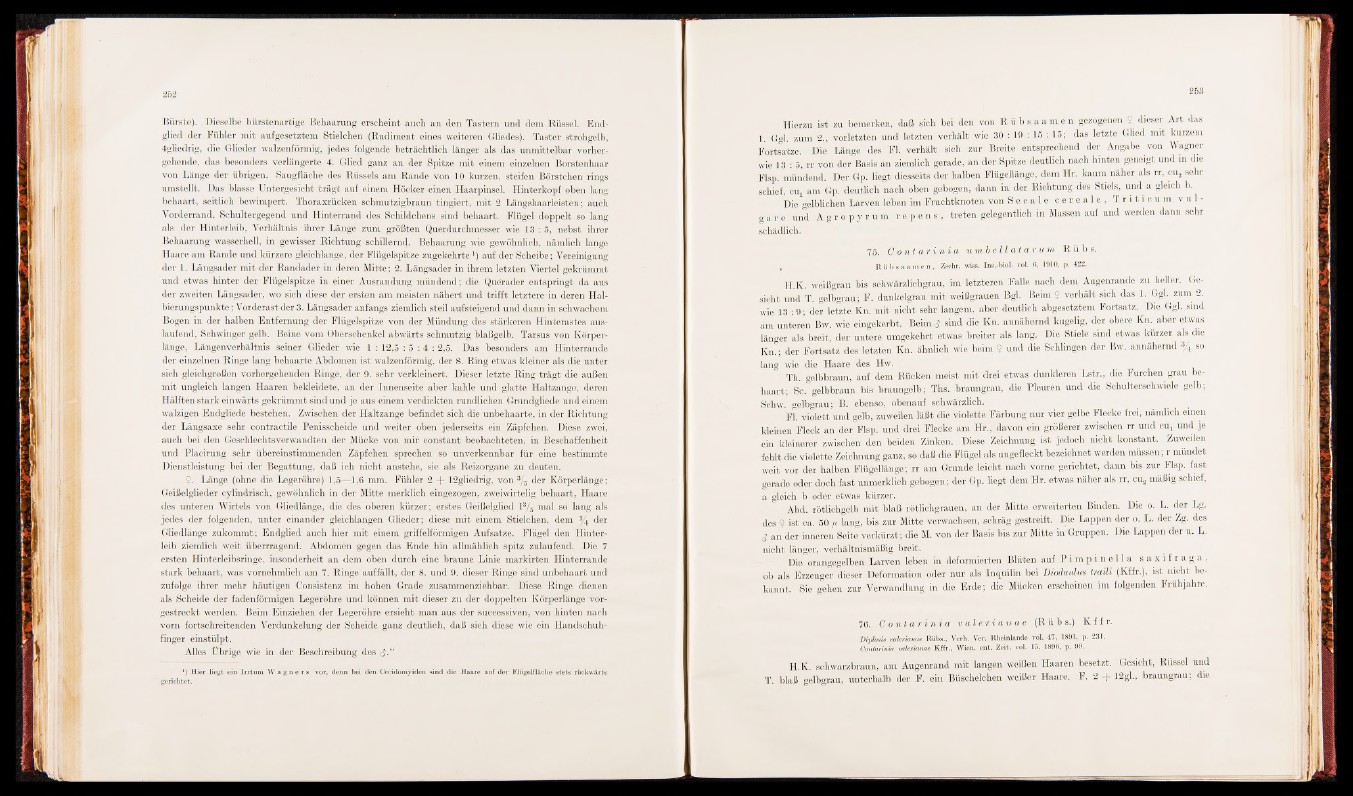
Bürste). Dieselbe bürstenartige Behaarung erscheint auch an den Tastern und dem Rüssel. Endglied
der Fühler mit aufgesetztem Stielchen (Rudiment eines weiteren Gliedes). Taster strohgelb,
4gliedrig, die Glieder walzenförmig, jedes fplgende beträchtlich länger als das unmittelbar vorhergehende,
das besonders verlängerte 4. Glied ganz an der Spitze mit einem einzelnen Borstenhaar
von Länge der übrigen. Saugfläche des Rüssels am Rande von 10 kurzen, steifen Börstchen rings
umstellt. Das blasse Untergesicht trägt auf einem Höcker einen Haarpinsel. Hinterkopf oben lang-
behaart, seitlich bewimpert. Thoraxrücken schmutzigbraun tingiert, mit 2 Längshaarleisten; auch
Vorderrand, Schultergegend und Hinterrand des Schildchens sind behaart. Flügel doppelt so lang
als der Hinterleib, Verhältnis ihrer Länge zum größten Querdurchmesser wie 13 : 5, nebst ihrer
Behaarung wasserhell, in gewisser Richtung schillernd. Behaarung wie gewöhnlich, nämlich lange
Haare am Rande und kürzere gleichlange, der Flügelspitze zugekehrte1) auf der Scheibe; Vereinigung
der 1. Längsader mit der Randader in deren Mitte; 2. Längsader in ihrem letzten Viertel gekrümmt
und etwas hinter der Flügelspitze in einer Ausrandung mündend; die Querader entspringt da aus
der zweiten Längsader, wo sich diese der ersten am meisten nähert und trifft letztere in deren Halbierungspunkte;
Vorderast der 3. Längsader anfangs ziemlich steil auf steigend und dann in schwachem
Bogen in der halben Entfernung der Flügelspitze von der Mündung des stärkeren Hinterastes auslaufend,
Schwinger gelb. Beine vom Oberschenkel abwärts schmutzig blaßgelb. Tarsus von Körperlänge,
Längenverhältnis seiner Glieder wie 1 : 12,5 : 5 : 4 :2,5. Das besonders am Hinterrande
der einzelnen Ringe lang behaarte Abdomen ist walzenförmig, der 8. Ring etwas kleiner als die unter
sich gleichgroßen vorhergehenden Ringe, der 9. sehr verkleinert. Dieser letzte Ring trägt die außen
mit ungleich langen Haaren bekleidete, an der Innenseite aber kahle und glatte Haltzange, deren
Hälften stark einwärts gekrümmt sind und je aus einem verdickten rundlichen Grundgliede und einem
walzigen Endgliede bestehen. Zwischen der Haltzange befindet sich die unbehaarte, in der Richtung
der Längsaxe sehr contractile Penisscheide und weiter oben jederseits ein Zäpfchen. Diese zwei,
auch bei den Geschlechtsverwandten der Mücke von mir constant beobachteten, in Beschaffenheit
und Placirung sehr übereinstimmenden Zäpfchen sprechen so unverkennbar für eine bestimmte
Dienstleistung bei der Begattung, daß ich nicht anstehe, sie als Reizorgane zu deuten.
Länge (ohne die Legeröhre) 1,5—1,6 mm. Fühler 2 -j- 12gliedrig, von 3/5 der Körperlänge;
Geißelglieder cylindrisch, gewöhnlich in der Mitte merklich eingezogen, zweiwirtelig behaart, Haare
des unteren Wirtels von Gliedlänge, die des oberen kürzer; erstes Geißelglied l3/5 mal so lang als
jedes der folgenden, unter einander gleichlangen Glieder; diese mit einem Stielchen, dem % der
Gliedlänge zukommt; Endglied auch hier mit einem griffelförmigen Aufsatze. Flügel den Hinterleib
ziemlich weit überrragend. Abdomen gegen das Ende hin allmählich spitz zulaufend. Die 7
ersten Hinterleibsringe, insonderheit an dem oben durch eine braune Linie markirten Hinterrande
stark behaart, was vornehmlich am 7. Ringe auf fällt, der 8. und 9. dieser Ringe sind unbehaart und
zufolge ihrer mehr häutigen Consistenz im hohen Grade zusammenziehbar. Diese Ringe dienen
als Scheide der fadenförmigen Legeröhre und können mit dieser zu der doppelten Körperlänge vorgestreckt
werden. Beim Einziehen der Legeröhre ersieht man aus der successiven, von hinten nach
vorn fortschreitenden Verdunkelung der Scheide ganz deutlich, daß sich diese wie ein Handschuhfinger
einstülpt.
Alles Übrige wie in der Beschreibung des .
J) Hier liegt ein Irrtum W a g n e r s vor, denn bei den Cecidomyiden sind die Haare auf der Flügelfläche stets rückwärts
gerichtet.
Hierzu ist zu bemerken, daß sich bei den von R ü b s a ä m e n gezogenen ? dieser Art das
1. Ggl. zum 2,, vorletzten und letzten verhält wie 30 :19 : 15 ; 15; das letzte Glied mit kurzem
Fortsatze. Die Länge d « B l verhält isliöh zur Breite entsprechend der Angabe von Wagner
wie 13 : 5, rr Von der Basis an ziemlich gerade, an der Spitze deutlich nach hinten geneigt und in die
Flsp. mündend. Der Gp. liegt diesseits der halben Flügellänge, dem Hr. kaum näher als rr, eu2 sehr
schief, cui-am Gp. deutlich nach oben gebogen, dann in der Richtung des Stiels, und a gleich b.
Die gelblichen Larven leben im Fruchtknoten vbjí S é c a l e c e r e a l e , T r i t i c u m v u l g
a r e und A g r ö p y r u m r e p e n s , treten gelegentlicpián Massen auf und werden dann sehr
schädlich.
75. G o n t a r i n i a u m b e l l a t a r um Rü b s .
, R ü b s a a m e n , Zschr. wiss. Ins.-biol. vol. 6, 1910, p. 422.
H.K. weißgrau bis schwärzlichgrau, im letzteren Falle hach dem Augenrande zu heller. Ge-
si&fe ünd T. gelbgraü; F. dunkelgrau mit weißgrauen Bgl. Beini $ Verhält sich das 1. Ggl. zum 2.
wie 13 : 9; der letzte Kn. mil'hicht sehr langem, aber deutlich abgesetztem Fortsatz. Die Ggl, sind
am unteren Bw. wih eingekerbt. Beim <* sind die Kn. annähernd'kugeli^ider obere Kn. aber etwas
lä n g e tÄ l r e i t , d « : untere umgekehrt etwas breiter als lang.1-Die Stiele sind etwas kürzer als die
Kn.; der Fortsatz des letzten Kn. ähnlich wie beiiüHu n d JlfeSchlingen der Bw. annähernd % so
lang wie die Haare des Hw.
Th. gelbbraun, auf dem Rücken meist mit drei etwas dunkleren Lstr., die Furchen grau be-
haart, 3Sb< gelbbraun bis braungelb; ThB. braungrau, die Pleuren und die Schulterschwiele gelb;
ifichw. .geibgrau; B. ebenso, obenauf schwärzlich.
Fl. violett und gelb, zuweilen läßt die viWlfifi! Färbung nur vier gelbe Flecke frei, nämlich einen
kleinen Fleck an der Flsp und drei Flecke¡,am Hr , davon ein gioßerer zwischen rr und c% und je
ein kleinerer zwischen den beiden Zinken. Diese Zeichnung ist jedoch nicht konstant. Zuweilen
fehlt die violette Zeichnung ganz, so .daß die Flügel als ungefleckt bezeichnet werden müssen; r mündet
weit vor der halben Flügellänge; rr am Grunde leicht nach vorne gerichtet, dann bis zur Flsp. fast
gerade äder doch fa st ütimetkHck gebogen: der Gp. liegt dem Hr. etwas näher als rr, ou2 mäßig schief,
a gleich b oder etwas kürzer.
Abd. rötliehgelb mit blaß tötlichgräuen, an der Mitte erweiterten Binden. Die o. L. der Lg.
d e s p is t ca. 50 p lang, bis zur Mitte verwachsen, schräg gestreift, Die Lappen der ö? L. der Zg. des
d an der inneren Beite verkürzt ; die M. von der Basis bis zur Mitte in Gruppen. Die Lappen der u.*L,
nicht länger, verhältnismäßig breit.
Die orangegelben Larven leben in deformierten Blüten auf P i m p i n e l l a s a x i f r a g a ,
ob als Erzeuger dieser Deformation oder nur als Inquilin bei Diodaulus traili (Kffr.), ist nicht bekannt.
Sie gehen zur Verwandlung in die Erde; die Mücken erscheinen im folgenden Frühjahre.
76. G o n t a r i n i a v al er i an a e (Rübs . ) Kf f r .
Diplosis valerianae Rübs., Verh. Ver. Rheinlande vol. 47, 1891, p. 231;
Contarinia valerianae Kffr., Wien. ent. Zeit. vol. 15, 1896, p. 99.
H.K, schwarzbraun, am Augenrand mit langen »weißen Haaren besetzt. Gesicht, Rüssel und
T. blaß gelbgrau, unterhalb der F. ein Büschelchen weißer Haare. F. 2 + 12gl., braungrau; die