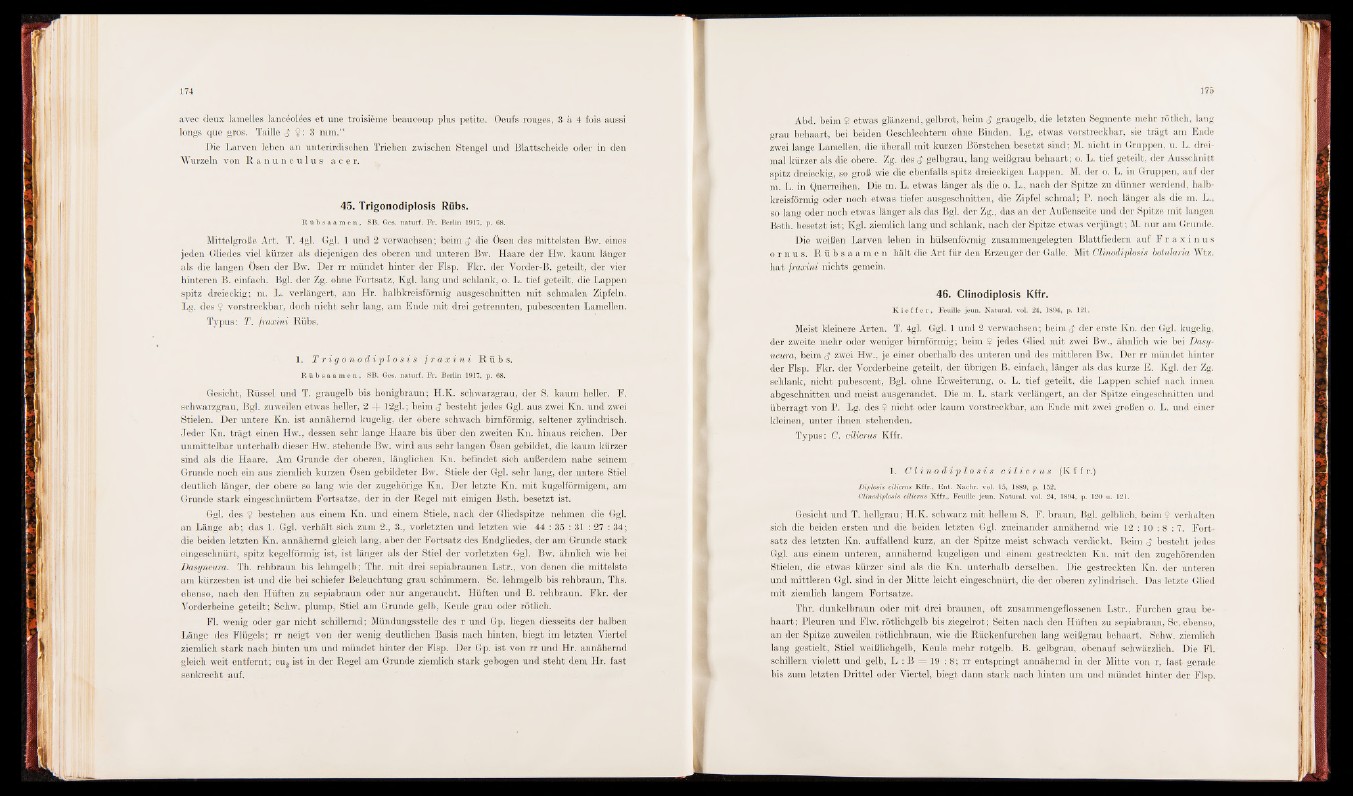
avec deux lamelles lancéolées et une troisième beaucoup plus petite. Oeufs rouges, 3 à 4 fois aussi
longs que gros. Taille d ? • 3 mm.“
Die Larven leben an unterirdischen Trieben zwischen Stengel und Blattscheide oder in den
Wurzeln von R a n u n c u l u s a c e r .
45. Trigonodiplosis Rübs.
R ü b s a a m e n , SB. Ges. naturf. Fr. Berlin 1917, p. 68.
Mittelgroße Art. T. 4gl. Ggl. 1 und 2 verwachsen; beim die Ösen des mittelsten Bw. eines
jeden Gliedes viel kürzer als diejenigen des oberen und unteren Bw. Haare der Hw. kaum länger
als die langen Ösen der Bw. Der rr mündet hinter der Flsp. Fkr. der Vorder-B. geteilt, der vier
hinteren B. einfach. Bgl. der Zg. ohne Fortsatz, Kgl. lang und schlank, o. L. tief geteilt, die Lappen
spitz dreieckig; m. L. verlängert, am Hr. halbkreisförmig ausgeschnitten mit schmalen Zipfeln.
Lg. des $ vorstreckbar, doch nicht sehr lang, am Ende mit drei getrennten, pubescenten Lamellen.
Typus: T. fraxini Rübs.
1. T r i g o n o d i p l o s i s f r a x i n i R üb s .
R ü b s a a me n , SB. Ges. naturf. Fr. Berlin 1917, p. 68.
Gesicht, Rüssel und T. graugelb bis honigbraun; H.K. schwarzgrau, der S. kaum heller. F.
schwarzgrau, Bgl. zuweilen etwas heller, 2 + 12gl.; beim <$ besteht jedes Ggl. aus zwei Kn. und zwei
Stielen. Der untere Kn. ist annähernd kugelig, der obere schwach birnförmig, seltener zylindrisch.
Jeder Kn. trägt einen Hw., dessen sehr lange Haare bis über den zweiten Kn. hinaus reichen. Der
unmittelbar unterhalb dieser Hw. stehende Bw. wird aus sehr langen Ösen gebildet, die kaum kürzer
sind als die Haare. Am Grunde der oberen, länglichen Kn. befindet sich außerdem nahe seinem
Grunde noch ein aus ziemlich kurzen Ösen gebildeter Bw. Stiele der Ggl. sehr lang, der .untere Stiel
deutlich länger, der obere so lang wie der zugehörige Kn. Der letzte Kn. mit kugelförmigem, am
Grunde stark eingeschnürtem Fortsatze, der in der Regel mit einigen Bsth. besetzt ist.
Ggl. des $ bestehen aus einem Kn. und einem Stiele, nach der Gliedspitze nehmen die Ggl.
an Länge ab; das 1. Ggl. verhält sich zum 2., 3.r vorletzten und letzten wie 44 : 35 : 31 : 27 : 34;
die beiden letzten Kn. annähernd gleich lang, aber der Fortsatz des Endgliedes, der am Grunde stark
eingeschnürt, spitz kegelförmig ist, ist länger als der Stiel der vorletzten Ggl. Bw. ähnlich wie bei
Dasyneura. Th. rehbraun bis lehmgelb; Thr. mit drei sepiabraunen Lstr., von denen die mittelste
am kürzesten ist und die bei schiefer Beleuchtung grau schimmern. Sc. lehmgelb bis rehbraun, Ths.
ebenso, nach den Hüften zu sepiabraun oder nur angeraucht. Hüften und B. rehbraun. Fkr. der
Vorderbeine geteilt; Schw. plump, Stiel am Grunde gelb, Keule grau oder rötlich.
Fl. wenig oder gar nicht schillernd; Mündungsstelle des r und Gp. liegen diesseits der halben
Länge des Flügels; rr neigt von der wenig deutlichen Basis nach hinten, biegt im letzten Viertel
ziemlich stark nach hinten um und mündet hinter der Flsp. Der Gp. ist von rr und Hr. annähernd
gleich weit entfernt; cu2 ist in der Regel am Grunde ziemlich stark gebogen und steht.dem Hr. fast
senkrecht auf.
Abd. beim $ etwas glänzend, gelbrot, beim d graugelb, die letzten Segmente mehr rötlich, lang
grau behaart, bei beiden Geschlechtern ohne Binden. Lg. etwas vorstreckbar, sie trägt am Ende
zwei lange Lamellen, die überall mit kurzen Börstchen besetzt sind; M. nicht in Gruppen, u. L. dreimal
kürzer als die obere. Zg. des $ gelbgrau, lang weißgrau behaart; o. L. tief geteilt, der Ausschnitt
spitz dreieckig, so groß wie die ebenfalls spitz dreieckigen Lappen. M. der o. L. in Gruppen, auf der
m. L. in Querreihen. Die m. L. etwas länger als die o. L., nach der Spitze zu dünner werdend, halbkreisförmig
oder noch etwas tiefer ausgeschnitten, die Zipfel schmal; B. noch länger als die m. L.,
so lang oder noch etwas länger als das Bgl. der Zg., das an der Außenseite und der Spitze mit langen
Bsth. besetzt ist; Kgl. ziemlich lang und schlank, nach der Spitze etwas verjüngt; M. nur am Grunde.
Die weißen Larven leben in hülsenförmig zusammengelegten Blattfiedern auf F r a x i n u s
o r n u s . R ü b s a a m e n hält die Art für den Erzeuger der Galle. Mit Clinodiplosis botularia Wtz.
hat fraxini nichts gemein.
46. Clinodiplosis Kffr.
K i e f f e r , Feuille jeun. Natural, vol. 24, 1894, p. 121.
Meist kleinere Arten. T. 4gl. Ggl. 1 und 2 verwachsen; beim d der erste Kn. der Ggl. kugelig,
der zweite mehr oder weniger birnförmig; beim ? jedes Glied mit zwei Bw., ähnlich wie bei Dasyneura,
beim d zwei Hw., je einer oberhalb des unteren und des mittleren Bw. Der rr mündet hinter
der Flsp. Fkr. der Vorderbeine geteilt, der übrigen B. einfach, länger als das kurze E. Kgl. der Zg.
schlank, nicht pubescent, Bgl. ohne Erweiterung, o. L. tief geteilt, die Lappen schief nach innen
abgeschnitten und meist ausgerandet. Die m. L. stark verlängert, an der Spitze eingeschnitten und
überragt von P. Lg. des ? nicht oder kaum vorstreckbar, am Ende mit zwei großen o. L. und einer
kleinen, unter ihnen stehenden.
Typus: G. cilicrus Kffr.
1. C l i n o d i p l o s i s c i l i c r u s (Kf f r . )
Diplosis cilicrus Kffr., Ent. Nachr. vol. 15, 1889, p. 152.
Clinodiplosis cilicrus Kffr., Feuille jeun. Natural, vol. 24, 1894, p. 120 u. 121.
Gesicht und T. hellgrau; H.K. schwarz mit hellem S. F. braun, Bgl. gelblich, beim $ verhalten
sich die beiden ersten und die beiden letzten Ggl. zueinander annähernd wie 12 : 10 : 8 : 7. Fortsatz
des letzten Kn. auffallend kurz, an der Spitze meist schwach verdickt. Beim 3 besteht jedes
Ggl. aus einem unteren, annähernd kugeligen und einem gestreckten Kn. mit den zugehörenden
Stielen, die etwas kürzer sind als die Kn. unterhalb derselben. Die gestreckten Kn. der unteren
und mittleren Ggl. sind in der Mitte leicht eingeschnürt, die der oberen zylindrisch. Das letzte Glied
mit ziemlich langem Fortsatze.
Thr. dunkelbraun oder mit drei braunen, oft zusammengeflossenen Lstr., Furchen grau behaart
; Pleuren und Flw. rötlichgelb bis ziegelrot; Seiten nach den Hüften zu sepiabraun, Sc. ebenso,
an der Spitze zuweilen rötlichbraun, wie die Rückenfurchen lang weißgrau behaart. Schw. ziemlich
lang gestielt, Stiel weißlichgelb, Keule mehr rotgelb. B. gelbgrau, obenauf schwärzlich. Die Fl.
schillern violett und gelb, L : B = 19 : 8; rr entspringt annähernd in der Mitte von r, fast gerade
bis zum letzten Drittel oder Viertel, biegt dann stark nach hinten um und mündet hinter der. Flsp.