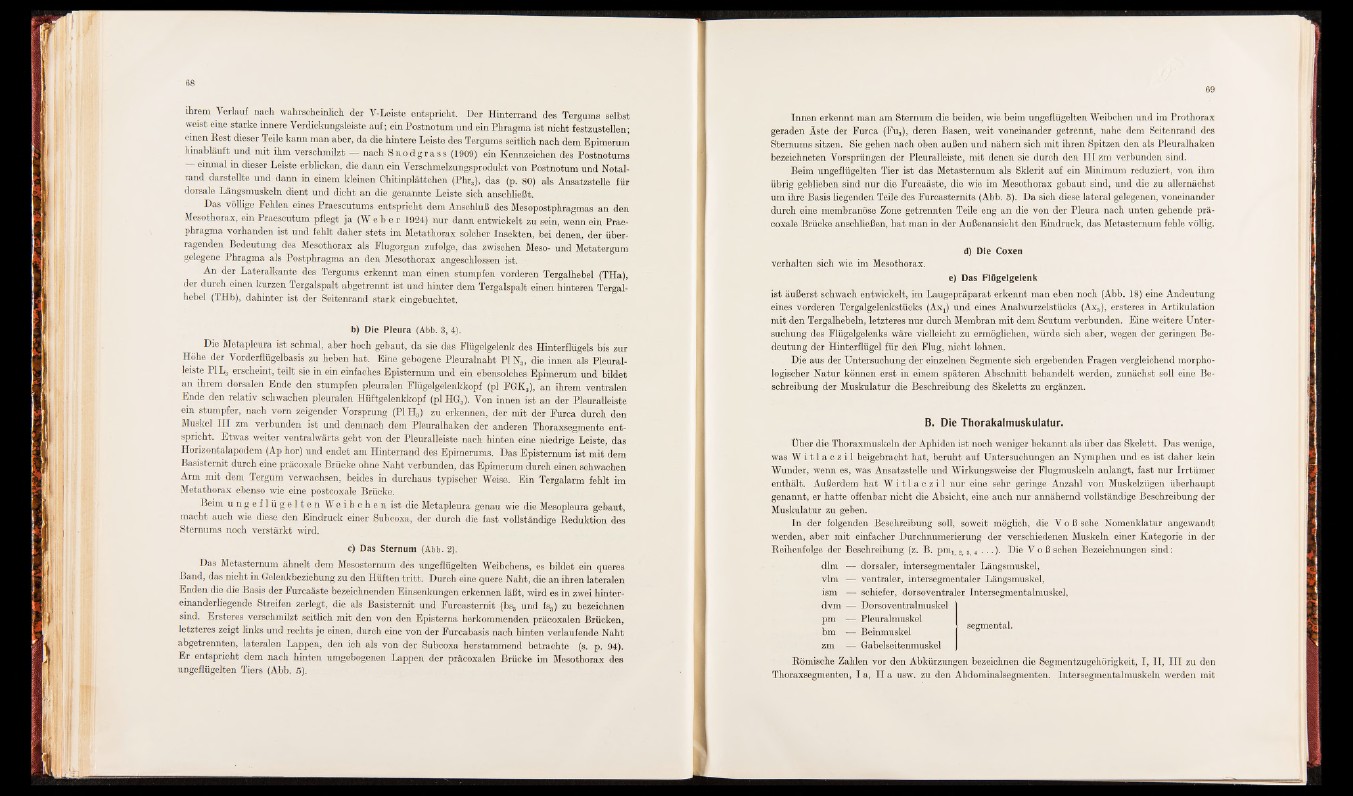
ihrem Verlauf nach wahrscheinlich der V-Leiste entspricht. Der Hinterrand des Tergums selbst
weist eine starke innere Verdickungsleiste auf; ein Postnotum und ein Phragma ist nicht festzustellen;
einen Rest dieser Teile kann man aber, da die hintere Leiste des Tergums seitlich nach dem Epimerum
hinabläuft und mit ihm verschmilzt — nach S n o d g r a s s (1909) ein Kennzeichen des Postnotums
— einmal in dieser Leiste erblicken, die dann ein Verschmelzungsprodukt von Postnotum und Notalrand
darstellte und dann in einem kleinen Chitinplättchen (Phr3), das (p. 80) als Ansatzstelle für
dorsale Längsmuskeln dient und dicht an die genannte Leiste sich anschließt.
Das völlige Fehlen eines Praescutums entspricht dem Anschluß des Mesopostphragmas an den
Mesothorax, ein Praescutum pflegt ja (W e b e r 1924) nur dann entwickelt zu sein, wenn ein Prae-
phragma vorhanden ist und fehlt daher stets im Metathorax solcher Insekten, bei denen, der überragenden
Bedeutung des Mesothorax als Flugorgan zufolge, das zwischen Meso- und Metatergum
gelegene Phragma als Postphragma an den Mesothorax angeschlossen ist.
An der Lateralkante des Tergums erkennt man einen stumpfen vorderen Tergalhebel (THa),
der durch einen kurzen Tergalspalt abgetrennt ist und hinter dem Tergalspalt einen hinteren Tergalhebel
(THb), dahinter ist der Seitenrand stark eingebuchtet.
b) Die Pleura (Abb. 3, 4).
Die Metapleura ist schmal, aber hoch gebaut, da sie das Flügelgelenk des Hinterflügels bis zur
Höhe der Vorderflügelbasis zu heben hat. Eine gebogene Pleuralnaht PI N3, die innen als Pleuralleiste
P1L3 erscheint, teilt sie in ein einfaches Episternum und ein ebensolches Epimerum und bildet
an ihrem dorsalen Ende den stumpfen pleuralen Flügelgelenkkopf (pl FGK3), an ihrem ventralen
Ende den relativ schwachen pleuralen Hüftgelenkkopf (pl HG3). Von innen ist an der Pleuralleiste
ein stumpfer, nach vorn zeigender Vorsprung (Pl H 3) zu erkennen, der mit der Furca durch den
Muskel I I I zm verbunden ist und demnach dem Pleuralhaken der anderen Thoraxsegmente entspricht.
Etwas weiter ventralwärts geht von der Pleuralleiste nach hinten eine niedrige Leiste, das
Horizontalapodem (Ap hör) und endet am Hinterrand des Epimerums. Das Episternum ist mit dem
Basisternit durch eine präcoxale Brücke ohne Naht verbunden, das Epimerum durch einen schwachen
Arm mit dem Tergum verwachsen, beides in durchaus typischer Weise. Ein Tergalarm fehlt im
Metathorax ebenso wie eine postcoxale Brücke.
Beim u n g e f l ü g e l t e n W e i b c h e n ist die Metapleura genau wie die Mesopleura gebaut,
macht auch wie diese den Eindruck einer Subcoxa, der durch die fast vollständige Reduktion des
Sternums noch verstärkt wird.
c) Das Sternum (Abb. 2).
Das Metasternum ähnelt dem Mesosternum des ungeflügelten Weibchens, es bildet ein queres
Band, das nicht in Gelenkbeziehung zu den Hüften tritt. Durch eine quere Naht, die an ihren lateralen
Enden die die Basis der Furcaäste bezeichnenden Einsenkungen erkennen läßt, wird es in zwei hintereinanderliegende
Streifen zerlegt, die als Basisternit und Furcasternit (bs3 und fs3) zu bezeichnen
sind. Ersteres verschmilzt seitlich mit den von den Episterna herkommenden präcoxalen Brücken,
letzteres zeigt links und rechts je einen, durch eine von der Furcabasis nach hinten verlaufende Naht
abgetrennten, lateralen Lappen, den ich als von der Subcoxa herstammend betrachte (s. p. 94).
Er entspricht dem nach hinten umgebogenen Lappen der präcoxalen Brücke im Mesothorax des
ungeflügelten Tiers (Abb. 5 ).
Innen erkennt man am Sternum die beiden, wie beim ungeflügelten Weibchen und im Prothorax
geraden Äste der Furca (Fu3), deren Basen, weit voneinander getrennt, nahe dem Seitenrand des
Sternums sitzen. Sie gehen nach oben außen und nähern sich mit ihren Spitzen den als Pleuralhaken
bezeichneten Vorsprüngen der Pleuralleiste, mit denen sie durch den I II zm verbunden sind.
Beim ungeflügelten Tier ist das Metasternum als Sklerit auf ein Minimum reduziert, von ihm
übrig geblieben sind nur die Furcaäste, die wie im Mesothorax gebaut sind, und die zu allernächst
um ihre Basis liegenden Teile des Furcasternits (Abb. 5). Da sich diese lateral gelegenen, voneinander
durch eine membranöse Zone getrennten Teile eng an die von der Pleura nach unten gehende präcoxale
Brücke anschließen, hat man in der Außenansicht den Eindruck, das Metasternum fehle völlig.
d) Die Coxen
verhalten sich wie im Mesothorax.
e) Das Flügelgelenk
ist äußerst schwach entwickelt, im Laugepräparat erkennt man eben noch (Abb. 18) eine Andeutung
eines vorderen Tergalgelenkstücks (Axx) und eines Analwurzelstücks (Ax3), ersteres in Artikulation
mit den Tergalhebeln, letzteres nur durch Membran mit dem Scutum verbunden. Eine weitere Untersuchung
des Flügelgelenks wäre vielleicht zu ermöglichen, würde sich aber, wegen der geringen Bedeutung
der Hinterflügel für den Flug, nicht lohnen.
Die aus der Untersuchung der einzelnen Segmente sich ergebenden Fragen vergleichend morphologischer
Natur können erst in einem späteren Abschnitt behandelt werden, zunächst soll eine Beschreibung
der Muskulatur die Beschreibung des Skeletts zu ergänzen.
B. Die Thorakalmuskulatur.
Uber die Thoraxmuskeln der Aphiden ist noch weniger bekannt als über das Skelett. Das wenige,
was W i t l a c z i l beigebracht hat, beruht auf Untersuchungen an Nymphen und es ist daher kein
Wunder, wenn es, was Ansatzstelle und Wirkungsweise der Flugmuskeln anlangt, fast nur Irrtümer
enthält. Außerdem hat W i t l a c z i l nur eine sehr geringe Anzahl von Muskelzügen überhaupt
genannt, er hatte offenbar nicht die Absicht, eine auch nur annähernd vollständige Beschreibung der
Muskulatur zu geben.
In der folgenden Beschreibung soll, soweit möglich, die V o ß sehe Nomenklatur angewandt
werden, aber mit einfacher Durchnumerierung der verschiedenen Muskeln einer Kategorie in der
Reihenfolge der Beschreibung (z. B. pm1> 2l a, 4 .. .)• Die V o ß sehen Bezeichnungen sind:
dlm — dorsaler, intersegmentaler Längsmuskel,
vlm — ventraler, intersegmentaler Längsmuskel,
ism ¡p§ schiefer, dorsoventraler Intersegmentalmuskel,
dvm — Dorsoventralmuskel 1
pm — Pleuralmuskel .
: _ . , , > segmen tal.
bm —- Bemmuskel
zm -— Gabelseitenmuskel
Römische Zahlen vor den Abkürzungen bezeichnen die Segmentzugehörigkeit, I, II, I II zu den
Thoraxsegmenten, I a, I I a usw. zu den Abdominalsegmenten. Intersegmentalmuskeln werden mit